USA unmittelbar nach dem Sezessionskrieg: Robert Bennett, der Major, und Martin Moore, der Marshal, haben im Krieg auf verschiedenen Seiten gestanden, sind aber gute Freunde. Als die Ablehnung seiner Nachbarn den Südstaatler Moore aus Virginia vertreibt, hat Bennett, Adjutant des US-Präsidenten, einen Job für seinen Freund.
Schon bald geraten sie mit dem Ku-Klux-Klan aneinander – und treffen auf alte Bekannte, die sie in die tiefste Hölle wünschen.
Und obendrein ist da noch der Präsident, dessen Posten alles andere als sicher ist …
Prolog
Im September 1865 war in den USA der Schlachtenlärm des Bürgerkrieges verhallt, die allerletzten Landtruppen der geschlagenen Konföderierten Staaten hatten sich ergeben. Der Süden lag besiegt am Boden, weitgehend zerstört und verwüstet.
Allein ein einsames konföderiertes Kaperschiff, die Alabama, war vom Zusammenbruch der Konföderation und dem daraus resultierenden Kriegsende noch nicht informiert und brachte weiterhin Schiffe der Vereinigten Staaten auf – ein Einzelfall. Die Südstaatler waren durch die totale Niederlage viel zu geschockt, um nach den grausamen Verlusten an Menschenleben und den rüden Verwüstungen an landwirtschaftlichen Flächen, Gebäuden und privatem Hab und Gut durch Unionstruppen noch an eine Fortführung des Kampfes für ihre Unabhängigkeit zu denken. Zur Niederlage kam noch der materielle Verlust hinzu, denn die Weißen im Süden verloren zu einem guten Teil dreifach: Erstens hatte man ihnen durch die Sklavenbefreiung praktisch ihr Vermögen enteignet. Schließlich waren die schwarzen Sklaven nichts anderes als eine Kapitalanlage, buchstäblich arbeitendes Geld. Zweitens sollten sie für dieselbe Arbeit, die ihnen die Sklaven vor dem Krieg für mehr oder weniger gute Kost und Logis gemacht hatten, nun zusätzlich bezahlen. Und drittens waren viele Plantagen und Stadthäuser zerstört, so dass für deren Instandsetzung hohe Summen investiert werden mussten, die ob der übrigen Vermögensverluste nicht ohne weiteres aufgebracht werden konnten.
Unklar blieb in den ersten Monaten nach dem Krieg, ob der Norden den Süden für den vom Zaun gebrochenen Streit noch weiter bluten lassen wollte. Wohl stammte Präsident Johnson selbst aus Tennessee, hatte aber die Sezession seines Heimatstaates und der anderen zehn Südstaaten immer scharf verurteilt. Außerdem stammte er aus bescheidenen Verhältnissen, was ihn nach Ansicht vieler Südstaatler für überzogene Neidreaktionen geradezu prädestinierte. Im Kongress war durch die Wahl vom 6. November 1864 eine komfortable Mehrheit für die radikalen Republikaner entstanden, die grobe Maßnahmen in den besiegten Staaten vehement befürworteten. Nach dem Willen vieler Kongressabgeordneter sollten Truppen der nun wiederhergestellten Union die elf abtrünnigen Staaten besetzen, um jede Regung von Widerstand gegen die neuen, unionstreuen Regierungen im Keim zu ersticken.
Zur Überraschung der geschlagenen Südstaaten erfüllte Johnson die lautstarken Forderungen nach harten Repressionen in der ehemaligen Konföderation aber nicht, sondern hielt sich an die noch von Präsident Lincoln geplante Versöhnungspolitik.
In seiner Antrittsrede vom 4. März 1865 hatte Lincoln Gerechtigkeit für alle und Versöhnung der Kriegsgegner als seine künftige Politik umrissen und seinem Nachfolger als Erbe hinterlassen. Johnson interpretierte die Rede auf seine eigene Weise und beschränkte die Verfolgung der Konföderierten auf deren politische Köpfe und Leute, die mehr als zwanzigtausend Dollar ihr eigen nannten – wobei auch nicht ganz klar war, ob diese Summe für Vermögen vor oder nach dem Krieg galt, was durchaus ein himmelweiter Unterschied sein konnte. Wiederholt hatten Abgeordnete in der sitzungsfreien Zeit nach dem Krieg darauf hingewiesen, dass mit dem ersten Zusammentreten des Kongresses ein anderer Wind wehen würde – und dass sich dann auch der Präsident warm anziehen müsse. Der aber versuchte, bis zur ersten Sitzung am 4. Dezember 1865 Fakten zu schaffen, die nicht einfach rückgängig zu machen waren; jedenfalls nicht, ohne die Gefahr eines Wiederaufflammens des Krieges heraufzubeschwören – trotz aller Ressentiments gegen neues Blutvergießen auf beiden Seiten.
Die Folgen, die sein Handeln für sich selbst und auch für die Südstaaten haben konnte, ignorierte der Präsident. Stur wie ein Maulesel folgte er dem eingeschlagenen Pfad, auf keine Warnung und keinen Rat hörend. Ob seine Entscheidungen aber wirklich Bestand haben würden, das war nicht zu übersehen, weder für die wütend zeternden Kongressabgeordneten, die einstweilen nichts tun konnten, noch für die unter dem Damoklesschwert totaler Enteignung stehenden Südstaatler, schon gar nicht für den Präsidenten selbst.
Nachdem der Krieg nun beendet war, wurden aber nicht nur die Soldaten der besiegten Konföderation nicht mehr benötigt. Auch die größten Teile der Unionsarmee wurden aufgelöst und die Leute heimgeschickt. Für diejenigen, für die der Krieg die Chance zu schneller Karriere gewesen war, begann die große Lebenskrise, als sie feststellen mussten, dass ihre Generalsränge nur so genannte Brevet-Ränge waren, zeitlich begrenzte Dienstgrade, die nur für die Zeit der Existenz der von ihnen befehligten Freiwilligenverbände galten. Einer von denen, auf die dies zutraf, war Major-General George Armstrong Custer, ein Akademiekamerad von Robert Bennett, ebenfalls gerade sechsundzwanzig Jahre alt. Wie fast alle viel zu schnell beförderten Offiziere stutzte man ihn zurück. Custer fand sich als Lieutenant-Colonel in der verbliebenen Restarmee wieder – und hatte damit seine Probleme
Anderen, vor allem älteren Offizieren, die reguläre Truppen kommandiert hatten, bot man an, mit einem höheren Rang in Pension zu gehen oder mit einem niedrigeren Dienstgrad zu bleiben. Unter diese Regelung fielen Brigadier-General Frederick Bennett und Colonel Richard Craig. Frederick Bennett überlegte nicht lange. Er war neunundfünfzig Jahre alt, hatte ein lahmes Bein und fand, dass er sich lange genug mit Indianern und anderem Gesindel herumgeärgert hatte. Sein erster Diensttag als Major-General war denn auch sein letzter. Richard Craig hatte seine Armeezugehörigkeit ohnehin nur für die Zeit des Krieges als notwendig angesehen und nahm mit einiger Freude den Stern des Brigadier-Generals als pauschale Auszeichnung für seine Dienste entgegen.
Mit der Pensionierung von Richard Craig und Frederick Bennett und der Auflösung der zur Brigade gehörenden Freiwilligenverbände stellte sich zum einen in der 7th US-Cavalry nicht nur die Kommandeursfrage, sondern eher die Existenzfrage der Brigade selbst. Kriegsminister Stanton beantwortete sie auf die einfachste Weise: Er löste Brigade Bennett mitsamt der 7th US-Cavalry auf und erfüllte damit gleich eine von den Kongressabgeordneten diskutierte Sparmaßnahme.
Am 16. September 1865 verabschiedete der Präsident die Brigade Bennett in deren Heimatfort Donelson. Die Soldaten erhielten ihren ehrenvollen Abschied, alle bekamen die Medaille der Army of the Potomac. Ein letztes Mal paradierte die Truppe vor Präsident und Kriegsminister.
Robert Bennett, als Major des Stabes und Adjutant des Präsidenten anwesend, konnte seine Tränen genauso wenig unterdrücken wie seine Kameraden. Es war für sie alle ein trauriger Moment, als die Regimentsfahnen feierlich eingerollt wurden, um nie mehr unter freiem Himmel zu flattern – und das ausgerechnet an dem Tag, der für die 7th US-Cavalry so etwas wie ein Regimentsfeiertag war.
Genau drei Jahre zuvor war die 7th US-Cavalry zum Tagesgespräch der gesamten Army of the Potomac geworden, als es der C-Schwadron in der Schlacht am Antietam gelungen war, durch raffinierte Schutzbauten den linken Flügel der Armee zu stabilisieren und ein ganzes Infanteriebataillon durch die bloße Aushilfe von zwanzig Mann von eiligem Rückzug abzuhalten. Viele Männer waren damals gefallen, noch mehr verwundet worden, manche – wie Robert Bennett und Thomas Craig – hatten nur knapp überlebt. Schon zum damaligen Zeitpunkt hatte der Armeechef Frederick Bennett die Weisung erteilen wollen, das arg dezimierte Regiment, mindestens aber die praktisch nicht mehr existente C-Schwadron aufzulösen. Frederick hatte sich geweigert, hatte das Regiment samt der C-Schwadron erhalten und wieder aufgefüllt und zu einer der erfolgreichsten und besten Einheiten der Armee gemacht. Nun existierte es nicht mehr.
In diesem, für sie alle einschneidenden Moment, konnten die recht hartgesottenen Männer der 7th US-Cavalry die Reaktion der Südstaatler begreifen, die vor knapp einem halben Jahr so geweint hatten.
Kapitel 1
Familienangelegenheiten
Im Gegensatz zu seinen früheren Kameraden hatte Robert einigermaßen planbare Zukunftsaussichten, wenn seine Aufgabe auch sehr direkt mit dem Amt des Präsidenten verknüpft war. Im Augenblick dachte er allerdings nicht daran, dass er seinen Job schon bald wieder verlieren könnte, nämlich dann, wenn Johnson bei den nächsten Wahlen gegen einen anderen Kandidaten verlieren würde – oder wenn der Kongress mit der Drohung durchkommen sollte, ihn nach einem Impeachment-Verfahren* abzusetzen.
Im Moment war Robert eher mit familiären Dingen beschäftigt. Susan, seine Frau, erwartete ihr erstes Kind, und der berechnete Geburtstermin stand unmittelbar bevor. Der Spätsommer war heiß in diesem Jahr, und Susan litt unter der Hitze. Ihre Mutter und ihre Tante waren nach Washington gekommen, um die junge Frau zu unterstützen und spazierten täglich mit ihr am Potomac entlang, wo es etwas frischer war als in der Stadt selbst.
Einige Tage später, es war der 25. September, rutschte Robert bei einem Arbeitstee des Präsidenten unruhig auf seinem Stuhl hin und her.
„Sie sind geistesabwesend und unruhig, Major!“, rügte Präsident Johnson. „Sitzen Sie endlich still!“
Robert schrak zusammen.
„Entschuldigung, Mr. President. Ich mache mir nur Sorgen um meine Frau. Es ging ihr heute Morgen nicht sehr gut.“
Johnson sah Robert eine Weile an.
„Ich verstehe zwar, dass Sie in Sorge sind, aber nehmen Sie sich jetzt bitte zusammen, Major Bennett!“
Robert wusste, dass Johnson keine Disziplinlosigkeiten duldete. Wegen der Auflösung seines alten Regiments hatte es auch gewisse Missstimmung zwischen dem Präsidenten und seinem Adjutanten gegeben, doch waren solche Meinungsverschiedenheiten in der Regel von kurzer Dauer. Zum jetzigen Zeitpunkt störten sie allerdings.
„Ich werd’s versuchen, Mr. President“, versprach Robert mit dem Anflug eines Seufzens nervös und mühte sich, stillzusitzen. Es gelang ihm halbwegs, dafür wurden seine Fingernägel kürzer.
Schließlich hatte er die ihm unendlich lang erscheinende Konferenz überstanden und stürmte, gleich nachdem Johnson die Sitzung für beendet erklärt hatte, aus dem Raum. Minister Stanton sah ihm über den Brillenrand nach.
„Erstaunlich, wie nervös ein sonst so abgebrühter Soldat sein kann, wenn seine Frau ein Kind bekommt.“
General Grant, der Armeechef, paffte an seiner Zigarre.
„Ist mir genauso gegangen, als mein Sohn geboren wurde. Ich bin wie ein Löwe im Käfig herumgelaufen. Kennen Sie eigentlich Mrs. Bennett?“, fragte er Stanton. Der Minister schüttelte den Kopf.
„Schade, Mr. Stanton, da haben Sie was verpasst. Major Bennetts Frau ist ein echter Engel, außerdem mehr als nur hübsch – sogar im schwangeren Zustand. Wenn der Krieg noch etwas länger gewesen wäre, hätte ich Mrs. Bennett als nächsten Sanitätsoffizier* in den Stab geholt. Das Mädchen ist einfach einmalig. Wenn sich ein Mann um so eine Frau keine Sorgen macht, dann ist er aus Stein.“
Robert stürmte in seine Wohnung und wurde gleich von seinem Vater abgefangen.
„Halt, mein Junge!“, kommandierte er und hielt seinen Sohn am Ärmel fest.
„He, was soll das?“
„Komm, bleib’ hier. Die Geburt hat begonnen. Du störst jetzt nur“, erwiderte Frederick.
„Dad, lass mich zu meiner Frau!“, forderte Robert knurrend.
„Kommt nicht in Frage!“, versetzte der General a. D. „Ich habe von deiner Schwiegermutter den strikten Befehl, dich da nicht ‘rein zu lassen. Ich bin immer noch so viel Soldat, dass ich solche Befehle befolge. Du kannst Susan doch nicht helfen.“
„Ich habe ihr die Suppe eingebrockt!“, widersprach Robert. „Schließlich habe ich das Kind gezeugt!“
Frederick grinste, dass sich der sauber gestutzte weiße Bart sträubte.
„Komm, mein Sohn, häng’ den verdammten Säbel aus, zieh’ dir was Bequemes an und bleib’ hier im Wohnzimmer. Deine Frau hat Hilfe durch ihre Mutter und ihre Tante.“
„Ich wünschte, Lucas würde noch leben. Mir wäre sehr viel wohler, wenn er hier wäre und sich um Susan kümmern könnte“, seufzte Robert.
„Vielleicht ist dir entgangen, dass Louisa Craig Hebamme ist – trotz der Tatsache, dass sie Nonne ist. Und ‘ne Hebamme ist jetzt eher gefragt als ein Arzt.“
Robert schnaubte, aber er hängte den Säbel aus, zog den Uniformrock aus und nahm die beengende Schleife vom Hemdkragen ab. Zunächst setzte er sich auch in einen der Sessel im Wohnzimmer, von dem das Schlafzimmer direkt abging, aber lange hielt er es im Sitzen nicht aus. Er stand auf und begann, unruhig auf und ab zu gehen. Weder sein Vater noch sein inzwischen hinzugekommener Schwiegervater konnten ihn beruhigen.
Louisa Craig kam aus dem Schlafzimmer.
„Setz’ dich endlich hin!“, kommandierte sie. „Du machst deine Frau ganz nervös, so wie du hier herum tigerst.“
„Das soll sie mir selber sagen!“, entgegnete Robert gereizt und wollte an der Nonne vorbei, aber sie stoppte ihn.
„Nein, du gehst da nicht ‘rein. Du bist ihr mit deiner Nervosität keine Hilfe. Das regt sie unnötig auf.“
Robert wollte etwas einwenden, aber Louisa schüttelte nur den Kopf.
„Junge, Junge, mich würdest du Nervösling beim Kinderkriegen jedenfalls völlig aus dem Konzept bringen!“
„In die Verlegenheit dürftest du kaum kommen!“, versetzte Robert bissig.
„Vielleicht wollte ich nicht mit einem solchen Nervenbündel wie dir behaftet sein?“, grinste Louisa.
„Ich hab’ ‘ne andere Geschichte gehört, weshalb du in den Orden eingetreten bist, aber …“
Robert kam nicht weiter, denn Susan schrie laut auf. Er wollte an Louisa vorbei, aber sie verstellte ihm hartnäckig den Weg, sein Vater und sein Schwiegervater hielten ihn mit einiger Gewalt fest.
„Lasst mich zu meiner Frau, verdammt!“, rief er und wehrte sich, kam aber nicht los. Einen Moment war Stille, dann krähte ein Baby.
So sehr sich die Geschwister Craig und Roberts Vater auch mühten, er war nicht mehr zu halten und brach ins Schlafzimmer durch.
„Susan!“, schrie er. Gwendolyn Craig drehte sich erschrocken um, das Baby in Tüchern verpackt auf dem Arm.
„Pscht, schrei nicht so. Sie ist gerade eingeschlafen“, warnte sie leise. Robert wurde bleich.
„Was? Ist … ist sie …?“, stotterte er.
„Nein, sie ist nur sehr erschöpft.“
„Sind … sind beide gesund?“
Gwendolyn lächelte und überreichte ihm das Bündel.
„Ja, das sind sie. Hier, Vater, nimm deinen Sohn.“
Er nahm ihr die dicken Steckkissen ab und sah seinen Sohn an. Der Kleine hatte dunkle Locken und war von der Geburtsanstrengung puterrot. Robert streichelte das winzige Gesichtchen sanft mit dem Zeigefinger und küsste den Kleinen. Das Baby hörte auf zu schreien und schlug die zugekniffenen Äuglein auf, lachte seinen Vater an. Robert sah genauer hin, soweit es der Tränenschleier erlaubte und bemerkte, dass sein Sohn sanfte braune Augen hatte.
Mit dem Kind im Arm setzte er sich an Susans Bett. Sie spürte die leichte Erschütterung und wachte auf.
„Robert!“, flüsterte sie matt. Er beugte sich über sie, küsste sie und strich ihr zärtlich durch das schweißverklebte Haar.
„Ihr habt es geschafft, Schatz. Herzlichen Glückwunsch, Mom“, sagte er. „Wie geht es dir, Liebling?“
„Es war anstrengend, ich bin völlig fertig; aber sonst geht’s mir besser als heute Morgen.“
Robert hob das Steckkissen etwas an, damit Susan ihr Kind sehen konnte.
„Sieh mal – dein Sohn“, lächelte er. Susan versuchte, sein Lächeln zu erwidern.
„Falsch. Unser Sohn“, erwiderte sie schwach.
„Und wie soll euer Sohn heißen?“, erkundigte sich Richard von der Tür.
„Christopher!“, erwiderte Susan zwar matt, aber entschlossen. Ihre Eltern, Tante und Schwiegervater sahen sie verblüfft an.
„Wie kommst du auf den Namen?“, fragte Gwendolyn.
„Es ist Roberts zweiter Name, der mir immer sehr gut gefallen hat. Außerdem hieß Großvater Craig so. Und als zweiten Namen hätte ich gern Lucas“, begründete Susan.
„Christopher Lucas Bennett! Klingt gut. Genauso wird er getauft, mein Schatz“, versprach Robert und küsste seine Frau noch einmal.
„Komm jetzt, Susan sollte jetzt schlafen“, mahnte Gwendolyn ihren Schwiegersohn.
„Ma, Susan ist mir nicht von der Seite gewichen, als es mir schlecht ging. Und ich werde hier nicht weggehen!“, protestierte er.
„Lass nur, Schatz. Das ist schon Frauenarbeit. Geh’ nur. Für dich war’s bestimmt aufregender als für mich.“
Aber Robert ließ sich nicht einfach fortschicken. Gemeinsam mit seiner Schwiegermutter blieb er bei Susan und Klein-Christopher. Vollends verblüfft war Gwendolyn aber, als Robert sie bat, ihm zu zeigen, wie man ein Baby richtig trockenlegt.
„Na schön, ich zeig’s dir“, seufzte Gwendolyn, als Robert nicht locker ließ. „Aber ich garantiere dir, dass das nichts für dich ist, großer Krieger“, warnte sie.
„Wie soll ich das jetzt verstehen?“
„Bobby – Berufssoldaten und Kinderwickeln, das passt nicht zusammen. Ich hab’ meine Erfahrungen.“
Robert lächelte.
„Ma, ich werde mich nicht vor der Verantwortung drücken, indem ich meine Tätigkeit in Sachen Kinder aufs Zeugen beschränke. Ich habe mir oft gewünscht, mein Vater hätte mehr Zeit mit uns Kindern verbracht. Jetzt habe ich die Gelegenheit, es bei meinen Kindern besser zu machen.“
„Lobenswerter Vorsatz, mein Junge. Fast jeder junge Ehemann hat ihn – aber kaum einer erfüllt ihn.“
„Kann sein. Aber deshalb werfe ich nicht von vornherein die Flinte ins Korn.“
In den folgenden Monaten war Christopher eigentlich nur zum Trinken bei seiner Mutter, wenn sein Vater dienstfrei hatte. Sofern er vom Dienst kam und der Kleine nicht gerade schlief, hatte Robert Christopher auch schon auf dem Arm. Susan sah mit Freude, wie ernst es ihrem Mann mit seiner Familie war.
„Robert, versprichst du mir etwas?“
„Und was, mein Liebling?“, erkundigte er sich, als er Christopher in Susans Arme legte, damit das Baby sich der Mutterbrust bedienen konnte.
„Dränge ihn nie, Soldat zu werden.“
„Nein, das werde ich nicht tun“, versprach Robert. „Aber mich hat auch niemand gedrängt. Ich wollte es einfach.“
„Du hast mir einmal gesagt, du hättest eigentlich nichts anderes gekannt, als Soldaten. Christopher wird nicht unter Soldaten aufwachsen, oder?“, fragte Susan besorgt.
„Dazu müssten wir in ein Fort im Westen gehen. Das bedeutet Krieg mit den Indianern – und da spiele ich nicht mit. Insofern besteht kaum die Gefahr, dass Chrissie in einer reinen Militärgesellschaft groß wird. Aber ich werde ihn auch nicht daran hindern, wenn er von sich aus Soldat werden will.“
„Wenn er den Wunsch äußert, wirst du dann ehrlich zu ihm sein oder wirst du auch die heroischen Märchen erzählen, die mein Vater von sich gegeben hat?“
„Wie ehrlich kann man mit einem Abstand von zehn oder fünfzehn Jahren sein, Sue?“, fragte Robert. „Der Mensch neigt dazu, vergangene Dinge durch die rosarote Brille der Vergangenheit zu sehen und manches zu verklären, was dazu eigentlich nicht geeignet ist. Wenn unser Sohn mich heute fragen würde, wie das ist, wenn man Soldat ist und kämpft, dann würde ich ihm heute eine harschere Antwort geben können als in zehn oder fünfzehn Jahren“, räumte Robert ein. „Ich will versuchen, es wie mein Vater zu machen. Er war so ehrlich, dass er mir die Gefahren und Unannehmlichkeiten meines Berufes nicht verschwiegen hat. Sie waren auch zu deutlich sichtbar bei ihm – das kann bei mir kaum anders sein, sollte unser Sohn mich mal im Sommer beim Holzhacken sehen. Meine Narben sind dann recht deutlich sichtbar. Da werde ich wohl nicht von Lagerfeuerromantik schwärmen können, wenn klar ersichtlich ist, dass der Job nicht ganz ungefährlich ist und auch sehr schmerzhaft sein kann. Und solche Leute, wie ich sie als Zug, später als Schwadron hatte, die findet man auf dieser Welt kein zweites Mal. Da brauche ich ihm den Mund nicht wässerig zu machen. Ich versprech’s dir: Ich werde Christopher nicht drängen, Soldat zu werden.“
Fern von Washington, im virginischen Mayboro, lebte Martin Moore ebenfalls in einer nervenanspannenden Situation. Diese beruhte allerdings weniger auf dem freudigen Ereignis einer Geburt als eher auf der wachsenden Ablehnung seiner Nachbarn. Martin hatte nur wenige Stunden nach der Kapitulation der Army of Northern Virginia den Treueid auf die Union geschworen und war von General Sheridan zum US Marshal ernannt worden. Diese Ernennung war ursprünglich zu dem Zweck erfolgt, dass Martin und seine Leute auf dem Boden des Gesetzes Jagd auf Partisanen machen konnten, doch war dieser Grund bald entfallen, weil Robert und seine Männer eben diese Partisanen zu fassen bekommen und vernichtet hatten. Martin war – im Gegensatz zu vielen seiner früheren Untergebenen – Marshal geblieben und war als solcher in Mayboro nun für die Einhaltung der Gesetze verantwortlich. Seine Nachbarn sahen in seiner Tätigkeit für die US-Behörden Verrat an der Sache des Südens, die sie trotz des verlorenen Krieges nicht aufgegeben hatten. Die nachgiebige Haltung Präsident Johnsons, der in den besiegten Südstaaten eher ortsansässige US Marshals installiert hatte, wurde von den hartnäckigen Rebellen als Schwäche des Präsidenten und Kollaboration der als Marshals tätigen Südstaatler interpretiert.
„Martin, was ist mit dir los?“, fragt Cindy besorgt. Martin stellte das Whiskyglas wieder weg, das er sich gerade aus dem Schrank genommen hatte.
„Ach, es ist zum Bäume ausreißen! Es gibt doch wirklich nichts, was mir nicht ins Gegenteil verkehrt wird. Heute hat mir Vater doch wahrhaftig Vorwürfe gemacht, ich wäre ein Stiefelputzer der Yankees! Und weißt du warum?“, wetterte er. Sie schüttelte den Kopf.
„Weil er heute einen Brief vom Innenminister bekommen hat, dass ihm seine Tabakfabrik nicht weggenommen wird. Ich fasse es nicht!“
„Wie kann er sich darüber aufregen?“
„Frag’ mich was Leichteres!“, schnaubte Martin.
„Soll ich mal mit ihm reden?“
„Wenn du meinst, dass es Sinn hat …“, erwiderte er schulterzuckend. „Ich fürchte nur, mein alter Herr leidet schon unter Altersstarrsinn.“
Cindy Moore suchte ihren Schwiegervater auf.
„Paps, ich hab’ gerade gehört, dass du die Fabrik behalten kannst …“, setzte sie an, als Chester Moore auch schon zornrot aus dem Sessel sprang.
„Scher’ dich weg!“, fuhr er Cindy an, die erschrocken in der Tür stehenblieb. „Ich will, verdammt noch mal, keine Almosen von den Yankees!“
„Ich versteh’ nicht ganz. Erklär’ mir bitte, was du meinst.“
„Hier, den Wisch meine ich!“, fluchte Chester Moore. „Da schreibt mir dieser verdammte Blaubauchminister, ich dürfte meine Fabrik behalten! Als ob er das Recht hätte, sie mir wegzunehmen!“
„Freut es dich nicht, dass hier alles beim Alten bleibt?“
„Ich will keine Gnade von den Yankees! Ich will ein freies Virginia mit einer souveränen Regierung! Aber nein, mein Herr Sohn meint, er müsste bei den Yankees betteln gehen und ihnen in den Hintern kriechen! US Marshal! Ha! Biedert sich an! Hat den Süden verraten, der Bandit!“
Cindy seufzte.
„Martin hat schon Recht. Das muss Altersstarrsinn sein“, versetzte sie.
„Raus!“, brüllte Chester Moore sie an. Schulterzuckend verließ sie die Tabakfabrik. Es fiel ihr nicht einmal auf, dass ein paar Arbeiter verfaulte Tabakblätter hinter ihr herwarfen.
„Jetzt habe ich begriffen, was Robert gemeint hat, als er dich warnte, den Marshalstern anzunehmen“, seufzte Cindy, als sie nach Hause kam. Martin zupfte ihr ein halbes Tabakblatt aus der Mantelpelerine.
„Ja, er hatte Recht – und ich wollte es nicht wahrhaben, dass ich in meinem Heimatort als US Marshal keine Chance habe. Ich sehe hier keine Zukunft mehr für uns. Wir sollten fortgehen. Nach Westen, nach Kalifornien oder so“, schlug Martin vor.
„Das ist so fürchterlich weit weg, Darling“, gab Cindy zu bedenken. „Können wir’s nicht erst mal näher dran probieren? Ich meine in Maryland, Delaware oder West-Virginia?“
Martin zuckte mit den Schultern.
„Ich weiß nicht. Ich fürchte, dass ich in den ehemaligen Randstaaten oder im absolut unionsergebenen West-Virginia als Ex-Konföderierter kein Bein an den Boden bekäme. Die westlichen Staaten – Nevada, Oregon oder Kalifornien – wären für einen Neuanfang besser, weil dort die Herkunft keine Rolle spielt.“
Cindy sah ihn eine Weile an. Martin wirkte mutlos und niedergeschlagen. Es war ein Zustand, den sie an ihrem Mann nicht kannte. Selbst in der Endphase des Bürgerkrieges hatte Martin immer noch optimistisch in die Zukunft gesehen, hatte sich auf die Zeit nach dem Krieg gefreut und Pläne gemacht. Aber was der verlorene Krieg gegen die Yankees nicht vermocht hatte, richteten nun Missbilligung und Verachtung seiner Nachbarn an, die in der neuen Zeit nichts Positives sahen – und großenteils wohl auch nicht sehen wollten. Wenn Martin wieder ein normales Leben führen wollte – ob mit polizeilichen Aufgaben betraut oder nicht – dann musste er möglichst weit von Mayboro fort, am besten noch aus Virginia weg, das sah Cindy ein. Sie seufzte.
„Du hast wahrscheinlich Recht“, sagte sie leise und lehnte sich wieder an ihn.
Schon am nächsten Tag zog Martin die ersten Erkundigungen über Nevada ein. Wenn er in seinem Job als US Marshal weiterhin tätig sein wollte, schien ihm das der geeignete Ort. In Nevada wurde Silber gefördert – und wo Edelmetall ist, sind Langfinger und andere Strolche nicht weit. Polizisten konnte man dort gewiss gebrauchen.
Kapitel 2
Geburt einer Ausgeburt
Während Martin schon in regem Briefwechsel mit dem Sheriff von Lyon County stand, zu dessen Revier auch die Minenstadt Silver City gehörte, erfuhr Präsident Johnson in Washington vom Entstehen eines seltsamen Geheimbundes in Tennessee.
In einer eiskalten Dezembernacht des Jahres 1865 waren erstmals Gestalten in fast bodenlangen weißen, mit allerlei geheimnisvollen Zeichen verzierten Gewändern erschienen, die ihre Gesichter mit hohen, spitzen, weißen Kappenmasken tarnten, sich White Knights nannten und Jagd auf Schwarze, Nordstaatler und Scalawags, angebliche Yankee-Kollaborateure, machten. Es war die Geburtsstunde des Ku-Klux-Klans, der es sich zum Ziel gesetzt hatte, für den gedemütigten Süden Rache an Yankees und „Niggern“ zu nehmen. Den Schwarzen sollte gezeigt werden, dass die Weißen nach wie vor die Herren im Hause waren, den Nordstaatlern sollte der Aufenthalt im Süden vergrault werden.
Die Bezeichnung Ku-Klux-Klan beruhte auf dem griechischen Wort kyklos für Kreis, das Wort Klan war zudem eine Anspielung auf die schottisch-irische Herkunft der Gründer, das abweichend von der sonstigen Schreibweise mit „K“ geschrieben wurde, um eine Einheitlichkeit der Buchstabenfolge herzustellen.
Die neuen Regierungen in den Südstaaten sahen das Auftreten des Klans mit gemischten Gefühlen. Einerseits waren sie Südstaatler, traten aber nicht für eine Verselbstständigung der ehemals konföderierten Staaten ein, hatten der Union aus Überzeugung Treue geschworen.
William Brownlow, der Gouverneur von Tennessee, auf dessen Territorium die Klansmen ihr Unwesen begannen, war einerseits für ein militärisches Vorgehen gegen diese Leute, die für ihn schlicht Banditen waren. Dennoch wollte er nicht gleich nach Bundestruppen rufen, sondern die Angelegenheit gleichsam „innersüdstaatlich“ lösen. Brownlow hatte sich wie Johnson während der Sezession der elf Südstaaten immer dafür eingesetzt, dass Tennessee Unionsstaat blieb und war – wie Johnson – auch maßgeblich daran beteiligt, dass Tennessee der erste der abtrünnigen Staaten war, der wieder in die Union aufgenommen wurde. Johnson und Brownlow hatten sich vor der Sezession heftig bekämpft, war Brownlow doch Republikaner und Johnson Demokrat. Unter Brownlows Regierung hatte Tennessee den 14. Zusatzartikel der Verfassung ratifiziert, der die Sklaverei abschaffte und war als Erster der abtrünnigen Staaten am 18. Juli 1866 wieder in die Union aufgenommen worden.
Brownlow fürchtete, das Vertrauen, das Johnson gerade in seinen Heimatstaat gesetzt hatte, könnte beim Einsatz von Bundestruppen gegen die Terroristen Schaden nehmen. So bat er im April 1867 den Attorney General*, der den Präsidenten in Rechtsfragen beriet, um den Einsatz von US Marshals, die tunlichst aus dem Süden sein sollten, nachdem alle polizeilichen Lösungen innerhalb Tennessees nichts gefruchtet hatten.
Henry Stanbery, der Attorney General, erhielt das Schreiben des neuen Gouverneurs von Tennessee mit eben dieser Bitte. Im Grundsatz war Stanbery geneigt, die Forderung zu erfüllen, weil er sich gut vorstellen konnte, dass die Befürchtungen des Gouverneurs durchaus zutreffend sein konnten. Für die Erfüllung dieser Aufgabe genügten aber nicht nur einige wenige Männer. Es brauchte – so die Kalkulation des Gouverneurs – wenigstens hundert Männer. Vorschläge dazu, wer in diesen Job berufen werden sollte, machte der Gouverneur allerdings nicht. Der Attorney General selbst kannte nicht sehr viele noch im Dienst befindliche US Marshals aus Tennessee oder einem anderen Südstaat, mochte er auch deren Dienstherr sein. Sämtliche ehemaligen Bundesbeamten und Soldaten der Bundestruppen, die direkt aus dem Bundesdienst in den der konföderierten Staaten gewechselt hatten, blieben von neuen Beamtenposten ausgeschlossen. Die Anfrage des Attorney General bei der zuständigen Abteilung seiner Behörde ergab, dass es sicher einige Zeit dauern werde, bis man die entsprechenden Listen gesichtet habe – so etwa einen Monat.
Stanbery wollte den Gouverneur nicht derart lange warten lassen und ließ sich beim Präsidenten melden. Johnson war aus Tennessee; vielleicht kannte er noch mehr im Dienst befindliche US Marshals aus diesem Staat. Der Präsident besprach sich gerade mit seinem Adjutanten, als Henry Stanbery eintrat.
„Guten Morgen, Mr. President“, grüßte er.
„Guten Morgen, Mr. Stanbery“, erwiderten Präsident und Adjutant den Gruß.
„Mr. President, ich habe gerade einen Brief vom Gouverneur des Staates Tennessee erhalten. In Tennessee ist eine Art Geheimbund aufgetaucht, der sich Ku-Klux-Klan nennt, der es sich offensichtlich zum Ziel gesetzt hat, Schwarze und Nordstaatler zu vertreiben. Nach seinen Informationen hüllen diese Burschen sich in weiße Kapuzengewänder, damit man sie nicht erkennt. Es hat schon diverse Tote gegeben, die örtlichen Polizeien kommen mit dem Problem nicht zurande – wobei der Gouverneur durchaus auch den Verdacht hat, dass mancher Polizist mit denen unter einer Decke steckt. Er sieht sich veranlasst, gegen das Problem etwas zu unternehmen, da es auch die neuen staatlichen Ordnungen in den ehemaligen konföderierten Staaten bedroht. Er bittet mich um Hilfe.“
„Dann sollten wir am besten Bundestruppen schicken“, empfahl Robert vorlaut. Der Attorney General schüttelte den Kopf.
„Genau das will der Gouverneur auf keinen Fall. Tennessee ist der erste Staat, der wieder Unionsstaat geworden ist. Wenn jetzt aber diese Banditen den Ruf des Staates schädigen, könnte die Bundesregierung das wieder rückgängig machen – so die Sorge des Gouverneurs. Der Gouverneur befürchtet dasselbe, wenn Bundestruppen die Ordnung wiederherstellen müssen. Er möchte deshalb keine Bundestruppen einsetzen, sondern hätte gern eine schlagkräftige Truppe von US Marshals, möchte aber welche aus dem Süden haben, die als unionstreu zu bezeichnen sind. Und mit einem oder zweien wird er kaum auskommen, fürchtet er. Diese Einschätzung teile ich. Nun, Mr. President, ich kenne leider kaum jemanden aus dem Staat Tennessee, der heute US Marshal ist, und meine Mitarbeiter werden sehr lange brauchen, bis sie die Listen durchforstet haben. Wissen Sie vielleicht von solchen Leuten oder von sonst jemandem, die solche kennen könnten?“
„Mr. Stanbery, sicher kenne ich einige Leute aus Tennessee, die US Marshals sind. Aber wäre es wirklich angebracht, ausgerechnet Männer aus Tennessee mit so einer Aufgabe zu betrauen? Wäre es nicht besser, jemanden von außerhalb zu beauftragen?“, fragte Johnson. „Das Problem ist nur: Außerhalb von Tennessee ist mir kein aktiver US Marshal bekannt, der aus dem Süden ist“, setzte er dann hinzu.
Sein Blick fiel auf seinen jungen Adjutanten, der offensichtlich angestrengt nachdachte.
„Wissen Sie jemanden, Major Bennett?“
„Nun, wenn der Gouverneur Männer aus dem Süden haben will, weil es einfach eine Tatsache ist, dass Südstaatler zur Bockigkeit neigen, sofern sie feststellen, dass ihr Gegenüber aus dem Norden ist, wüsste ich etwa hundert Mann“, sagte Robert. Attorney General und Präsident sahen ihn verblüfft an.
„Und wen, bitte?“, erkundigte sich Johnson.
„Die B-Schwadron der 9th Virginia Cavalry. Der ganze Haufen ist auf die Union eingeschworen und zu US Marshals ernannt worden. Ursprünglich geschah das mal zu dem Zweck, Partisanen zu jagen, die das Kriegsende nicht akzeptieren wollten, was dann nicht mehr erforderlich war. Was ich nur nicht weiß, ist, ob die Männer noch alle in Virginia sind oder ob sie inzwischen über die gesamten Staaten verteilt sind.“
„Konföderierte?“
„Ja, Sir. Bis zum letzten Schuss des Krieges. Aber sie haben den Treueid geleistet und wurden in den Bundesdienst übernommen.“
„Mr. Bennett, das geht nicht gut, fürchte ich. Gegen Partisanen zu kämpfen, die auch die eigenen Frauen und Kinder angegriffen haben, ist sicher etwas anderes, als Leuten Feuer unter dem Allerwertesten zu machen, die im Prinzip die eigenen Ziele nach wie vor vertreten – und die ausschließlich gegen Neger* und Yankees vorgehen“, warnte der Präsident.
„Nun, Sir, auch im Norden sind üble Rassisten zu Hause. Es wäre also nicht zwangsläufig passend, jemanden aus dem Norden dorthin zu entsenden. Captain Moore und seinen Leuten würde ich vertrauen. Ich habe schon mit ihnen gearbeitet.“
„Auch, wenn es um Schwarze ging?“, hakte Johnson nach.
„Nein“, musste Robert zugeben. „Dennoch glaube ich nicht, dass sie sich einem präsidialen Auftrag widersetzen würden, der ihnen befiehlt, Schwarze vor diesen Irren zu schützen.“
„Haben Sie Kontakt zu den Leuten?“, fragte der Minister.
„Ich habe Captain Moores Adresse.“
„Schreiben Sie an Captain Moore, ob er und seine Leute bereit wären, diese Aufgabe zu übernehmen. Wenn es sich um ehemalige Konföderierte handelt, sollten sie das freiwillig und nicht auf Befehl tun. Nur dann wäre ich mir sicher, dass sie einen wirksamen Schutz für Nordstaatler und Neger darstellen“, wies Johnson seinen Adjutanten an. „Und … wenn sie das tun, dann sollten Sie ihnen ein wenig auf die Finger schauen, Major.“
„Ja, Sir“, bestätigte Robert. Noch am selben Tag schrieb er an Martin.
An Martin Moores Haustür klopfte es. Martin öffnete. Der Postbote stand davor.
„Post für dich, Scalawag*!“, giftete der Mann. „Hätte ich nicht gebracht, aber ich hoffe, es ist ein Brief aus der Hölle mit dem Teufel persönlich drin!“
Er warf Martin den Brief vor die Füße. Das war zu viel für den duldsamen Martin. Er griff sich den Postboten und verpasste ihm rechts und links Ohrfeigen.
„Das nur für die saufreche Begrüßung, Sam Holbrook!“, fauchte er ihn an. „Wenn ich geahnt hätte, wie du mir neuerdings die Post bringst, dann hätte ich es mir verkniffen, dich zwei Monate vor Kriegsende aus dem Sumpf zu ziehen, du undankbarer Sack!“
„Heute würde ich lieber verrecken, als mich von einem Scalawag retten zu lassen!“, zischte Holbrook.
„Und mir das dann auch noch anhängen wollen, ja? Geh’ mir aus den Augen, bevor ich dir den Hals umdrehe. Und verbreite im Dorf, dass es mir jetzt langt. Wir gehen weg, wenn’s sein muss, bis nach Europa! Ihr seid nicht mehr die, für die ich vier Jahre lang mein Leben riskiert habe!“
„Schätze, es wird ein Freudenfest im Dorf geben, wenn ihr Yankeebrut endlich weg seid!“
Martin packte mit der Linken noch einmal fester zu, holte mit der Rechten aus und boxte Sam mit aller Gewalt und Wut in den Unterleib. Sam krümmte sich und bekam gleich noch einen Pferdekuss auf die Nase, die prompt brach. Aufjaulend und blutüberströmt stolperte der Postbote die kleine Freitreppe vor Moores Haus hinunter, als Martin ihn umdrehte und ihm noch einen herzhaften Fußtritt in den Hintern versetzte.
„Wenn du es je wieder wagen solltest, mich einen Yankee zu nennen, reiße ich dir die Därme ‘raus! Im Gegensatz zu dir habe ich bis zum allerletzten Schuss meinen Kopf für die Konföderation hingehalten und bin nicht wie du getürmt, du feiger Hund! Du bist desertiert, du Lump! Leider gab es keine Einheitsführung mehr, die bereit gewesen wäre, dir dafür die passende Strafe zu geben. Verschwinde endlich von meinem Hof!“
Sam rappelte sich mühsam auf. Vor Tränen konnte er nicht mehr richtig sehen, der Schmerz in seiner Nase und in seinen Innereien war zu stark, um Martin noch einmal anzugreifen.
Moore schlug die Tür so heftig zu, dass einige Putzbrocken aus der Füllung fielen. Zornbebend stapfte er ins Wohnzimmer und riss das Kuvert auf. Innerlich seufzte er, als er die Handschrift Robert Bennetts erkannte. Wenigstens einer, der ihn nicht zwischen alle Stühle setzte. Martin setzte sich an seinen Sekretär und las das Schreiben seines Freundes mit immer größerem Interesse. Robert bot ihm an, auf den Geheimbund des Ku-Klux-Klans Jagd zu machen. Martins Wut auf die Unverbesserlichen im Süden war so groß, dass er keinen Augenblick zögerte, dieses Angebot anzunehmen.
„Geschenk des Himmels!“, fuhr er frohlockend von seinem Schreibsessel auf. „Cindy! Bobby hat meine Umzugsgedanken erraten und bietet mir einen Job an! Wir packen sofort unseren Krempel zusammen und fahren nach Washington!“
Sam Holbrook war blutend nach Hause gewankt, hatte völlig vergessen, seine restliche Post auszutragen.
„Ich mach’ den Kerl fertig! Ich werde ihm sämtliche Knochen brechen! Ich hänge ihn an seinen Därmen an den nächsten Baum!“, fluchte er auf dem Weg laut. Es fanden sich Leute, die ihm zuhörten, die sich an seiner Rache beteiligen wollten – nahezu die gesamte männliche Einwohnerschaft von Mayboro. Da alle ins Dorf hineinströmten, um Sam Holbrooks Gejammer zu bestätigen, bemerkte niemand in Mayboro, dass Familie Martin Moore und der ihnen treu ergebene Diener George ihre Siebensachen in zwei Wagen packten und zum Bahnhof Winchester davonfuhr. Die Moores nahmen nur das Nötigste mit, wollten den Rest ihrer Möbel später nachkommen lassen, wenn klar war, wo sie ihr endgültiges Domizil aufschlagen wollten. Aber als der zweite Wagen um die letzte Ecke bog, packte Cindy das dunkle Gefühl, dass sie von dem zurückgebliebenen Mobiliar nicht mehr viel sehen würde …
Wie Recht sie mit dem ungewissen Gefühl hatte, merkte sie etwa eine Stunde später, als der Zug Winchester verließ und in Richtung Baltimore fuhr. Über Mayboro, an dessen Ortsrand ihr Haus stand, lag eine tiefschwarze Qualmwolke. Mit blankem Entsetzen in den Augen stieß sie Martin an und zeigte wortlos auf die Rauchwolke. Martin sah sie und nickte mit grenzenloser Enttäuschung im Gesicht. Beide ahnten, dass dort ihr Haus und der Rest ihrer Habe in Flammen stand, angezündet von den Bewohnern Mayboros, vermutlich angeführt von Sam Holbrook oder gar Chester Moore persönlich.
„Und für diese Menschen habe ich gekämpft? Für die wollte ich die Unabhängigkeit erstreiten? Dafür habe ich mit einem so guten Freund wie Robert auf Leben und Tod gefochten? Cindy, ich muss bekloppt gewesen sein!“
„Du hast es nicht ahnen können, Martin“, erwiderte sie. Sie legte ihre Hand beruhigend auf seinen Arm, brach dann aber selbst in Tränen aus.
„Warum tun die das?“, schluchzte sie.
„Weil sie dümmer sind als Bohnenstroh und mindestens so gemeingefährlich wie Yancey Morrows. Aber ein Gutes hat es: Wir sind jetzt wirklich frei zu gehen, wohin immer wir wollen. Wir werden einen Platz für uns und unsere Kinder finden, wo wir leben können, ohne dass man mir die jüngere Vergangenheit zum Vorwurf macht. Und mit der Konföderation bin ich restlos fertig!“, grollte Martin.
Wenn dir diese Leseprobe gefallen hat, findest du das ganze Buch mit 172 Seiten hier:
Bodyguards gegen den Klan im Tredition Shop
Taschenbuch 12,00 €
Gebundenes Buch 19,00€
E-Buch 2,99 €
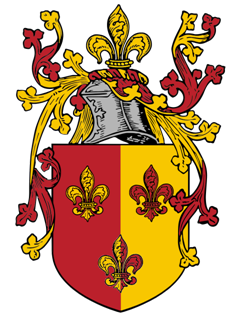

Schreibe einen Kommentar