Vorbemerkung
Am 15. April 2012 jährte sich zum 100. Mal der Untergang der Titanic. Welches Programm man im Fernsehen auch anzappte: Titanic allerorts.
Als jemand, der an Geschichte mehr als nur interessiert ist, konnte ich es mir nicht verkneifen, die zahlreichen Dokumentationen zu verfolgen. Das ZDF lieferte gleich noch eine zweiteilige Spielversion vom Untergang dieses Synonyms für fehlgeschlagene Technikgläubigkeit der Spezies homo sapiens.
Aber … wenn es um eine Spielfilmversion des Untergangs der Titanic geht, gibt es für mich nur eine Version: Den 1997 von James Cameron veröffentlichten, seinerzeit und für lange Zeit erfolgreichsten Film der Filmgeschichte, ausgezeichnet mit 11 Oscars, eben
TITANIC.
Kate Winslet und Leonardo DiCaprio kannte davor kein Mensch, inzwischen sind beide etablierte Hollywoodstars, die für andere Rollen nach TITANIC auch schon selbst den Academy Award, wie der Oscar eigentlich heißt, für ihre Schauspielkunst erhalten haben.
Folgerichtig habe ich historisch passend diesen Film am Abend des 14. April 2012 gesehen. Und dann fiel mir ein, dass ich mich schon damals, als der Film 1997 im Kino lief, in Grund und Boden geärgert habe, dass es dazu keinen Roman gab. Es gibt ein Making-of-Buch von James Cameron, aber keinen Film-Roman.
Da ich die DVD besitze und das Drehbuch von James Cameron kostenfrei im Internet erhältlich ist, habe ich mich also daran gemacht, das zu liefern, was Leseratten noch fehlt: den Roman zum Film.
Ich verwende die Originaldialoge der deutschen Synchronisation, gelegentlich ergänzt durch übersetzte Dialoge entfallener Szenen aus dem Drehbuch. Einen Teil der Beschreibungen verwende ich analog zum Drehbuch, einiges aus meiner eigenen Anschauung und Interpretation. Außer den in der Kinofassung veröffentlichten Szenen übernehme ich aus dem Drehbuch auch die unveröffentlichten Szenen. Manche davon geben einen tieferen Einblick in die Charaktere, manche enthalten Erklärungen für Anspielungen, die in anderen Szenen gemacht werden, und die erst durch die Vervollständigung den richtigen Platz im Mosaik erhalten.
Alles in allem hoffe ich, dass es mir gelungen ist, den Film so wiederzugeben, dass es als Roman zum Film passend erscheint und dass es auf Interesse trifft.
Viel Lesevergnügen wünscht
Eure Gundula
♦♦♦
Teil 1 – Schatzsucher
Prolog
Davy Jones’ Locker – so nennen Seeleute des englischen Sprachraums den Meeresboden; den Teil dieser Welt, der uns fremder ist als die Rückseite des Mondes; den Teil dieser Welt, der nicht mehr hergibt, was einmal in ihn hineingefallen ist.
Es ist dunkel auf dem Meeresgrund – dunkel und sehr, sehr kalt; je tiefer, desto dunkler und kälter. Je tiefer, desto höher der Druck.
In der Tiefe, in der der ganze Stolz der britischen Reederei White Star Line am 15. April 1912 ihr Ende, aber keineswegs ihre Ruhe fand, ist er so hoch, dass nur sehr spezielle Fahrzeuge hier hin tauchen können und unbeschadet wieder die Oberfläche des Nordatlantiks erreichen können.
Kapitel 1
Geisterschiff
Tiefe Schwärze umfing das gewaltige Wrack, das seit vierundachtzig Jahren hier in den Tiefen des Nordatlantiks ruhte. Dreiundsiebzig Jahre davon waren nur Fische, Wale, Tiefseekrabben und die Geister derer hier vorbeigekommen, die in jener ebenso stillen wie eisigen Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 am und im Wrack des größten Schiffes seiner Zeit gestorben waren. Ab und zu schaute vielleicht auch Davy Jones hier nach, ob er noch jemanden an Bord vergessen hatte oder war Gast auf der ständigen Party der Geister. Der Geister der Titanic.
Zwei dicht beieinander liegende Lichter durchbrachen die ewige Dunkelheit, die erstmals elf Jahre zuvor von den Lichtern eines unbemannten Tauchbootes gestört worden war. Seither kamen diese Lichter immer wieder und störten die Geister der Titanic. Jetzt waren es sogar vier. Sie gehörten zu den Tiefseetauchbooten Mir 1 und Mir 2, die – anders als der Tauchroboter elf Jahre zuvor – selbstständig operieren konnten und nicht an elend langen Leitungen hingen. Die beiden Tauchboote kamen von ihrem Mutterschiff, der Akademik Mstislav Keldysh, einem Forschungsschiff der Russischen Föderation, das aus Kostengründen auch schon mal an Leute vermietet wurde, deren Absichten nicht allein der Forschung und der Lehre dienten, sondern auch dem Profit.
Brock Lovett, der in Mir 1 auf dem Weg zum Meeresgrund war, gehörte in diese Kategorie. Er war jetzt knapp über vierzig, war tief gebräunt, das dunkelblonde, leicht lockige Haar gehörte in seiner ungekämmten Wildheit zweifellos zu einem Abenteurer, ebenso wie der stoppelige Drei-Tage-Bart und der goldene Ohrring im linken Ohrläppchen. Zum Abenteurer passte auch der Umstand, dass er den Overall grundsätzlich bis weit auf die Brust offen ließ, auch wenn es in knapp viertausend Meter Tiefe auch im Tauchboot kalt genug war, um Bier frisch zu halten. Er war eine kühne Mischung aus Abenteurer, Historiker und auch redegewandter Verkäufer, wenn es darum ging, Geld für eine solche Expedition wie diese zusammenzukratzen. Auf der ebenfalls sonnengebräunten Brust leuchtete eine Goldkette, die bewies, dass Lovett mit seinen Unternehmungen durchaus Erfolg hatte. Er hatte einen Riecher für Schätze – und hier witterte er das ganz große Geschäft.
Anatoly Michailawitsch, einer der russischen Tauchexperten der Keldysh, steuerte die Mir 1, während Lovett den gut zweistündigen Abstieg verschlief. Der dritte Mann in der gerade mal zwei Meter langen Tauchkapsel war Lewis Bodine, ein bärtiger Mann mit beträchtlichem Leibesumfang. Bodine galt als einer der Experten für die Titanic. Er kannte sie so intensiv, dass er darauf zu wohnen schien – im Geiste jedenfalls. Dazu war er Steuermann des R.O.V., des remotely operated vehicle, des ferngesteuerten Roboters, mit dem Wracks wie dieses näher untersucht werden konnten, wo ein Taucher im Neoprenanzug keine Chance dazu hatte. Auch Bodine lehnte schlafend an der Seite des Tauchboots.
Im Scheinwerferlicht der Mir 1 wechselte das Schwarz der Tiefsee zu dunklem Blau der Umgebung, dann erschien eine fahle Mondlandschaft, als das Boot den Meeresgrund erreichte und mit einem unüberhörbaren Rumms aufsetzte. Die schlafenden Passagiere wurden durch den Ruck des Aufpralls unsanft geweckt.
„Wir sind da“, meldete Michailawitsch. Er sprach englisch mit starkem russischem Akzent.
Wenige Minuten später waren die Passagiere beider Tauchboote so weit wach, dass sie die Instrumente beobachten konnten. In Mir 1 war Bodine dafür zuständig. Er sah konzentriert auf die Anzeige des Seitensonars. Im Licht der Scheinwerfer präsentierte sich immer noch der konturlose, graue Lehmboden des Meeresgrundes, während Lewis schon die Umrisse eines riesigen, spitzen Objektes auf seiner Anzeige hatte. Anatoly lag auf dem Bauch, die Nase fast an das zentrale Bullauge gepresst, um zu sehen, wohin er steuerte.
„‘N bisschen mehr nach links!“, wies Bodine Michailawitsch an. „Sie ist direkt vor uns. Achtzehn Meter. Fünfzehn, dreizehn. Ihr müsstet sie jetzt sehen.“
„Kannst du es sehen? Ich nicht“, sagte Anatoly, um gleich darauf einen Schemen wahrzunehmen. „Da ist es!“, rief er.
Aus der Dunkelheit schälte sich eine geisterhafte Erscheinung – der Bug* eines Schiffes wurde sichtbar. Das messerscharfe Vorschiff schien den Meeresboden wie die Wellen des Ozeans selbst zu durchpflügen. Wie ein Turm stand es dort, so, wie es vierundachtzig Jahre zuvor dort im Wortsinne gelandet war.
Die Titanic – oder das, was von ihr übrig war.
„Okay. Zieh sie hoch und geh über die Bugreling!“, wies Lovett den Piloten an. „Okay, Mir 2. Wir gehen über den Bug. Bleibt an uns dran!“, wandte er sich über Funk an das zweite Tauchboot.
„Wir sind links von euch!“, meldete der Pilot der Mir 2.
Mir 1 schwebte hinauf, schwang sich über die Bugreling. Abgesehen von Rostfahnen, die sie wie zu Eisenbärten mutiertem Spanischem Moos dekorativ überwucherten, war sie unbeschädigt.
Lovett hatte den Camcorder ausgepackt und filmte sich im Moment selbst. Sein Gesicht füllte den Schwarz-weiß-Monitor komplett aus, wie Bodine beobachten konnte.
„Es berührt mich immer wieder“, sagte er. Währenddessen schwenkte das Bild zur Seite, über Anatolys Schulter hinaus durch das Frontfenster. Der Russe drehte sich um.
„Das sind deine Schuldgefühle, weil du von den Toten stiehlst.“
Anatoly konnte sich die bissige Bemerkung nicht verkneifen. Er kannte Lovett und seine tatsächlichen Absichten.
„Danke, Tolya. Arbeite jetzt hier mit mir“, versetzte Brock. Es gelang ihm, das ernsthafte Gesicht wieder aufzusetzen und nachdenklich hinauszusehen, als er die Kamera wieder in seine eigene Richtung drehte, sie auf Armlänge von sich weghielt und sich filmte.
„Okay, wir drehen!“, warnte er die beiden anderen vor weiteren unqualifizierten Bemerkungen.
„Es packt mich immer wieder aufs Neue, wenn sie wie ein Geisterschiff aus der Dunkelheit auftaucht. Wir sehen vor uns das traurige Wrack dieses großen Schiffes, das am 15. April 1912 um zwei Uhr dreißig morgens nach seinem langen Fall aus der Welt über uns hier liegen geblieben ist“, kommentierte Lovett die Aufnahme. Anatoly verdrehte die Augen.
„Du redest vielleicht ‘ne Scheiße, Boss!“, kicherte Lewis und hielt sich fest, um nicht vor Lachen umzufallen. Zu seinem Glück hatte Brock die Kamera gerade kurz ausgeschaltet.
Mir 2 fuhr inzwischen achtern* von der Mir 1 an der Steuerbordseite* herunter, vorbei an einem riesigen Anker, während Mir 1 über das schier endlose Backdeck* schwebte, vorbei an den massiven Ankerketten, die immer noch in zwei akkuraten Linien lagen, die bronzenen Köpfe der Ankerspills schimmerten im Licht der Scheinwerfer. Die gut sechseinhalb Meter langen Tauchboote wirkten wie weiße Käfer neben dem gewaltigen Wrack.
„Sechster Tauchgang“, fuhr Lovett mit seinem Videokommentar fort, „wir sind wieder auf dem Deck der Titanic … zweieinhalb Meilen tief, dreitausendachthundert einundzwanzig Meter. Der Druck beträgt hier dreieinhalb Tonnen pro Quadratzoll. Diese Scheiben haben eine Stärke von neun Zoll. Sollten sie nachlassen, heißt das in zwei Millisekunden Sayonara.“
Er schaltete die Kamera aus.
„In Ordnung, genug von dem Blödsinn“, brummte er. Das Video, das er aufnahm, sollte der Dokumentation dienen – der offiziellen Dokumentation der ordnungsgemäßen Forschung … Aber selbst Indiana Jones, Hollywoods beliebtester fiktiver Professor der Archäologie, ließ gelegentlich etwas mitgehen … Echte Schatzsucher waren da, bei Gott, keine größeren Unschuldsengel, als ihr filmisches Vorbild. Mir 2 landete auf dem Bootsdeck.
„Setz sie wieder auf das Dach der Offizierskabinen, wie gestern!“, wies Lovett Anatoly an und zog sich einen Pullover über, weil es ihm nun doch zu kalt wurde. Der Russe brachte das Tauchboot einigermaßen sanft auf dem Fleck herunter, den Brock ihm genannt hatte.
„Okay, Mir 2, wir landen jetzt direkt über der großen Freitreppe. Seid Ihr soweit, den Roboter auszusetzen?“, fragte Brock.
„Wir sind bereit. Wir setzen den Roboter jetzt aus“, bestätigte Roger, Missionschef der Mir 2. „Los, Charlie!“
Charlie, in Mir 2 mit den gleichen Aufgaben betraut wie Lewis Bodine in Mir 1, setzte sich ebenso wie der Kollege im Nachbarboot die elektronische 3-D-Brille auf und nahm das Paneel mit dem Joystick für die Steuerung des Roboters. Der Roboter löste sich aus der Halterung und schwebte vorwärts, mit dem Tauchboot durch gebündelte Kabel wie mit einer Nabelschnur verbunden, die vom Boot aus verlängert werden konnten.
„Okay, gut!“, bestätigte Charlie. „Mehr Leine! Leine geben!“
„Brock!“, rief der Missionschef das andere Boot. „Wir lassen ihn am Rumpf entlang sinken.“
„Okay, Roger!“, bestätigte Lovett den Empfang der Meldung. Im Funkverkehr genügte im englischen Sprachraum normalerweise der Begriff Roger. Brocks Entgegennahme der Meldung der Mir 2 klang deshalb für englischsprachige Ohren doppelt gemoppelt, machte aber deutlich, dass er den Captain der Mir 2 mit Namen angesprochen hatte. „Geht runter und dann durch die Gangwaypforte der Ersten Klasse. Ihr übernehmt die Eingangshalle und den Salon auf dem D-Deck!“
„Verstanden!“
Charlie ließ den Roboter nach unten sinken, bis die Gangway-pforte erreicht war. Während die Crew der Mir 2 den Roboter durch die ehemals doppelflügelige Eingangspforte steuerte, bewaffnete sich auch Bodine mit Steuerpaneel und 3D-Brille, startete den Roboter der Mir 1.
„Noch mehr Leine!“, sagte Charlie.
„Geht klar“, erwiderte Roger und ließ mehr Kabel laufen. „So, jetzt nach links“, wies er den Robotsteuermann an. „Links, links, links!“, kommandierte er, als der Roboter dem immer noch stehenden rechten Türflügel bedrohlich nahe kam.
„Schwenke nach links“, erwiderte Charlie, hielt mehr nach links und kam knapp um das modrige Holzteil herum.
„Gut so“, kommentierte der Captain der Mir 2.
Lewis klinkte den Roboter der Mir 1 aus und ließ ihn abwärts schweben.
„Snoop Dog ist unterwegs“, verkündete er.
„Wir gehen den Treppenschacht runter“, funkte Brock an das Nachbarboot. „Okay, Lewis, geh runter aufs B-Deck“, sagte er zu Bodine, als er die Funktaste losgelassen hatte und das oberste Deck im Scheinwerferlicht der Kamera erkannte. „Das ist das A-Deck.“
„Gib mir ‘n bisschen Leine, Captain“, erwiderte der Robotoperator. Lovett ließ mehr Kabel nach und Snoop Dog ging tiefer zum nächsten Deck.
„B-Deck“, erkannte Brock und wies auf die Tür, die im Scheinwerferlicht sichtbar wurde. „Geh da rein! Geh da rein!“, wies er Bodine an.
„Gut“
Lewis steuerte den Roboter unter den wie erstarrtes Seegras oder Stalaktiten aus Rost wirkenden Vorhang, der von der Unterseite des A-Decks herab wuchs. Auf dem B-Deck, dem Promenadendeck, hatten sich die richtig teuren Suiten befunden, die aus mehreren Räumen bestanden und sogar ein eigenes Flanierdeck hatten. Hinter dem Flanierdeck waren die ovalen Ausschnitte, in denen einst Glasfenster gewesen waren. Im Scheinwerferlicht zeichnete sich ein vollständig erhaltener Kronleuchter ab, der noch immer an der Stelle hing, an der er am Ausrüstungskai in Belfast montiert worden war. Trotz der Ablagerungen, die sich in vierundachtzig Jahren auf den Kristallfassetten abgesetzt hatten, erstrahlten die Glasteile für einen Augenblick wie polierte Diamanten.
Auf dem Promenadendeck hatte sich im Lauf der Jahrzehnte Sand abgelagert – bei der harten Landung des stählernen Riesen war mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Menge Sediment aufgewirbelt worden, das sich nach und nach über das ganze Schiff verteilt hatte. Halb im Sand vergraben tauchte im Licht der Scheinwerfer ein Schnürstiefel auf, wie ihn die Damen der feinen Gesellschaft am Beginn dieses Jahrhunderts getragen hatten. Im Treffpunkt der Nähte hatte sich erst vor kurzem Seetang angesiedelt, dessen erstes Blatt wie eine dekorative Feder in der leichten Strömung wedelte. Nur eine Handbreit oberhalb des Schaftendes lag eine Brille, die nur noch aus dem Drahtgestell und dem linken Glas bestand. Hinter der Brille war ein rechteckiger Gegenstand in den Schlamm eingesunken, der im vorübergleitenden Licht nicht sofort zu erkennen war. Es konnte ein Buch sein, aber ebenso gut ein Kästchen.
Noch etwas weiter schälte sich etwas aus der Dunkelheit, das einem unvorbereiteten Beobachter das Blut in den Adern gefrieren lassen konnte: Ein Schädel! Ein kleiner Schädel – etwa ein Kinderschädel? Bei näherem Hinsehen war der Schädel als Kopf einer Porzellanpuppe zu erkennen. Die organischen Bestandteile der Puppe, das Haar, die Holzwolle der Füllung, die Stoffe und das Leder, aus denen die Kleidung und die Schuhe gefertigt gewesen waren, waren im Lauf der Jahrzehnte in der Nahrungskette verwertet worden.
Wahre Forscher hätten diese Gegenstände auf der Stelle verweilen lassen, um sie näher zu untersuchen, vielleicht für ein Museum zu bergen – doch weder Brock noch Lewis waren wirklich Forscher. Sie waren Schatzgräber – und die Gerüchte, dass mit der Titanic ungeheure Reichtümer in Davy Jones’ Locker geraten waren, wollten nicht verstummen. Zu viele Superreiche waren auf diesem Schiff gereist …
Lovett hatte einen Riecher für Schätze, Bodine wusste über die Titanic so gut wie alles, was für Lovett wissenswert war. Snoop Dog, der Tauchroboter, war auf einem Weg zu einem solchen wissenswerten Ziel, der Suite B-52. Die im Schlamm der Zeit versunkenen profanen Gegenstände wie Stiefel, Brillen oder Puppen interessierten beide weniger als die Kochrezepte des Smutjes* auf der Keldysh …
Snoop Dog schwebte weiter wie eine Forschungssonde auf einem fremden Planeten über das Flanierdeck bis zu einer Tür. Im Licht erschien der Türrahmen. Lovett schien es, als würde der Roboter den Türrahmen mitnehmen.
„Pass auf den Türrahmen auf! Pass auf den Türrahmen auf!“, warnte Brock hektisch. „Vorsicht! Vorsicht!“, mahnte er. Die Frage war, um was er sich mehr Sorgen machte: um den Türrahmen oder um den Roboter? Die Wahrscheinlichkeit, dass es Letzteres war, war groß …
„Ich seh’ ihn ja! Ich seh’ ihn ja!“, beschwichtigte Lewis seinen aufgeregten Boss. Aber Brock zuzuhören und gleichzeitig ein Ausweichmanöver zu steuern, hatte Tücken. Snoop Dog rammte mit der rechten Seite prompt den Rahmen.
„Tiefer! Tiefer!“, befahl Lovett. Die zunehmende Aufregung in seiner Stimme war unüberhörbar. Offensichtlich hatte ihn das Jagdfieber gepackt. Bodine steuerte den Roboter weiter nach unten, worauf Lovett noch nervöser wurde.
„Bleib vom Boden weg. Wühl’ ihn nicht wieder so auf wie gestern!“
„Ich versuch’s, Boss!“, erwiderte Lewis. Am Tag zuvor hatte die Schraube von Snoop Dog die Sedimente so heftig aufgewühlt, dass da drin nur noch Nebel gewesen war …
„Läuft alles bestens! Ganz ruhig, Boss!“, beruhigte der Steuermann Brock und lenkte wieder vorwärts. Die Scheinwerfer beleuchteten eine geborstene Tür. Bei der Weiterfahrt schob sich die runde Platte eines zusammengebrochenen Beistelltisches ins Licht. Bodine hob den Roboter etwas höher, um nicht auf der Tür aufzusetzen und nicht wieder in einer Nebelwand zu landen. Ein Kamin wurde sichtbar, davor schlängelte sich ein Tiefseefisch eilig aus dem Licht. Lewis fuhr näher heran und weiter hinauf. Die Reste eines zerbrochenen Spiegels warfen das Scheinwerferlicht zurück.
„Das ist der Wohnraum B-52“, meldete Bodine.
„Gut so! Gut so!“, entfuhr es Lovett. „Und jetzt dreh’ dich! Dreh’ dich!“
„Bin dabei! Bin dabei, Captain!“
Snoop Dog war schon ziemlich nahe am Kamin und hatte einen gewissen Bremsweg, das wussten sie beide. Bodine bremste den Roboter und drehte ihn gleichzeitig nach links. Dennoch kam der Roboter dem Kamin mit den außerordentlich gut erhaltenen Messingbeschlägen bedrohlich nahe.
„Pass auf die Wand auf!“, warnte Lovett. Bodine antwortete nicht, sondern konzentrierte sich darauf, Snoop Dog nicht im Wortsinne an die Wand zu fahren. Die Kamera schwenkte nach unten und zeigte eine Krabbe, ein Albino, wie viele Tiere der Tiefsee. Sie krabbelte in Richtung des Schamottebodens, auf dem in den vier Tagen bis zum Untergang mit einiger Sicherheit ein Feuer gebrannt hatte.
Das Funkgerät knackte.
„Ja, ähm, Brock! Wir sind jetzt am Flügel!“, meldete Roger.
„Hab’ verstanden!“, funkte Brock zurück. Er warf einen kurzen Blick auf das Bild das die Kamera des Mir 2-Roboters lieferte. Der Tauchroboter, den Charlie steuerte, schwebte auf den Flügel zu, der auf den ersten Blick erstaunlich gut erhalten schien. Erst im Weiterflug war erkennbar, dass das Instrument während des Untergangs gegen die Wand gekracht sein musste. Eine Seite war schwer beschädigt. Doch die Tasten schimmerten immer noch in Elfenbein und Schwarz, obenauf lagen noch immer Noten, ganz so, als würde der Pianist gleich zurückkehren, um ein neues Stück zu spielen. Dann kehrte Brocks Aufmerksamkeit wieder zu Snoop Dogs Bildern zurück. Die Richtung stimmte.
„So ist’s gut“, lobte er Lewis’ Steuerkunst. „Weiter, weiter! Okay, das ist es. Das ist sie!“, erkannte er mit erneut erwachender Aufregung. „Das ist die Tür zum Schlafzimmer!“
Bodine zeigte ein gieriges Grinsen.
„Ich seh’ es! Ich seh’ es! Wir sind drin! Wir sind drin, Baby! Wir sind da!“
Fast schien es, als geriete der Steuermann des Snoop Dogs ins Sabbern, so gierig klang seine Stimme. Das Scheinwerferlicht ließ die Konturen eines zusammengebrochenen Bettgestells sichtbar werden. Ein einstmals wunderschönes Bettgestell, ein von gedrechselten Säulen getragenes Himmelbett.
„Das ist Hockleys Bett!“, erkannte Lovett „Da hat dieser Mistkerl geschlafen!“
Snoop Dog schwebte weiter durch den Raum. Eine emaillierte Badewanne wurde sichtbar.
„Uups, da hat einer das Wasser laufen lassen“, ließ Lewis einen sarkastischen Kommentar über die auf dem Meeresboden inmitten einer unvergleichlichen Menge Wassers stehende Wanne fallen. Lovett schaute konzentriert auf die durcheinander gefallene Einrichtung der einst so luxuriösen Suite. Die beim Untergang abgefallene Schranktür fesselte seinen Blick. Sie lag schräg im Raum. Brock wog nachdenklich den Kopf.
„Warte! Warte noch eine Sekunde. Geh noch mal nach rechts zurück! Die Schranktür … geh mal etwas näher ran!“, wies er Bodine an.
„Sag’ bloß, du riechst was, Boss?“, fragte Lewis und streckte geifernd die Zunge heraus, als er umsteuerte.
„Ich will mal sehen, was da drunter ist“, erwiderte Lovett.
„Gib mir meine Hände!“, befahl Bodine. Anatoly gab ihm die Joysticks. Lewis aktivierte die Roboterarme und fuhr die mit Greifzangen versehenen Arme aus der Halterung aus.
„Großartig!“, kommentierte Bodine, als die Greifarme auf die virtuellen Kommandos ohne Verzögerung reagierten.
„Schön vorsichtig!“, mahnte Lovett, als die Greifarme die Schranktür buchstäblich in die Zange nahmen. „Mach nichts kaputt!“ Um nichts in der Welt wollte er, dass sie hier Spuren einer groben Durchsuchung hinterließen …
„Na klar!“, bestätigte Lewis und griff zu. Die Schranktür hing fest im Griff der Zangen.
„Weiter, weiter, weiter! Dreh sie um! Dreh sie um! Los, los!“, wies Lovett Bodine hektisch an.
„Und weiter! Weiter! Weiter! Okay, jetzt lass sie fallen!“, befahl er. Zunächst wirbelte die herumgedrehte, fallende Tür wieder eine Menge Sedimente auf. Als sie sich legten, kam hinter der Tür ein massives, quaderförmiges, stählernes Behältnis zum Vorschein. Bodine und Lovett bekamen ein geradezu seliges Grinsen angesichts des von ihnen so lange gesuchten Stücks, das für sie etwa mit dem Heiligen Gral vergleichbar war.
„Oh, Baby, Baby! Siehst du das, Boss?“
Brock legte den Kopf schief.
„Wir haben Zahltag, Männer!“, frohlockte er. Es war ein handlicher, transportabler Safe – der Safe, den Caledon Hockley, Fahrgast in dieser Suite, nach ihrer Kenntnis auf jeder seiner Reisen mitgenommen hatte!
Kapitel 2
Unerwartete Entdeckungen
Einige Stunden später kehrten die beiden Tauchboote mit völlig euphorisierten Crews an die Oberfläche zurück. Während das zweite Tauchboot an der Steuerbordseite aus dem Wasser geborgen wurde, kam am Kran des Hecks* ein Netz mit schwerem Inhalt aus dem Wasser. Die schon aus dem Tauchboot ausgestiegene Crew von Mir 1 johlte mit den anderen, die an Bord den Tauchgang unterstützt hatten, um die Wette.
Die Bergungscrew der Keldysh nahm den Inhalt des Netzes in Empfang. Lovett und Bodine stolperten mit Anatoly jubelnd über das Achterdeck. Lovett hatte von den dreien noch den ernsthaftesten Ausdruck, aber auch er sah erwartungsvoll aus wie ein Kind kurz vor der Weihnachtsbescherung.
„Klingelihing!“, jauchzte Lewis, das Geräusch von klingender Münze verbal imitierend. Er umarmte voller Freude Bobby Buell, der als Beauftragter der Geldgeber an Bord war.
„Wir haben es geschafft, Bobby!“, jubelte Brock, als Bobby ihm mit einem festen Händedruck gratulierte. Bodine sprang trotz seiner Breite um beide herum wie ein Eichhörnchen im Frühling und blieb schließlich wie eine Klette an Lovett hängen.
„Wer ist der Beste für dich?“, neckte er Brock. „Sag es! Sag es!“
„Du natürlich, Lewis“, lächelte Brock erleichtert, um dann Bodines Gesichtsmatratze an der Wange zu spüren, als der ihn im Überschwang küsste. Der bärtige, langhaarige Robotsteuermann ließ den Kopf der Expedition los, um eine Flasche Champagner zu köpfen und sich das edle Gesöff gleich aus der Flasche direkt in den Hals zu gießen.
„Habt ihr meine Zigarre?“, fragte Brock. Bobby griff in die Innentasche seiner Windjacke und gab ihm die dicke Siegeszigarre.
„Hier“, sagte er. Brock nahm ihm die dicke Tabakstange ab, zündete sie aber noch nicht an. Den Grund für seine Zurückhaltung konnte er im Moment noch nicht nennen, fand es aber irgendwie unangebracht, den Victory-Knüppel vor der absoluten Gewissheit der fetten Beute in Brand zu setzen.
Die Bergungscrew setzte den Safe auf dem Achterdeck ab, das Netz gab die Beute frei. Einer der Matrosen der Keldysh hatte schon den Trennschleifer laufen, um das Schloss des Safes zu knacken, als Lovett den Kameramann der Filmcrew herbeiwinkte. Er hatte die Filmcrew angeheuert, damit die Leute dokumentierten, wer die Schätze der Titanic entdeckt und geborgen hatte, damit der Augenblick des Triumphs auch ganz sicher festgehalten wurde.
„Drehst du?“, fragte er den Mann mit der Kamera auf der Schulter.
„Drehe“, bestätigte er. Um die Zeit zu überbrücken, bis der Tresor offen war, kommentierte Brock in das Mikrofon der professionellen Videokamera:
„Nun ist er da, der Augenblick der Wahrheit. Jetzt wird sich zeigen, ob die Zeit, der Schweiß, die wir investiert haben und das Geld, das wir ausgegeben haben, um dieses Schiff und die Tauchboote zu chartern, um hier herauszukommen, in die Mitte des Nordatlantiks, es wert waren. Wenn das, was wir vermuten, tatsächlich in diesem Terror … äh, … in diesem Tresor ist, dann war es das wert.“
Brocks Lächeln wurde zu einem geradezu wölfischen Grinsen vor Erwartung, als er hörte, dass das letzte Scharnier offen war.
„Mach’ das Ding mal auf!“, wies er den Techniker an.
„Ich dachte schon, wir finden das Ding nie!“, kam ein erleichterter Ausruf von hinten, wohl von Charlie von der Mir 2. Lewis schüttete einen großzügigen Schluck des kostbaren Champagners über Lovett aus, der sich erschrocken bückte, um der unausweichlichen Dusche zu entgehen. Ein zweiter Techniker schlug einen massiven Stahlhaken an einer ebenso massiven Stahlkette in den Griff des Safes, ruckte kurz an und die Safetür fiel herunter. Aus dem handlichen Tresor floss eine rotbraune Schlammbrühe heraus, spülte Geldscheine heraus. Sie alle wussten, dass diese Dinger nicht mal mehr das Papier wert waren, auf dem sie einmal gedruckt worden waren. Das Federal Reserve System, die Zentralbank der USA, war erst 1913 gegründet worden. Davor hatte es eine üble Wirtschaftskrise gegeben. Geld aus der Zeit davor war Spielgeld für Monopoly oder den Spielzeug-Krämerladen. Seither hatte es zudem diverse Veränderungen der Banknoten gegeben. Geldscheine von vor 1912 mochten einen gewissen historischen Wert haben – aber keinen tatsächlichen Gegenwert zu Waren. Mit dem schlammigen Zeug aus dem Tresor konnte man vielleicht Pappmaché machen, aber ganz gewiss nichts kaufen …
„Lasst mich da mal durch!“, forderte Lovett die Leute auf, die ihm im Weg standen oder hockten. Gehorsam traten sie beiseite und überließen ihrem Boss den ersten Griff in den Safe. Er hockte sich vor den Tresor und griff ins matschige Ungewisse. Er spürte nur weiches, schlammiges Papier – noch mehr wertlose Banknoten. Brock fischte sie heraus, griff nochmals in den Safe. Wieder nur Matsch und Dreck, aber nichts buchstäblich Handfestes. Noch zweimal hatte er nur weiche Wertlosigkeit in der Hand. Die Gesichter der versammelten Crew wechselten langsam von überschäumender Freude über gespannte Erwartung bis zu wachsendem Entsetzen, als Lovett immer wieder nur schlammiges Papier aus dem Safe barg. Schließlich hatte er eine ledrige Masse in der Hand – eine Mappe oder etwas Ähnliches, aber nicht das, was er wirklich suchte. Ratlos tastete er im dreckigen Inneren des Tresors herum, aber er war nun leer, von etwas verbliebener Schlammbrühe abgesehen.
„Verdammte Scheiße!“, fluchte er. Anatoly, der schon fast hinter ihm in den Safe kriechen wollte, sprach aus, was alle dachten:
„Keine Diamanten?“
Lovetts bitteres Schweigen und sein bedrücktes Nicken war die Bestätigung von Michailawitschs Vermutung. Bodine beugte sich herunter.
„Weißt du, Boss – dasselbe ist Geraldo passiert. Und davon hat sich seine Karriere nie erholt“, sagte er. Brock drehte sich um und sah in die laufende Kamera. Er stand auf.
„Schalt’ die Kamera aus!“, wies er den Kameramann an. Es würde nicht einfach sein, den Geldgebern zu erklären, dass das, worauf sie scharf waren, noch nicht gefunden war …
Im Labor unter Deck nahmen die Laboranten der Keldysh die aus dem Safe geborgenen Papiere trotz Lovetts offensichtlichen Desinteresses an diesen Dingen sorgsam auseinander. Vielleicht befand sich ja doch etwas darunter, was in irgendeiner Form Wert hatte oder weiterhelfen konnte. Brock stauchte inzwischen die seiner Ansicht nach unsensiblen Filmleute zusammen.
„Ihr sendet, was ich euch sage und wenn ich es sage. Ich bezahle euch mit Geld, nicht mit Zeit, klar? Und jetzt seht zu, dass ihr die Satellitenstrecke hinkriegt!“
Bobby Buell hatte zur gleichen Zeit die Investoren an der Strippe. Er drehte sich zu Lovett um und hielt die Sprechmuschel des Satellitentelefons zu.
„Brock! Unsere Partner wollen wissen, wie es vorangeht!“, meldete er.
„Wie es vorangeht?“, fragte Brock unwirsch. „Wie am ersten Tag im Knast geht es voran!“, knurrte er und nahm Buell das Telefon ab. Wie umgeschaltet setzte er prompt ein freundliches Lächeln auf.
„Hey, Dave, Barry! Hi! Es war nicht im Safe, aber – hey, hey – ihr solltet euch deswegen keine Sorgen machen. Es könnte an so vielen Stellen sein. Natürlich, klar! Zwischen den Trümmern, in der Suite, im Zimmer der Mutter … im Safe auf dem C-Deck“, sagte er mit zuvorkommender Freundlichkeit und aller Überzeugungskraft, zu der er nach dem Rückschlag jetzt noch fähig war.
„In Jimmy Hoffas Aktentasche!“, warf Bobby eine gekünstelt witzig wirkende Bemerkung ein. Jimmy Hoffa, der ebenso legendäre wie umstrittene Gewerkschaftsführer, mit der Mafia verbandelt und 1975 unter mysteriösen Umständen verschwunden, war in den USA etwa so sprichwörtlich für das Verschwinden wertvoller Gegenstände wie es die englischen Posträuber von 1963 in Europa waren – oder Ede Langfinger von der Firma Klemm, Klau & Greifenberger. Brock ging darauf nicht ein, sondern konzentrierte sich darauf, die ungeduldigen Geldgeber ruhigzustellen.
„Es gibt noch Dutzende anderer Stellen! Jungs, hört zu: Vertraut meinem Instinkt! Ich weiß, wir sind ganz nah dran! Man muss nur eine Möglichkeit nach der anderen eliminieren“, fuhr er fort und wanderte dabei unruhig so weit herum, wie das Telefonhörerkabel ihn ließ. Wie um sich wieder zu fokussieren, peilte er auf den Monitor vor sich, in dem gerade das Bild aus einem der Spültröge zu sehen war, in denen die Papiere aus der Ledermappe vom Schlamm der Jahrzehnte befreit wurden. Was die Sprühdüse langsam freilegte, fesselte plötzlich Lovetts Aufmerksamkeit.
„Eine Sekunde mal …“, sagte er und drehte sich um. „Lass mich das mal sehen!“ Er gab Bobby den Telefonhörer zurück und ging zu dem Tisch, auf dem der Spültrog war, den er eben im Monitor gesehen hatte.
„Kann sein, dass wir da was haben!“, rief Buell in den Hörer und verrenkte sich fast den Hals in Lovetts Richtung. Der stand inzwischen an dem Wasserbehälter. Eine Laborantin sprühte mit einer kleinen Hochdruckdüse den Schlamm von einer Bleistift- oder Kohlezeichnung einer Frau. Der Schatzjäger drehte sich um.
„Kann ich mal das Foto von der Kette haben?“, rief er.
„Wir rufen gleich nochmal zurück!“, beendete Buell das Telefonat und gab Lovett, was er haben wollte.
Lovett sah mit dem Foto in der linken Hand intensiv auf die Zeichnung, die er mit der Rechten vorsichtig aus dem Becken nahm. Sie war fantastisch gut erhalten, sah man von kleinen Schäden am Rand des Blattes ab. Es war eine schöne Frau, die Zeichnung selbst eine hervorragende Arbeit. Sie war jung, vielleicht kurz vor zwanzig oder allenfalls knapp darüber – und sie war nackt. Splitterfasernackt, von einem einzigen Stück abgesehen, das nicht zwanghaft als Kleidungsstück zu betrachten war. Sie trug um den Hals eine Diamantkette, in deren Mitte ein großer Stein war. Trotz der Nacktheit präsentierte sie sich aber gleichwohl mit einem gewissen Anstand. Sie lag auf einem Diwan im Empire-Stil, mitten im Licht; in einem Licht, das geradewegs aus ihren Augen heraus zu strahlen schien.
„Ist ja irre!“, bemerkte ein junger Laborant, der auch an den Tisch getreten war.
Brock hielt das Schwarz-Weiß-Foto des Diamanthalsbandes, das Ziel ihrer ganzen Suche war, neben die Zeichnung. Es war ein historisches Foto, das vor 1912 aufgenommen worden war. Darauf war zweifellos dieselbe Kette zu sehen, die auch auf der Zeichnung abgebildet war – eine Kette aus kostbaren, weißen, perfekt geschliffenen Diamanten. Aber in der Mitte hing ein mächtiger, dunklerer Stein, der fast herzförmig geschliffen war.
In der unteren rechten Ecke, die Brock mit einem sanften Wischen seines rechten Daumens freilegte, fand er ein Datum: 14. April 1912. Einige Zentimeter weiter waren zwei Buchstaben: JD. Vielleicht die Initialen des Zeichners. Wer immer dieses Bild gezeichnet hatte, war ein Meister seines Fachs.
„Das ist ja unglaublich!“, entfuhr es Brock. Die Zeichnung war jedenfalls der handfeste Beweis, dass das Herz des Ozeans – der dunkle, herzförmige Diamant, ein Stück von ungeheurem Wert – auf der einzigen Fahrt der Titanic definitiv an Bord gewesen war.
In einem Haus auf der anderen Seite des amerikanischen Kontinents war es ein sonniger Morgen. Zahlreiche Fotos, die allesamt eine schöne Frau zeigten, standen bunt durcheinander und dennoch wohlgeordnet auf einem kleinen Schank. In einem handlichen Portable-Fernseher auf der Anrichte in der Küche mit ausgesprochen kleinem Bild lief unbeachtet eine Journalsendung des Senders CNN, während Lizzy Calvert, eine Frau Ende Dreißig bis Mitte Vierzig hereinkam, auf dem Tisch gegenüber der Anrichte eine Tasse abstellte und von einem fiependen Zwergspitz umschlichen wurde.
„Schon gut, du kriegst auch gleich was zu fressen“, versprach sie dem Hund. „Na, komm!“, forderte sie das Tier auf und verließ die Küche wieder.
In der Fernsehsendung begann die Sprecherin das nächste Thema:
„Der Schatzsucher Brock Lovett ist vor allem wegen seiner Entdeckung der versunkenen spanischen Galeonen bekannt. Er befindet sich an Bord eines russischen Forschungsschiffes, um zu dem wohl berühmtesten aller Schiffswracks zu gelangen: der Titanic. Wir sind jetzt mit ihm via Satellit auf dem Forschungsschiff Keldysh im Nordatlantik verbunden. Hallo, Brock!“
„Hallo, Tracy!“, meldet sich Lovett von Bord der Keldysh. „Natürlich kennt jeder die bekannten Geschichten über die Titanic. Zum Beispiel die, dass die Kapelle bis zum bitteren Ende gespielt hat und all das. Aber was mich interessiert, das sind die Geschichten, die keiner kennt. Die Geheimnisse, die tief im Inneren der Titanic verborgen sind. Wir sind hier, um mithilfe von Robotern tiefer in das Wrack einzudringen, als je irgendjemand zuvor.“
Die Erwähnung der Titanic machte Rose Calvert aufmerksam, eine alte Frau, die im lichtdurchfluteten Atelieranbau des Hauses an einer Töpferscheibe saß und roten Ton zu einem Topf formte. Ihre Hände hatten zahlreiche Altersflecken, waren faltig und trocken, wirkten aber gleichzeitig kraftvoll. Sie sah von ihrer Arbeit auf. So alt, gebrechlich und konturlos wie ihr Körper wirkte, so strahlend waren ihre Augen, die immer noch ein jugendliches Feuer zeigten. Sie stand mit einiger Mühe auf, nahm ihren Stock und bewegte sich in langsamen, unsicheren Schritten vorwärts in die Küche. Sie hatte sich nicht einmal die Hände gesäubert, so sehr interessierte sie das, was sie gerade wahrgenommen hatte.
„Ihre Expedition ist Gegenstand einer hitzigen Debatte. Es geht um Bergungsrechte und ethische Fragen. Von vielen werden Sie als Grabräuber bezeichnet“, sagte Moderatorin Tracy.
„Bis jetzt ist nie jemand auf den Gedanken gekommen, der Bergung der Kunstwerke Tut anch Amuns als Grabräuberei zu bezeichnen“, wehrte Lovett die Vorwürfe ab.
Die alte Dame nahm wahr, dass die Moderatorin mit dem Mann sprach, der rechts im Bild zu sehen war. Die jüngere Frau, die kurz zuvor mit dem Zwergspitz hinausgegangen war, kam eben in diesem Moment in die Küche zurück.
„Was ist los?“, fragte sie, offensichtlich verblüfft darüber, dass ihre Großmutter ihre Töpferscheibe verließ.
„Dreh’ das mal lauter, Schatz“, bat die Ältere.
„Ich habe Experten verschiedener Museen an Bord, die sicherstellen, dass die Artefakte angemessen konserviert und katalogisiert werden“, fuhr Lovett mit seiner Rechtfertigung fort. „Sehen Sie sich diese Zeichnung an, die wir grad’ heute gefunden haben“, sagte er. Die Kameraeinstellung wechselte zu der Zeichnung, die sich unter den Papieren im Tresor von der Titanic gefunden hatte. „Ein Blatt Papier, das vierundachtzig Jahre im Wasser gelegen hat. Meinem Team ist es gelungen, es unbeschädigt zu bergen. Hätte das für alle Ewigkeiten unentdeckt auf dem Grund des Ozeans verbleiben sollen? Wenn wir es uns jetzt ansehen und daran freuen können …“
„Das ist ja unglaublich!“, entfuhr es der alten Dame, die vorgebeugt vor dem kleinen Fernseher stand und auf etwas sah, das sie zuletzt vor vierundachtzig Jahren gesehen hatte.
Im Nordatlantik war die Sonne untergegangen. Brock Lovett stand wieder an Deck der Keldysh und beobachtete, wie die Mir 1 aus den Verankerungen gehoben wurde, um erneut zu Wasser gelassen zu werden. Das Schwesterboot war bereits wieder ausgesetzt, die Crew wartete nur noch darauf, dass auch Mir 1 wieder startklar war.
„Brock! Da ist’n Anruf über Satellit für dich!“, rief Bobby Buell durch den Lärm von Wind und Krangeräuschen. Lovett drehte sich um und wirkte gereizt.
„Bobby, ich hab’ hier zu tun! Wie du siehst, wollen wir gerade das Tauchboot zu Wasser lassen“, knurrte er.
„Vertrau mir, Kumpel. Dieser Anruf wird dich interessieren!“, rief Bobby mit hektischer Geste.
„Das will ich für dich hoffen!“, grollte Brock und folgte Buell widerwillig zum Satellitentelefon.
„Du musst sehr laut reden! Sie ist schon etwas älter“, brüllte Buell.
„Na, toll!“, seufzte Lovett und nahm den Hörer. „Hier spricht Brock Lovett! Wie kann ich Ihnen helfen, Mrs. …“
Hilfesuchend wandte er sich an Buell.
„Calvert! Rose Calvert!“, half der aus.
„Mrs. Calvert?“
Rose lächelte am anderen Ende des amerikanischen Kontinents.
„Ich wollte Sie nur fragen, ob Sie das Herz des Ozeans schon gefunden haben, Mr. Lovett?“, fragte sie. Ihr Lächeln wurde schelmisch, als könnte sie sehen, dass ihrem Gesprächspartner gerade die Gesichtszüge entgleisten. Auf dem Nordatlantik hätte Brock Lovett in der Tat nicht erschrockener sein können, wenn vor ihm die Flying Dutchman samt Davy Jones am Steuer aus den Fluten geschossen wäre … Er fuhr herum zu Bobby. Der zuckte mit einer ausladenden Geste mit den Schultern.
„Wusst’ ich’s doch, dass dich das interessieren würde!“, grinste er.
„Also … ich bin ganz Ohr, Rose“, flötete Lovett mit ausgesuchter Höflichkeit. „Können Sie uns sagen, wer die Frau auf dem Bild ist?“, fragte er. Rose lächelte verschmitzt.
„Oh, ja! Die Frau auf dem Bild bin ich!“, ließ sie die Bombe platzen.
Kapitel 3
Der Besuch der alten Dame
Brock Lovett hatte an diesem Abend sehr lange und sehr ausführlich mit Rose Calvert telefoniert. Dabei hatte sie ihm auch gesagt, dass ihr Mädchenname Rose DeWitt Bukater gewesen sei. Der Name fand sich tatsächlich auf der Lewis bekannten Passagierliste, die Brock sich nebenbei hatte geben lassen. Lovett hatte sie am Ende des Telefonats auf die Keldysh eingeladen. Nach der Rettung von gerade einem Drittel der Seelen, die sich an Bord der Titanic befunden hatten, war der Name DeWitt Bukater aber nur noch im Zusammenhang mit Ruth DeWitt Bukater, ihrer Mutter, aufgetaucht. Rose DeWitt Bukater war nach herrschender Meinung der Titanic-Experten oder solcher, die sich dafür hielten, eine der Toten, die das Meer nicht mehr freigegeben hatte; denn auch auf dem Friedhof in Halifax, wo die in den Tagen nach dem Untergang der Titanic geborgenen Toten beigesetzt waren, fand sich ihr Name nicht.
Lewis Bodine gehörte zu der Sorte von Experten, die fest von Roses Tod überzeugt war. Skeptisch, wie er war, hatte er Nachforschungen über die Passagierin und auch über jene Frau angestellt, die Brock von Halifax aus zur Keldysh fliegen ließ. Was er herausgefunden hatte, ließ ihn wie einen wildgewordenen Derwisch hinter Brock über das Schiff rennen, um seinen Freund davon zu überzeugen, dass er einer Betrügerin aufgesessen war.
„Das ist ’ne gottverdammte Lügnerin!“, wetterte er, während Lovett sich zu überzeugen versuchte, dass ein erneutes Aussetzen der beiden Tauchboote reibungslos klappte. „Irgend ‘ne Irre, die scharf auf Geld ist oder ins Fernsehen will! Nur Gott weiß, wieso!“, fuhr er fort, weit ausladend mit den Armen rudernd, um die Aufmerksamkeit seines Bosses ganz sicher auf sich zu lenken. „Genau wie die russische Braut damals … Anesthesia!“
Brock konnte sich über letztere Bemerkung ein Lachen nur schwer verkneifen.
Bobby Buell stand an der Steuerbordseite, wo eines der beiden Boote gerade klar gemacht wurde. Er peilte achteraus, von wo sich ein großer Sikorsky-Hubschrauber vom Typ Sea Stallion dem Landedeck des Forschungsschiffes näherte.
„Sie kommen!“, rief er. Lovett sah kurz nach achtern, dann machte er kehrt, um rechtzeitig am Hubschrauberlandeplatz zu sein. Bodine konnte ihm nur knapp folgen.
„Rose DeWitt Bukater kam auf der Titanic im Alter von siebzehn Jahren ums Leben, stimmt’s?“, fragte er die zwischen ihnen beiden an sich nicht umstrittene Tatsache ab.
„Stihimmt!“, bestätigte Lovett mit fröhlichem Unterton im Laufen und sah sich zwischendurch um, als wollte er den Hubschrauber mit Blicken zum richtigen Platz leiten.
„Wenn sie das überlebt hätte, wäre sie jetzt über hundert!“, protestierte Lewis weiter.
„Hunderteins – nächsten Monat!“, grinste Brock über die Schulter.
„Also gut, dann ist sie eine sehr alte gottverdammte Lügnerin!“, konterte Lewis aufgebracht. „Ich … ich habe die Geschichte dieser Frau bis in die Zwanzigerjahre zurückverfolgt!“
„Toll!“, lobte Brock spöttisch und enterte den steilen Niedergang zum Hubschrauberdeck. Bodine folgte ihm hartnäckig.
„Damals ist sie Schauspielerin gewesen! Schauspielerin! Da hast du deinen ersten Hinweis, Sherlock!“, wetterte er weiter. Das schien ihm der deutlichste Beweis dafür zu sein, dass jemand sie veräppeln wollte. „Damals war sie unter dem Namen Rose Dawson bekannt. Dann hat sie diesen Typen namens Calvert geheiratet. Die beiden ziehen nach Cedar Rapids, und sie brüten ein paar Kinder aus. Calvert ist inzwischen tot und nach allem, was ich gehört habe, Cedar Rapids auch.“
Brock bekam ein so breites Grinsen, dass die Ohren beinahe Besuch von den Mundwinkeln bekamen.
„Und alle, die von dem Diamanten wissen, sind angeblich auch tot – oder auf diesem Schiff! Aber sie weiß davon!“, spielte er seinen fettesten Trumpf aus. Sein Zeigefinger schien Lewis geradezu aufspießen zu wollen, so heftig gestikulierte er mit der Extremität in dessen Richtung. Bodine gab schulterzuckend auf. Sollte Brock doch sehenden Auges in sein Verderben laufen …
Der Hubschrauber mit kanadischer Zulassung setzte auf.
„Er ist gelandet!“, meldete Bobby per Walkie-Talkie an den Kapitän der Keldysh. Der Sturm, den der Rotor verursachte, war so heftig, dass Lovett und Bodine beinahe weggeweht wurden. Instinktiv schützten sie die Augen, obwohl auf der Keldysh schon lange kein Staub mehr sein konnte.
Die Matrosen luden das Gepäck aus. Bodine verschränkte die Arme. Wenigstens zehn Koffer unterschiedlicher Größe stapelten sich an Deck, als Buell dazu kam.
„Sie reist nicht gerade mit leichtem Gepäck!“, ließ Lewis eine spitze Bemerkung fallen. Für ihn war die Frau, die sich als geborene DeWitt Bukater ausgab, einfach eine Wichtigtuerin.
Lovett stand inzwischen an der Schiebetür des Passagierabteils, das gerade offen war. Die Tür gab eine alte Dame im Rollstuhl frei, die einen kleinen Hund auf dem Schoß hatte. Die Piloten hoben den Rollstuhl hinaus, die Matrosen unten nahmen das Gefährt entgegen.
„Seid bitte vorsichtig!“, mahnte Lovett. Er wandte sich an die alte Dame und grüßte ebenso lässig wie angedeutet militärisch. „Mrs. Calvert, ich bin Brock Lovett. Willkommen auf der Keldysh!“, rief er und begrüßte sie dann mit Handschlag. Die Matrosen bugsierten den Rollstuhl samt Insassin vorsichtig genug auf das Deck, um Brocks Vorstellung zu genügen.
„Okay, dann bringt sie mal rein“, entfuhr es ihm mit einer gewissen Erleichterung. „Hi, Miss Calvert“, begrüßte er dann Roses Enkelin, die sportlich aus dem Hubschrauber sprang und sicher auf dem Deck landete. In seiner Stimme schwang ein gewisses Flirtpotenzial mit, als er sie ebenfalls mit Handschlag begrüßte. Sie lächelte ihn zwar freundlich an, wandte sich dann aber von ihm ab und dem Rollstuhl zu.
„Ich mach’ das schon“, sagte sie und nahm den Matrosen die Griffe des Rollstuhls ab, um ihre Großmutter ins Schiffsinnere zu bringen. Die beiden Passagiere waren gerade außer Sicht, als Brock sich wieder zum Hubschrauber umdrehte und geradewegs in ein ziemlich großes Goldfischaquarium sah, das ihm einer der Piloten aus dem Passagierabteil reichte. Eher automatisch griff er zu. Es war die in Jahren antrainierte Reaktion eines Menschen, der sein Leben hauptsächlich auf Expeditionen verbrachte und es gewohnt war, Transportmittel schnell und effizient auszuräumen. Einen Moment stand er dann aber ratlos da, das Aquarium in den Händen.
Etwas später hatten die Goldfische – immerhin vier an der Zahl – samt ihrem Behältnis Platz in einer großzügigen Kabine des Forschungsschiffes gefunden. Neben dem Aquarium drapierte Rose ihre Fotos, als es klopfte.
„Ja?“, bat sie den Klopfer herein. Die Tür öffnete sich und Lovett stand mit einem Lächeln von der ganz süßen Sorte darin. Hinter ihm winkte Bodine, ebenfalls mit zuckersüßem Lächeln.
„Sind Sie mit Ihrer Kabine zufrieden?“, fragte Brock.
„Ja“, erwiderte Rose und wies mit einer eleganten Handbewegung auf Lizzy, die vor ihr hockte und ihr ein gerahmtes Foto nach dem anderen aus einem der Schrankkoffer reichte.
„Habe ich Ihnen schon meine Enkelin Lizzy vorgestellt?“, fragte sie. „Sie sorgt für mich.“
Mit einem verschmitzten Lächeln wandte Lizzy sich an die beiden Besucher.
„Wir haben uns gerade eben kennen gelernt“, neckte sie fröhlich. „Oben an Deck. Weißt du nicht mehr, Nana?“
Tonfall und Wortwahl machten deutlich, dass ihr Bestreiten keineswegs ernst gemeint war, sondern im Gegenteil eine liebevolle Beziehung zwischen Großmutter und Enkelin dokumentierte. Lewis und Brock bekamen es allerdings nicht mit. Als Rose auch noch mit einer hilflosen Geste, die pure Vergesslichkeit ausdrückte, sagte:
„Ach ja …“, und sich dann wieder den Fotos widmete, drehte Brock sich zu Lewis um. Beide verdrehten die Augen. Das konnte ja heiter werden!
„So … das sieht hübsch aus“, konstatierte Rose schließlich. „Ich muss meine Bilder immer dabei haben, wenn ich verreise – und Freddy natürlich auch“, setzte sie hinzu und knuddelte den kleinen Hund. Lovett gab sich alle Mühe, geduldig zu bleiben.
„Kann ich Ihnen noch etwas bringen? Haben Sie noch einen Wunsch?“, fragte er wie ein Steward auf einem Luxusliner – er kam sich inzwischen beinahe so vor …
„Ja“, erwiderte Rose mit einem geradezu jugendlichen Funkeln in den Augen. „Ich würde mir gern die Zeichnung von mir ansehen.“
Lovett und Bodine begleiteten die alte Dame und ihre Enkelin in das Labor der Keldysh. Die Zeichnung lag immer noch in dem Wasserbehälter. Sie musste feucht gehalten werden, um sie zu konservieren. Rose rollte an den Tisch mit dem Wasserbehälter heran und erhob sich dann recht mühsam aus dem Rollstuhl. Der Umstand, dass sie sich dabei an dem Rand des Wasserbehälters festhielt, ließ Brock und Lewis fast das Herz stehen bleiben. Sie hatten Glück. Der Behälter war schwer genug, um sich von der alten Rose nicht aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen.
Ihr Blick fiel auf die Zeichnung, die sie selbst mit gerade mal siebzehn Jahren zeigte. Von ihrer Erinnerung überwältigt schloss sie die Augen und war wieder auf dem Diwan in der Suite B-52. Warmes Licht umstrahlte sie, als der Zeichner sie konzentriert ansah und mit der ihm eigenen Fingerfertigkeit den Bleistift in sachten Strichen über das Papier gleiten ließ. Sie erinnerte sich an seine blaugrünen Augen, die in diesem Moment mit aller Professionalität über ihren Körper glitten, um das Gesehene zu Papier zu bringen – nichts anderes. Jack … Der Gedanke an ihn löste auch nach vierundachtzig Jahren ein warmes Gefühl in ihr aus.
Sie ließ sich wieder in den Rollstuhl sinken, den Lizzy vorsichtshalber festhielt. Außer Lovett, Bodine und Lizzy war noch Bobby Buell mit dazu gekommen, um zu hören, was die alte Dame zu sagen hatte.
„Ludwig XVI. besaß einen berühmten Edelstein. Man nannte ihn den Blauen Diamanten der Krone. Er ging 1792 verloren, etwa zur selben Zeit, als der alte Ludwig alles vom Hals aufwärts verlor“, hörte Rose Lovetts sonore Stimme. „Es gibt eine Theorie, dass der Diamant auch unters Messer kam“, sprach er weiter und nahm das Foto zur Hand, zeigte es Rose. „In Herzform geschliffen, soll er als Herz des Ozeans bekannt geworden sein. Heute wäre er mehr wert als der Hope Diamant.“
Rose sah den Schatzjäger geringschätzig an.
„Ach, es war ein fürchterlich schwerer Klunker. Ich hab’ ihn nur dieses eine Mal getragen“, wehrte sie ab. Lizzys Blick fiel auf die Zeichnung. Sie konnte nicht glauben, dass diese schöne, junge Frau mit ihrer Großmutter identisch war.
„Glaubst du wirklich, das bist du, Nana?“, fragte sie mit unüberhörbarer Skepsis. Rose sah kurz auf die Zeichnung, dann zu ihrer Enkelin.
„Natürlich bin ich das, Schatz!“, stellte sie klar. „War ich nicht eine Augenweide?“, fragte sie dann, leicht verträumt.
Brock fand, dass Lizzys Zweifel die geeignete Gelegenheit darstellte, zu prüfen, ob hier alles wirklich mit rechten Dingen zuging – und Lewis hoffentlich zu beweisen, dass diese Frau tatsächlich die war, die sie vorgab zu sein.
„Ich konnte die alten Versicherungsunterlagen ausfindig machen. Es hat eine Forderung gegeben, die unter Auflage strengster Geheimhaltung beglichen wurde“, sagte er. „Können Sie mir sagen, wer diese Schadenersatzforderung gestellt hat, Rose?“
„Ich könnte mir vorstellen, dass es jemand namens Hockley war“, erwiderte Rose wie aus der Pistole geschossen.
‚Bingo!‘, durchzuckte es Brock. ‚Wir haben die echte Rose DeWitt Bukater!‘
Nur jemand, der wirklich Insider war, konnte diese Verbindung kennen …
„Nathan Hockley, ja, das ist richtig. Ein in Pittsburgh lebender Stahltycoon“, bestätigte Lovett und hockte sich an der Tischkante vor Rose. „Die Forderung bezog sich auf ein Diamantcollier, das sein Sohn Caledon seiner Verlobten – Ihnen! – eine Woche vor Auslaufen der Titanic gekauft hatte“, erklärte er. „Sie wurde nach dem Untergang eingereicht. Also ist der Diamant zusammen mit dem Schiff untergegangen. Sehen Sie das Datum?“
Lizzys Blick fiel auf den unteren Rand der Zeichnung.
„14. April 1912“, las sie ab.
„Wenn Ihre Großmutter also die ist, die sie behauptet zu sein“, ließ sich Lewis von hinten vernehmen, „dann trug sie den Diamanten am Tag des Untergangs der Titanic.“
Brock sah die alte Dame an wie ein treuer Hund.
„Und damit … sind Sie ab heute meine beste Freundin. Ich werde Ihnen mit Freuden alles vergüten, was Sie uns sagen können, um ihn zu finden.“
Rose lächelte sanft.
„Ich will Ihr Geld nicht, Mr. Lovett. Ich weiß, dass es für Leute, die am Geld hängen, schwer ist, etwas davon wegzugeben“, versetzte sie.
„Sie wollen wirklich nichts?“, fragte Bodine verständnislos. Lovett und er fühlten sich regelrecht ertappt. Rose wies auf die Zeichnung.
„Sie können mir das hier geben, wenn ich Ihnen etwas sagen kann, das für Sie Wert hat“, bot sie an.
„Abgemacht“, schloss Brock den Handel.
Nachdem nun geklärt war, dass Rose Calvert tatsächlich Rose DeWitt Bukater war, präsentierte Brock diverse weitere Gegenstände, von ziemlich profan bis durchaus kostbar. Für Lovett war es im Vergleich zu dem noch nicht gefundenen Diamanten dennoch wertlose Beute aus der Suite.
„Das sind ein paar Gegenstände, die wir aus Ihrer Kabine geborgen haben“, sagte er zu den gereinigten und liebevoll hergerichteten Schmuckstücken und Toilettenartikeln – Kamm, Handspiegel, Schere, ein schmales Collier mit unregelmäßigen und deshalb umso schöneren Perlen, Broschen. Roses erster Griff ging zu dem Handspiegel aus Schildpatt, den sie mit zittriger Hand vorsichtig an sich nahm.
„Der gehörte mir. Wie außergewöhnlich!“, entfuhr es ihr voller Begeisterung. „Er sieht noch so aus wie das letzte Mal, als ich ihn in der Hand hielt.“
Sie drehte ihn um und sah in den Spiegel. Das Glas war gesprungen. Irgendwie passte dieser Spiegel – so wie er war – zu ihr. Auch sie war alt geworden, hatte ihre Sprünge …
„Das Spiegelbild hat sich etwas verändert“, bemerkte sie mit einem deutlichen Seufzen, aber mit schelmischem Humor und legte den Spiegel wieder weg – die Spiegelseite nach unten, so, wie sie ihn vorgefunden hatte. Dann fesselte ein wunderschöner Steckkamm ihre Aufmerksamkeit. Der Jauchzer, der sich ihr bei diesem Anblick entrang, hätte auch zu einem jungen Mädchen von siebzehn Jahren gepasst. Es war ein schmaler, aber etwa handlanger Hornkamm, dessen stumpfes Ende mit einem ebenso naturalistischen wie filigranen Jugendstil-Schmetterling aus Bronze geschmückt war. Die Flügel bestanden aus einem ebenso zarten wie stabilen Bronzenetz, dessen Durchbrüche mit feinen Jadescheiben gefüllt waren. Der massiv bronzene Leib des Schmetterlings war an der breitesten Stelle hinter dem Kopf mit einem ovalen, glatt geschliffenen Jadestück verziert. Am linken Flügel waren die Jadescheiben ausgebrochen, das Bronzenetz war dort ebenfalls an den äußersten Reihen beschädigt. Rose war anzusehen, dass sie gerade von einer Welle von Erinnerungen, aber auch Emotionen überrollt wurde, als sie den Kamm in der Hand drehte.
„Sind Sie bereit, noch einmal auf die Titanic zu gehen?“
Lovetts Frage drang wie aus weiter Ferne zu ihr durch. Sie nickte schweigend, weil ihr die Stimme zu versagen drohte.
Der Kontrollraum, in dem verschiedene Monitore Bilder der beiden Tauchboote und den Robotern Snoop Dog und Duncan zeigten, war abgedunkelt.
„Live aus zwölftausend Fuß Tiefe“, kommentierte Bodine die Bilderschwemme, die Roses Wahrnehmung zu überfluten drohte. Doch ihr Blick verfing sich an dem Monitor, der Bilder von der Bugreling zeigte. Es war offensichtlich, dass diese Stelle des Schiffes ihr ganz persönlich etwas bedeutete. Brock studierte ihre Reaktionen genau. Lizzy drehte den Rollstuhl herum, damit ihre Großmutter Bodines Computer sehen konnte.
„Wir haben die weltgrößte Datenbank über die Titanic zusammengestellt“, sagte er, während er nach der passenden Datei suchte und sie aufrief.
„Rose möchte das vielleicht nicht sehen“, mutmaßte Lovett.
„Nein, nein, ist schon in Ordnung. Ich bin neugierig“, entgegnete sie. Tatsächlich schaute sie mit unübersehbarem Interesse auf die animierte Grafik, die auf dem Bildschirm erschien, die Bodines maschinengewehrschnelle Erläuterung unterstützte.
„Okay, los geht’s! Sie rammt den Eisberg mit der Steuerbordseite, stimmt’s? Sie schrammt an ihm entlang und reißt sich lauter Löcher in die Seite. Wie ‘n Morsecode … dit, dit, dit. Das Ganze geschieht unterhalb der Wasserlinie“, begann er. Die Animation zeigte, wie das Schiff gegen den Eisberg schlug, daran entlang schrammte und in kurzen Abständen mehrere kleine, aber umso verhängnisvollere Lecks bekam.
„Die vorderen Abteilungen beginnen, vollzulaufen. Jetzt, wo der Wasserstand weiter steigt, läuft das Wasser über die Schotten hinweg, die unglücklicherweise nur bis zum E-Deck reichen. Und damit beginnt der Bug zu sinken und das Heck hebt sich“, kommentierte er die Animation, die nun die unmittelbaren Folgen der Lecks zeigte. „Am Anfang noch langsam, dann immer schneller und schneller, bis irgendwann der gesamte Arsch steil in die Luft ragt – und das is’ ‘n gewaltiger Arsch! Wir reden hier von zwanzig, dreißigtausend Tonnen!“, fuhr er fort und entfernte sich zunehmend von einer – nun ja – angemessenen Sprache gegenüber einer alten Dame, von der er als Titanic-Experte mit Hang zu den Schätzen in der Ersten Klasse wissen musste, dass sie in feiner Gesellschaft aufgewachsen war.
„Okay, der Rumpf kann einer so starken Belastung nicht standhalten. Also, was passiert? Krrrk – sie bricht durch, runter bis zum Kiel“, bremste er seine entglittene Sprache und ging zur Lautmalerei über. „Das Heck fällt wieder zurück in seine alte Position. Dann, als der Bug sinkt, zieht das Heck in die Vertikale und bricht dann schließlich weg. Das Heck treibt in dieser Position noch einige Minuten lang wie eine Art Korken, läuft dann voll und geht um etwa zweiuhrzwanzig unter. Zwei Stunden und vierzig Minuten nach der Kollision. Der Bug driftet davon und schlägt etwa ‘ne halbe Meile entfernt mit einer Geschwindigkeit von zwanzig bis dreißig Knoten auf den Grund. Ziemlich cool, hä?“, schloss er seine Präsentation, die mit dem Aufschlag des vorderen Teils der Titanic endete, der nochmals in sich brach. Es blieb am Ende das Bild, das sich den Forschern seit nunmehr vierundachtzig Jahren bot, wenn der Meeresgrund entsprechend ausgeleuchtet werden konnte.
Rose sah ihn abschätzend an.
„Vielen Dank für Ihre präzise, forensische Analyse, Mr. Bodine“, versetzte sie sarkastisch. „Sie verstehen sicher: Die persönliche Erfahrung – das war ein klein bisschen anders …“
Brock hatte bislang geschwiegen und den Redefluss dem Computerfreak Lewis überlassen.
„Lassen Sie uns daran teilhaben?“, fragte er leise, fast sanft. Rose antwortete nicht, sah sich um. Ihr Blick fiel auf einen der Monitore, die hinter ihr waren. Dort war die geschnitzte Eingangstür zum Salon des D-Decks zu sehen. Das D-Deck war der gesellschaftliche Treffpunkt gewesen, dort hatte sich auch der Speisesaal der Ersten Klasse befunden. Rose verfolgte, dass der Roboter dicht an die Tür heranfuhr. Auf dem Monitor war Dunkelheit, abgesehen vom Scheinwerferlicht des Robots, schwebende Teilchen – es mochte Plankton oder einfach aufgewirbeltes Sediment sein – und eine halbe Eingangspforte. Doch Rose sah etwas anderes: Strahlendes, warmes Licht, eine perfekt zu ihrer Zeit passende, kostbare Jugendstil-Tür, die einen wunderbaren Vorgeschmack auf den Luxus dieses Schiffes präsentierte. Vor ihrem geistigen Auge wurde die Tür von zwei freundlich lächelnden Stewards geöffnet, die sie willkommen hießen; entfernte Musik – ein Walzer – klang geisterhaft in ihren Ohren. Der Tagtraum der schönen Erinnerung verging, als sie eine andere Erinnerung überfiel; die Erinnerung an das, was später geschehen würde. Entsetzt darüber schlug sie die Hände vor den Mund. Ein Schluchzen entrang sich ihrer Kehle, die sich immer enger zusammenschnürte.
Lizzy machte sich zunehmend Sorgen um ihre Großmutter, fürchtete, dass dies alles eine viel zu große Belastung für die alte Dame war. Sie trat zu ihr und nahm sie an den Schultern.
„Es ist besser, wenn sie sich jetzt ausruht“, sagte sie.
Mit erstaunlicher Kraft schüttelte Rose sie ab.
„Nein!“, widersprach sie energisch. Aus der ebenso niedlichen wie gebrechlichen alten Dame wurde eine willensstarke Frau mit schier stählernem Blick, als sie sich umwandte. Lovett wurde langsam klar, dass er es mit einer unglaublich starken Frau zu tun hatte, die nur wegen eben dieser Kraft jene Katastrophe überlebt hatte.
Sie setzte sich mit Lizzys Unterstützung.
„Das Diktiergerät!“, winkte Brock, setzte sich wieder rittlings auf den Stuhl, so wie er schon während Bodines Vortrag gesessen hatte. Das Diktiergerät stellte er eingeschaltet auf den Computertisch.
„Erzählen Sie ‘s uns, Rose“, bat er.
„Es ist über vierundachtzig Jahre her …“, setzte sie an. Lovett sah sich veranlasst, sie zu beruhigen:
„Schon gut. Versuchen Sie, sich an irgendwas zu erinnern. Egal, an was.“
„Wollen Sie das nun hören oder nicht, Mr. Lovett?“, schmunzelte sie ihn an. Brock wurde beinahe rot vor Beschämung. Er lächelte, etwas verunsichert und nickte. Sie konzentrierte sich.
„Es ist … über vierundachtzig Jahre her …“, begann sie erneut – wie eine Schauspielerin, die ihren Text neu ansetzt. „… und ich rieche immer noch die frische Farbe. Das Geschirr war noch völlig unbenutzt. Noch nie hatte jemand in den Betten geschlafen. Die Titanic wurde auch das Schiff der Träume genannt – und das war sie auch. Das war sie wirklich.“
Die Augen aller hingen wie gebannt an Roses faltigen Lippen, gleichzeitig aber auch an dem Monitor hinter ihr, der den Bug der Titanic zeigte. Roses Erzählung war so lebendig, dass alle Zuhörer glaubten, der Bug verwandele sich – vom rostigen, seetangüberwucherten Metallteil auf dem Meeresgrund in blauem Licht zur strahlend weiß lackierten Spitze des größten Schiffes seiner Zeit unter blauem Himmel am Passagierkai in Southampton, bereit, zum ersten Mal in See zu gehen …
♦♦♦
Teil 2 – Roses Erzählung
Kapitel 4
Des Einen Leid, des Anderen Freud
Der 10. April 1912 war ein strahlend schöner Tag. Es war der Tag der Jungfernfahrt der Titanic. Am Dock der White Star Line in Southampton war eine riesige Menschenmenge versammelt. Es waren ebenso Passagiere wie Schiffspersonal der Reederei, aber auch zahlreiche Sehleute, die das gewaltige Schiff – das größte und schönste dieser Tage – abfahren sehen wollten. Noch lag es fest vertäut an der Pier und erwartete seine Passagiere, die über mehrere Zugänge in das Schiffsinnere strömten.
Die Welt dieser Tage war streng in Klassen geteilt, deren Grenzen nicht leicht zu überwinden waren. Die Standesunterschiede ergaben sich aus gesellschaftlicher Herkunft, aus dem normalsterblichen Volk oder dem Adel, letzteres jedenfalls in Großbritannien, wo es einen Geburtsadel gab, wo auch Erhebungen in den Adelsstand durch einen nach wie vor vorhandenen König erfolgen konnten. Im Laufe der Zeit hatte sich neben Adel und einfachen Bürgern durch Handel, Industrie und Dienstleistungen eine zwischen Adel und Normalvolk stehende Klasse gebildet, der Geldadel – Leute, die so reich geworden waren, dass sie ihr Geld in diesem Leben allein nicht verprassen konnten oder Leute, die entsprechende Reichtümer geerbt hatten, von Beruf eher Sohn oder Tochter waren, als dass sie einer bezahlten Arbeit nachgingen.
In den Vereinigten Staaten, einer präsidialen Republik, die weder vorhandenen Adel anerkannte noch in den Adelsstand erhob, teilten sich die Klassen zwischen Geldadel, mehr oder weniger bescheidenem Mittelstand und Habenichtsen. Offiziell waren die Klassen in der Republik Vereinigte Staaten von Amerika nicht vorhanden; theoretisch hatte jeder die Möglichkeit, durch Fleiß, Geschick und zuweilen auch Rücksichtslosigkeit Geld zu machen und damit gesellschaftlich aufzusteigen, aber die Geschichte vom Tellerwäscher, der es zum Millionär brachte, blieb für den weitaus größten Teil der Auswanderer in die Neue Welt ein Traum, eine Legende.
Die oberen Klassen, Adel und Geldadel, rechneten die Mittellosen zum Abschaum dieser Erde, gerade gut genug, um fast rund um die Uhr zu schuften, um den Reichen das Leben leicht zu machen oder um sie noch mehr Geld scheffeln zu lassen, als sie ohnehin schon besaßen.
Die Titanic spiegelte diese Unterschiede augenscheinlich schon durch den Anstrich wider: War sie am Rumpf bis zum D-Deck schwarz gestrichen, war der obere Teil, die Decks A bis C, weiß lackiert, ein gelber Streifen unter den Bullaugen des C-Decks markierte die Grenze zwischen den beiden Teilen. Zwei Turmbrücken vom Terminal ermöglichten den Passagieren der Ersten Klasse einen nahezu ebenerdigen Zugang in das B-Deck, in dem sich die extrem teuren Suiten und Kabinen der Ersten Klasse befanden. Eine dieser Turmbrücken befand sich unterhalb des zweiten Schornsteins, die zweite unterhalb des vierten Schornsteins. Ein wenig nach vorn versetzt unter der vorderen Turmbrücke führte eine schräge Gangway direkt von der Pier hinauf in das D-Deck, die Zugänge zum E-Deck, in dem die Dritte Klasse untergebracht war, führten ganz vorn und fast am Heck mit nur wenig Neigung in das Schiff.
Gepäck wurde verladen, sogar ein Auto, ein schöner, dunkelroter Renault Tournee, hing in Krantauen und wurde zur Ladeluke auf der Back an Bord gehoben. Passagiere und sie verabschiedende Angehörige standen in Trauben um die Zugänge. Die Passagiere der Dritten Klasse wurden durch einen Staketenzaun zu den Zugängen geleitet, wo speziell geschulte Crewmitglieder sie erwarteten und jeden einzelnen Passagier vor dem Einsteigen penibel auf Läuse und andere Krankheiten untersuchten, als wären sie Tiere vor dem Schlachthaus. Einer der Einschiffungsoffiziere in White-Star-Uniform wedelte wie ein Verkehrspolizist mit den Armen, um die Auswanderer zum richtigen Eingang zu lotsen.
„Passagiere der Dritten Klasse mit Kabinen vorne im Bug – gehen Sie bitte hier entlang und stellen Sie sich in dieser Reihe an!“, rief er – nicht, dass sich diese Leute noch zur Gangway der Ersten und Zweiten Klasse ins D-Deck verirrten …
Noch einige Yards** vom Schiff und auch den peinlich untersuchenden Crewmitgliedern entfernt stand Bert Cartmell, hatte seine kleine Tochter Cora auf dem Arm und starrte fasziniert auf die gewaltigen Dimensionen des Schiffes, das sie nach Amerika bringen sollte.
„Ziemlich großes Boot, hm?“, brachte er heraus. Cora sah das riesige Schiff ebenfalls fasziniert an. So etwas Großes hatte sie in ihrem kurzen Leben noch nicht gesehen.
„Daddy! Das ist doch ein Schiff!“, protestierte sie. Bert lächelte. Seine Kleine war ein aufgewecktes Kind. Sie würde es in Amerika noch zu etwas bringen …
„Du hast Recht“, bestätigte er.
In diesem Moment forderte ein anderes Geräusch Coras Aufmerksamkeit. Das kleine Mädchen drehte sich auf Vaters Arm um und sah zum Schuppen am Kai. Dort bahnten sich drei von grau livrierten Fahrern gesteuerte Kraftwagen den Weg durch die Menschenmenge an der Pier und stoppten in der Nähe der Gangway zum D-Deck. Zwei der Fahrzeuge hatten ein geschlossenes Passagierabteil, der dritte Wagen war gänzlich offen und hoch mit Koffern beladen. Seit gut fünfundzwanzig Jahren gab es nun mit Motorkraft fahrende Wagen, aber sie hatten immer noch viel Ähnlichkeit mit den Kutschen, die von Pferden gezogen wurden. Geschlossene Wagenkästen gab es nach wie vor nur für die Passagiere, nicht aber für den Fahrer und den Beifahrer; die saßen immer noch im Freien, hatten in der Regel nur eine Windschutzscheibe, bestenfalls noch ein Dach über dem Kopf und vielleicht eine niedrige Tür, die knapp gegen hochspritzenden Straßendreck schützte, aber ganz gewiss keine Seitenscheiben.
Der Beifahrer des ersten Fahrzeuges, es war ein weißer Renault, stieg vom Fahrerbock und öffnete die linke Fondtür. Eine weiß behandschuhte Frauenhand hob sich ihm entgegen, die er helfend in seine, in einem schwarzen Stulpenhandschuh steckende Hand nahm, um der Frau, zu der die Hand gehörte, das Aussteigen aus dem Fahrzeug zu erleichtern.
Cora sah zunächst einen riesigen, purpurfarbenen Hut mit einer ungeheuren, lila und weiß gestreiften, dreifachen Schleife. Ein Hut, groß wie ein Wagenrad … Das, was unter dem Hut zum Vorschein kam, war eine junge Dame von betörender Schönheit, deren feuerrotes Haar zu einer geschickten Knotenfrisur vereint unter dem Hut versteckt war. Sie war nach der neuesten Pariser Mode elegant in Weiß und Purpur gekleidet, in ein eng anliegendes Kostüm aus doppellagiger Seide, bestehend aus einem fast bodenlangen Rock, der den Beinen nicht viel Bewegungsfreiheit ließ und einem weißen Blazer mit zarten senkrechten purpurfarbenen Streifen und vollständig purpurfarbenen Revers aus Samt und purpurfarbenen, samtbezogenen Knöpfen. In Brusthöhe verzierte ein zwei Finger breiter purpurner Querstreifen aus Samt mit weißen, ebenfalls samtbezogenen Knöpfen den Blazer.
Es war Rose DeWitt Bukater, eine junge Frau aus gutem Hause, siebzehn Jahre alt – aber mit dem Benehmen einer thronerfahrenen Königin. Sie hob den Kopf und ließ ihren Blick aus unergründlichen grünen Augen mit einer gelangweilten Eleganz über das Schiff gleiten, die nicht weniger majestätisch war als das Schiff, das sie betrachtete. Um sie herum zerriss sich alles über die schiere Größe des schwimmenden Titans aus Holz und Stahl – aber sie ließ es völlig kalt.
Aus dem zweiten Wagen, einem silbergrauen Daimler Benz, stieg ein misstrauisch um sich blickender Mann, der sicher deutlich über fünfzig war, aber seine Bewegungen und sein stetes Sichern nach allen Seiten bewiesen, dass er ein Mann war, der für Sicherheit sorgte. Man hätte ihn sich gut als Leibwächter vorstellen können – und genau das war Spicer Lovejoy auch. Noch immer sichernd, öffnete er die Fondtür des Daimlers. Eine junge Frau mit Strohhut und blauem Cape stieg aus, in der Hand diverse kleinere Gepäckstücke.
„Ich versteh’ gar nicht, was die alle für ein Gewese machen. Sie sieht nicht viel größer aus als die Mauretania“, sagte Rose mit betonter Langeweile in der Stimme zu dem Mann, der hinter ihr aus dem Renault stieg – Caledon ‚Cal‘ Hockley, Roses Verlobter. Groß und schlank war er, das kurzgeschnittene, dunkle Haar unter einer dunkelbraunen Melone verborgen, gekleidet in einen eleganten, hellgrauen Anzug, am obersten Knopf in Brusthöhe geschlossen, aus dem ein weißes Hemd mit dunkler, gemusterter Krawatte und eine cremefarbene Weste herauslugten. Die hellen Farben seiner Kleidung betonten die sportliche Bräune seines glattrasierten Gesichtes. Cal war dreißig Jahre alt, sah durchaus gut aus, war unverschämt reich und unglaublich arrogant, künftiger Erbe des Stahlwerkbesitzers Nathan Hockley. Er sah den stählernen Giganten mit dem Blick dessen, der von dem Werkstoff, aus dem er gefertigt war, wenigstens eine Ahnung hatte. Schließlich machten die Arbeiter seines Vaters den lieben langen Tag nichts anderes als Stahl …
„Du magst vielleicht über andere Dinge spotten, Rose, aber nicht über die Titanic“, wies er Rose zurecht. „Sie ist über einhundert Fuß** länger als die Mauretania – und sehr viel luxuriöser! Hier gibt es Squashplätze, ein Pariser Café … sogar türkische Bäder.“
Er sah sich um. Hinter ihm entstieg Ruth DeWitt Bukater dem Renault. Sie mochte Mitte Vierzig sein, war in einen dunkelgrünen Samtmantel gekleidet, dem die Kostbarkeit auf Meilen anzusehen war. Aus dem mit Pelz besetzten Kragen lugte eine verschwenderisch mit Spitze dekorierte, hochgeschlossene, cremefarbene Bluse hervor, deren Stehkragen mit einer Art-Deco-Kamee gleichzeitig geschlossen und geschmückt wurde. Eine große Kappe aus schwerem, komplex gemustertem Stoff im russischen Stil, mit zwei besonders langen Hahnenschwanzfedern geschmückt, thronte wie eine Krone auf ihrem erkennbar lockigen, zu einer ausladenden Knotenfrisur geformten Haar, das mindestens ebenso rot war wie das ihrer Tochter. Die verwitwete Ruth DeWitt Bukater stammte aus einer der angesehensten Familien von Philadelphia und wirkte in ihrer ganzen Haltung nicht weniger königlich als Rose. Sie waren Amerikanerinnen, hatten aber über viele Generationen hinweg die Manieren der britischen Upper Class konserviert, die von ihren Vorfahren einst in die Neue Welt gebracht worden waren und in den reichen Familien der Neuenglandstaaten intensiv gepflegt wurden.
Cal nahm die Hand seiner Schwiegermutter in spe und half ihr galant aus dem Wagen.
„Es ist nicht leicht, Ihre Tochter zu beeindrucken, Ruth“, lächelte er. Ruths Blick ging hinauf zu dem weiß gestrichenen Teil der Titanic, dorthin, wo die Suiten wohl liegen mochten, die Cal kurzfristig doch noch hatte buchen können. J. P. Morgan, Besitzer der White Star Line, hatte eigentlich mit dem nagelneuen Stolz seiner Linie auf deren Jungfernfahrt gehen wollen, hätte in den von Hockley reservierten Suiten wohnen sollen, war aber durch eine Erkrankung gehindert worden.
„Das ist also das Schiff, von dem es heißt, es sei unsinkbar …“, murmelte sie nachdenklich.
„Es ist unsinkbar!“, versetzte Cal von hinten im Brustton der Überzeugung. „Gott selbst könnte dieses Schiff nicht versenken!“, verstieg er sich zu einem blasphemischen Vergleich. Ein Zupfen am linken Ärmel forderte seine Aufmerksamkeit, zu der er allerdings nicht in Stimmung war.
„Was?“, knurrte er, ärgerlich, von seinen Damen abgelenkt zu werden. Neben ihm war ein Einschiffungsoffizier der White Star Line aufgetaucht, der die undankbare Aufgabe hatte, die für ihre mangelnde Kooperationsbereitschaft bekannten Passagiere der Ersten Klasse auf gewisse vertragliche Verpflichtungen hinzuweisen. Keiner dieser Leute hatte den Ruf, sich um irgendetwas selbst zu kümmern, es sei denn, es handelte sich darum, Geld zu zählen – und selbst das überließen manche Berufserben gern Dienstboten.
„Sir, Ihr Gepäck muss am Hauptschalter aufgegeben werden. Das ist gleich dort vorne, Sir“, sagte der Einschiffungsoffizier. Hockley griff in die Hosentasche, fingerte einige zusammengerollte Geldscheine heraus, nahm einen davon, ohne auf den Wert zu sehen, steckte die anderen wieder weg und gab dem Mann den Schein – eine Fünf-Pfund-Note.
„Sie haben mein vollstes Vertrauen, guter Mann. Wenden Sie sich an meinen Kammerdiener!“, sagte er und wandte sich ab. Mit solchen Kleinigkeiten wollte er einfach nicht belästigt werden. Der Einschiffungsoffizier bekam große Augen. Fünf Pfund, das war ein wahrhaft fürstliches Trinkgeld. Es gab eine Menge Leute, die dafür lange schwer arbeiten mussten.
„Aber ja, Sir“, dienerte der Einschiffungsoffizier und eilte mit Verbeugungen hinter Cal her. „Ist mir ein Vergnügen Sir. Wenn es irgendwas gibt, was …“
Weiter kam er nicht. Lovejoy hatte ihm den rechten Arm um den Leib gelegt und drehte ihn unsanft um.
„Äh, ja, hier entlang …“, bremste er den diensteifrigen Mann und wies auf die Fahrzeuge und die Koffer. „Alle Koffer von dem Wagen hier, die zwölf von dem hier und der Safe kommen in die Suite B-52, 54 und 56“, erklärte er anhand eines Zettels, den Hockley ihm schon Stunden zuvor gegeben hatte.
Hockley selbst war schon wieder auf dem Weg zu Rose und Ruth. Er zog die Uhr aus der Westentasche. Es war zehn Minuten vor zwölf. Um zwölf Uhr sollte die Titanic ablegen und auf Jungfernfahrt gehen.
„Ladies … wir sollten uns beeilen. Kommt“, sagte er. Sie machten sich auf den Weg zur Gangway der Ersten Klasse zum D-Deck, vorbei an den brav in Warteschlangen stehenden Auswanderern, die vor den Augen der nach ihnen wartenden Passagiere Dritter Klasse auf Läuse und Krankheiten untersucht wurden.
„Alle Passagiere der Dritten Klasse begeben sich vor dem Einstieg bitte zur Gesundheitsuntersuchung an …!“, drang ein Ruf an Roses Ohr, den sie getrost ignorieren konnte. Er galt nicht ihr. Untersucht wurden selbstverständlich nur die Passagiere der Dritten Klasse, das Auswandererpack. Den Reisenden der Zweiten Klasse trauten Reederei und Behörden zu, sich öfter als gelegentlich zu waschen und die der Ersten Klasse waren über einen jeglichen Verdacht in Sachen Ungeziefer und Krankheiten sowieso erhaben …
„Mein Mantel?“, fragte Rose. Es war erst Anfang April, da konnte es noch frisch werden …
„Den hab’ ich, Miss“, sagte Trudy Bolt, eines der beiden Dienstmädchen, die Ruth und Rose DeWitt Bukater persönlich bedienten. Sie schleppte einige Gepäckstücke, die die letzten Einkäufe ihrer Arbeitgeberin Rose enthielten und viel zu kostbar waren, um von den groben Händen der Gepäckträger verstaut zu werden.
Sie passierten einen der Gesundheitsoffiziere, der einen Mann mit Vollbart auf Läuse untersuchte. In der behandschuhten Hand hatte er einen Kamm, mit dem er die dichten Kopfhaare des Mannes bereits untersucht hatte.
„Den Kopf kurz hoch“, wies er den Auswanderer an, der auch artig das Kinn hob. Mit dem Kamm teilte er den langen Vollbart und fahndete nach drohenden blinden Passagieren.
Auf dem weiteren Weg kamen sie an Daniel Marvin vorbei, einem gut gekleideten jungen Mann, der die Kurbel eines Kinemato-graphen** drehte, der auf einem Dreifuß montiert war. Er filmte seine junge Ehefrau, die vor der Titanic stand.
„Sieh zum Schiff hinauf, Liebling, das ist es!“, rief er. „Du bist fasziniert! Du kannst nicht glauben, wie groß es ist!“, gab er ihr Regieanweisungen. „Wie ein Berg. Das ist großartig.“
Mary, seine Frau, reagierte zwar, aber nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte. Der Film war noch ein junges Medium, Mary hatte damit keine Erfahrung. Sie kannte bisher nur Fotografien, die im Wortsinne auf die Platte gebannt wurden – und dafür durfte man sich um nichts in der Welt bewegen. Sie hob nur die Hände präsentierend nach oben wie in einer Pantomime, dann regte sich keine Faser mehr in ihrem Körper.
Cal und seine künftige Familie gingen weiter, bahnten sich den Weg durch die wartenden Auswanderer. Nicht jeder machte ihnen respektvoll Platz. Zwei der Jungen, die auf den Einstieg in die Dritte Klasse warteten und sich die Zeit mit lautstarken Rangeleien vertrieben, prallten gegen Hockley. Bevor er etwas sagen konnte, bekam er einen weiteren Schubs, als der Vater der Jungen gegen ihn prallte.
„He, Vorsicht!“, fuhr Cal ihn an.
„Sorry, Sire“, bat der Vater halbherzig um Entschuldigung und hetzte weiter hinter seinen ungezogenen Bengeln her.
„Zwischendeckschwein!“, pöbelte Hockley hinter ihm her. „Hat offensichtlich sein jährliches Bad verpasst“, wandte er sich dann naserümpfend an Ruth.
„Um ehrlich zu sein, Cal, wenn Sie nicht immer alles auf den letzten Drücker buchen würden, hätten wir bequem durch das Terminal gehen können, statt wie eine armselige Auswandererfamilie durch das Dock zu laufen“, beschwerte sie sich.
„Gehört alles zu meinem Charme“, erwiderte er mit einem jungenhaften Lächeln. „Jedenfalls war es diesmal das Schönheitsritual meiner allerliebsten Verlobten, das uns die Verspätung eingetragen hat“, verteidigte er sich.
„Du hast mich doch genötigt, mich umzuziehen!“, protestierte Rose ärgerlich.
„Ich konnte es nicht zulassen, dass du auf der Reise schwarz trägst. Das bringt Unglück, meine Süße.“
„Mir war nach Schwarz“, versetzte sie eisig. Cal lotste seine Damen aus dem Weg eines von Pferden gezogenen Wagens, der mit zwei Tonnen Orangenmarmelade aus Oxford beladen war, die für das Proviantlager der Titanic bestimmt war.
„Ich setze alle Hebel in Bewegung, damit wir in den luxuriösesten Kabinen auf dem größten Schiff aller Zeiten reisen können – und du tust so, als gingest du zu deiner Hinrichtung!“, hielt er Rose vor.
Nur mit einigem Ziehen ließ sie sich auf die Gangway der Ersten Klasse manövrieren. Ihre Mutter ging vor ihr hinauf und vermittelte den Eindruck einer russischen Großfürstin, wenn nicht gar der Zarin selbst, so wie sie hinauf schritt. Vor ihnen erreichte ein ebenfalls unübersehbar reiches Paar den Einstieg. Sie hatten zwei afghanische Windhunde bei sich.
„Willkommen an Bord“, begrüßte sie der ältere Steward, der rechts vom Einstieg stand.
„Willkommen auf der Titanic“, grüßte auch der Jüngere auf der linken Seite. Ruth sprach mit dem älteren Steward.
„Für alle anderen war es ein Traumschiff“, erzählte die alt gewordene Rose ihren gespannten Zuhörern auf der Keldysh. „Für mich war es ein Sklavenschiff, das mich in Ketten nach Amerika zurückbringen sollte. Nach außen war ich das wohlerzogene Mädchen, das ich sein sollte. In meinem Inneren hab ich geschrien.“
In einem verräucherten Pub am Dock saßen oder standen Dockarbeiter und Personal der White Star Line, die sich in der Mittagspause oder nach Feierabend noch einen Drink gönnten oder auch zwei. Auch manche Fahrgäste der White-Star-Schiffe nutzten den Pub als Wartesaal der Dritten Klasse. Direkt am Fenster saßen vier Männer in Arbeiterkleidung am Tisch bei einem Pokerspiel. Zwei davon, Olaf und Sven Gundersen, waren Schweden, die nach Amerika auswandern wollten. Sie mochten Mitte zwanzig bis Anfang dreißig sein. Die beiden anderen waren deutlich jünger, so um die Zwanzig. Einer, Fabrizio de Rossi, hatte südländisches Aussehen, der andere, Jack Dawson, eher nord- oder mitteleuropäisches Aussehen. Für seine zwanzig Jahre hatte er ein erstaunlich selbstsicheres Auftreten. Das dunkelblonde Haar trug er etwas länger, als die gängige Mode es zuließ, er war nicht besonders gut rasiert, was bei seinen blonden Bartstoppeln aber eher wenig auffiel. Seine Kleidung war ebenso zerknittert wie die von Fabrizio – Folge der Tatsache, dass sie in ihren Kleidern geschlafen hatten. Die beiden jüngeren Männer waren gute Freunde. Jack war Amerikaner, Fabrizio Italiener. Der eine wollte nach Hause, der andere in die weite Welt, vorzugsweise in das Land der angeblich unbegrenzten Möglichkeiten, nach Amerika.
Das Spiel dauerte schon eine Weile. In der Mitte des Tisches hatte sich ein beachtlicher Pott angesammelt. Obenauf lagen ein Taschenmesser, eine Taschenuhr – und zwei Fahrkarten Dritter Klasse auf der Titanic. Olaf trank seinen Whisky aus, schüttelte den Kopf und machte seinem Cousin in seiner Muttersprache Vorwürfe, weil der die Fahrkarten gesetzt hatte. Sven konterte, dass Olaf schon einiges an Geld verloren hatte und er das nun zurückholen wollte.
Fabrizio war mit Jacks Einsatzpolitik auch nicht richtig einverstanden.
„Jack, testa di cazzo!“, maulte er drastisch. „Das ist alles, was wir haben!“
Jack machte es nichts aus, als Arschloch tituliert zu werden, solange es außer ihm selbst und Fabrizio niemand verstand. Er erlaubte sich ein leichtes Lächeln.
„Wenn du nichts hast, dann kannst du auch nichts verlieren“, munterte er den Freund auf und wandte sich an den Auswanderer, der ihm direkt zu Rechten saß:
„Sven?“
Der Schwede prüfte seine Karten.
„Karte“, sagte er. Jack gab ihm die verlangte Karte vom Stapel, nahm selbst auch eine und legte eine andere dafür verdeckt ab. Fabrizio und Olaf wollten keine weitere Karte. Jack atmete tief durch. Alles war gesetzt.
„Also gut. Der Augenblick der Wahrheit. Für irgendjemanden beginnt ein neues Leben“, sagte er. „Fabrizio?“
Der dunkelhaarige junge Mann mit der Schiebermütze deckte auf.
„Niente“, kommentierte Jack den Gemischtwarenhandel von Karten seines Freundes.
„Niente!“, wiederholte der Italiener gereizt. Er war nahe daran, Jack Ohrfeigen zu verpassen.
„Olaf?“, forderte Jack den älteren der beiden Schweden auf. Auch Olafs Karten gaben nichts her.
„Nichts“, war Jacks lakonischer Kommentar.
„Sven?“, forderte er den zweiten Nordmann auf. Sven legte seine Karten auf den Tisch.
„Zwei Paare … oh, oh …“, brummte Jack. Fabrizio wurde zusehends nervöser. Das hörte sich irgendwie gar nicht gut an …
„Tut mir Leid, Fabrizio …“, setzte er an. Der heißblütige Italiener explodierte:
„Ma che Leid? Testa di cazzo!“, wiederholte er die wüste Beschimpfung von vor zwei Minuten. „Du hast unser ganzes …“
Weiter kam er nicht, weil Jack sich mit beruhigender Geste zu ihm herüber beugte.
„Es tut mir Leid …“, wiederholte der. „Du wirst deine Mama für sehr lange Zeit nicht sehen. Denn wir fahren nach Amerika!“ Er deckte seine Karten auf. „Full House, Männer! Woohoo!“, jubelte der junge Amerikaner. Fabrizio brauchte noch einige Sekunden, ehe er begriff, was gerade geschehen war. Ebenso wie die beiden Schweden, die Jack völlig entgeistert ansahen und ihre Zukunft in Amerika im Wortsinne davon schwimmen sahen.
Als der Penny bei ihm endlich gefallen war, sprang Fabrizio auf und tanzte jubelnd durch den Raum.
„Dio mio, grazie!“, dankte er dem Herrgott persönlich für ihr unverschämtes Glück. Während der junge Italiener sich vor Freude fast nicht mehr einkriegte, langte Olaf mit der Linken blitzschnell quer über den Tisch und bekam Jack an der Jacke zu fassen, ballte die Rechte zu einer Faust. Jack ging angesichts der Drohung, diese eisenharte Bauernfaust gleich zwischen den Zähnen zu haben, mit zusammengekniffenem linkem Auge in Deckung. Mit einer schwedischen Beschimpfung ließ Olaf die Faust auf eine schnelle Reise gehen – allerdings bog sie kaum eine halbe Armlänge vor Jacks Gesicht nach links ab und traf den völlig unvorbereiteten Sven, der samt seinem Stuhl umfiel. Olaf ließ Jacks Jacke wieder los und prügelte voller Wut auf seinen am Boden liegenden Vetter ein, der überhaupt nicht wusste, wie ihm geschah.
Erleichtert zog Jack sich vom Tisch zurück.
„Na, komm schon!“, forderte er seinen Freund auf, der immer noch mit zwei Hand voll Geld durch den Raum tanzte.
„Ich fahr’ nach Hause!“, jauchzte Jack. Er und Fabrizio fielen sich in die Arme, tanzten umeinander.
„Ich fahr’ nach Amerika!“, johlte Fabrizio.
Die anderen Gäste verfolgten die Explosion purer Freude mit einem Grinsen im Gesicht. Das breiteste Grinsen hatte der Pubkeeper, der mit dem Gläsertuch in der Hand mit dem rechten Daumen auf die Wanduhr hinter sich wies.
„Nein, Kumpel, die Titanic fährt nach Amerika – in fünf Minuten“, lachte er. Die jungen Glückspilze sahen erschrocken auf die Uhr. Sie zeigte wahrhaftig fünf vor zwölf!
„Scheiße, Fabri! Wir müssen uns beeilen!“, trieb Jack den Italiener entsetzt an.
„Andiamo! Andiamo!“, scheuchte Fabrizio sich selbst und seinen amerikanischen Kumpan auf. Sie rafften eilig ihren Gewinn zusammen, steckten ihn nachlässig in die Taschen, Jack schnappte sich die Fahrkarten, sie warfen sich ihre Rucksäcke über, dann rannten sie aus dem Pub und fegten über die Pier wie zwei entfesselte Wirbelwinde. Sie schlugen Haken, umkurvten Passanten und immer noch wartende Fahrgäste, tauchten unter der Gangway zur Ersten Klasse durch.
„Wir reisen mit ganz großem Stil! Zwei wohlhabende junge Männer! Wir sind damit so gut wie Könige, ragazzo mio!“, verkündete Jack lauthals, als sie zur Gangway der Dritten Klasse am Ende des Schiffes hetzten.
„Siehst du? Und wie ich dir schon gesagt habe: ich fahr’ nach Amerika und werde Millionär! Du cazzo!“, schrie Fabrizio seine Pläne und seine Freude über das geschenkte Leben heraus.
„Vielleicht!“, lachte Jack. „Aber ich hab’ die Fahrkarten! Ich dachte, du bist ein guter Läufer?“, neckte er seinen Freund im Rennen.
„Aspetta!“, japste Fabrizio, der vor lauter Jauchzen fast keine Luft mehr bekam. Jack sprintete weiter und erhöhte noch einmal das Tempo, als er sah, dass die Gangway schon weggezogen wurde.
„Warten Sie! Warten Sie! Wir sind Passagiere! Wir sind Passagiere!“, schrie er und sprang auf die schon halb abgezogene Brücke, Fabrizio landete nur einen halben Yard hinter ihm auf der Gangway. Zwischen dem Schiff und der Gangway war schon ein Yard Zwischenraum, als das Hafenpersonal einhielt.
In der offenen Einstiegsluke stand der Sechste Offizier Moody, der die Fahrkarten der Einsteigenden an dieser Stelle geprüft hatte.
„Sind Sie schon bei der Untersuchung gewesen?“, fragte er.
„Natürlich … Wir haben sowieso keine Läuse. Wir sind Amerikaner, mein Freund und ich“, schwindelte Jack geflissentlich. Moody seufzte.
„Na, schön … kommen Sie an Bord“, winkte er beide herein. Die Brücke wurde endgültig weggezogen und die Luke geschlossen.
Kapitel 5
Man richtet sich ein
Moody winkte die jungen Männer beiseite und lotste sie zu Quartiermeister Rowe. Rowe ließ sich die Fahrkarten zeigen, um ihnen die Kabinen anzuweisen. Anders als die Passagiere der Ersten Klasse, die von vornherein bestimmte Kabinen buchten, waren die Passagiere der Dritten Klasse das, was im öffentlichen Personennahverkehr noch hundert Jahre später Beförderungsfall genannt werden würde – wenig mehr als Vieh, das transportiert wurde. Beförderungsfälle bekamen ihre Plätze zugewiesen und suchten sie sich nicht etwa aus …
Rowe sah auf Jacks Ticket den Namen Gundersen und nahm dies hin, ohne mit der Wimper zu zucken. Jack war blond und blauäugig, konnte also gut für einen Skandinavier durchgehen.
„Gundersen und …“, murmelte er und schaute auf Fabrizios Fahrschein. Der Name dort ließ Rowes Augenbrauen nach oben schnellen, als er wieder zu dem Passagier sah.
„… Gundersen???“, entfuhr es ihm zweifelnd, als er das mediterrane Äußere de Rossis realisierte. Fabrizio bekam weiche Knie, aber Jack schaltete sofort.
„Komm, Sven!“, sagte er und griff nach Fabrizios Arm. Sollte der Quartiermeister Rowe weiter Zweifel haben, wollte er ihm erzählen, dass sein Cousin Sven eine italienische Mutter hatte … Doch Rowe schien die Erklärung schon zu ahnen und gab die Karten zurück.
„Kabine G-60“, sagte er und hakte die Passagiere ab.
Die beiden jungen Männer stürmten durch die Gänge, wie um ganz sicher zu sein, nicht wieder hinausgeworfen zu werden, falls Rowes Verdacht erneut hochschwimmen sollte und er vielleicht noch Ausweispapiere verlangte.
„Wir sind die allergrößten Glücksschweine der Welt, weißt du das?“, jubelte Jack und knuddelte Fabrizio, während sie zum Bootsdeck tanzten und sprangen. Sie nahmen sich nicht die Zeit, gleich ihre Kabine aufzusuchen. Jack platzte fast vor Lebensfreude und brauchte dafür dringend ein Ventil.
Während sie den Zugang zum Bootsdeck suchten, das als einziges Außendeck auch für die Passagiere der Dritten Klasse zugänglich war, warfen die Festmacher die Trossen los, die die Titanic an der Pier festhielten. Mit einem langgezogenen Tuten des Typhons, des tief tönenden Nebelhorns, verabschiedete sich die Schiffsführung von Southampton. Die meisten Passagiere standen an der Backbordreling auf dem Bootsdeck oder auf den Freidecks des A- und B-Decks und winkten, riefen Abschiedsgrüße an die zurückbleibenden Angehörigen und sonstigen Leute, die am Kai standen und ebenfalls winkten.
Schlepper zogen das riesige Schiff nach Steuerbord von der Pier weg. Langsam vergrößerte sich der Abstand zur Kaimauer.
Jack und Fabrizio stürzten auf den achteren Teil des Bootsdecks, wo sie rasch noch eine freie Stelle an der Backbordreling fanden. Jack stieg sogar noch auf die unterste Sprosse und winkte heftig den Zurückbleibenden zu.
„Auf Wiedersehen!“, schrie er.
„Kennst du da jemanden?“, fragte Fabrizio verblüfft.
„Natürlich nicht!“, entgegnete Jack strahlend. „Aber darum geht’s nicht!“ Er wedelte erneut hinunter. „Lebt wohl! Ihr werdet mir fehlen!“
Fabrizio überlegte nicht länger. Auch er winkte wie verrückt nach unten, ohne jemand Bestimmtes zu meinen.
„Lebt wohl!“, schrie er.
„Lebt wohl!“, brüllte Jack.
„Ich werde euch niemals vergessen!“, schrie de Rossi.
Auf der ganzen Backbordseite wurde gewunken und gerufen, vom feinen A-Deck bis zum mit Dritter-Klasse-Passagieren proppenvollen C-Deck, vom Bug bis zum Heck der Titanic. Die Menschen unten auf der Pier erwiderten die Grüße vom Schiff und wünschten eine gute Reise auf der Jungfernfahrt dieses ebenso riesigen wie wunderschönen Schiffs.
Als die Schlepper die Titanic weit genug vom Kai abgezogen hatten, wurden die Schraubenwellen mit den stampfenden Kolben der Dampfmaschinen gekoppelt und drei unglaublich große Schrauben begannen, sich zu drehen. Unter der Titanic war nicht viel Platz bis zum Grund des Docks. Es war beinahe die sprichwörtliche Handbreit Wasser unter dem Kiel. Die Titanic hatte immerhin einen Tiefgang von über dreißig Fuß, gut zehneinhalb Meter. Die jeweils vier Propellerblätter je Schraube wirbelten schon nach der ersten Umdrehung Sediment auf, das bis an die Oberfläche gedrückt wurde. Mit eigener Maschinenkraft, aber immer noch zusätzlich von den Schleppern gezogen, ging das gewaltige Passagierschiff in See.
Nicht weit vom Dock der White Star Line entfernt segelte ein zweimastiger Kutter seewärts, den die Titanic an Steuerbord überholte. Der Führer des Kutters konnte sein im Vergleich zu dem wahren Titanen von Stahlschiff zwergenhaftes Boot gerade noch nach Steuerbord wenden, damit ihn die Bugwelle des Riesen nicht querab erwischte und zum kentern brachte.
Nachdem das Schiff den Hafen verlassen hatte und seinem ersten Zwischenstopp in Cherbourg entgegenfuhr, suchten die Passagiere ihre Kabinen auf, um sich einzurichten. Die Reise nach New York sollte sieben Tage dauern, die Ankunft war für den Morgen des 17. April 1912 geplant. Eine volle Woche würden die Reisenden auf dem Schiff verbringen. Da sollte alles so wohnlich wie möglich sein.
Jack und Fabrizio verließen das Achterdeck und stiegen hinunter zum G-Deck, wo ihre Kabine war. In den schmalen Gängen herrschte ziemliches Durcheinander von Leuten, die in dem regelrechten Labyrinth aus sich kreuzenden Gängen umherirrten und ihre Kabinen suchten. Es wurde in den unterschiedlichsten Sprachen gemurmelt und laut gesprochen, nicht wenige hatten Wörterbücher in den Händen, um sich die Beschriftungen an den Ecken zu übersetzen. Manche von ihnen mussten sogar die Schrift erst in ihre eigenen Zeichen umsetzen, um die Wegweisung zu verstehen.
Eine Mutter mit zwei Kindern, einem Jungen und einem Mädchen, die fünf oder sechs Jahre alt sein mochten, sah suchend auf die Anzeigen und schob ihre Kinder weiter.
„Na, lauft schon!“, trieb sie die Kleinen an. „Wir müssen nach links.“
Aus der Richtung, in die diese Familie musste, kamen Jack und Fabrizio.
„G-60“, murmelte Jack. „G-60, G-60“, wiederholte er die Kabinenbezeichnung wie um sie auf gar keinen Fall zu vergessen. An der nächsten Ecke stand ein asiatisch aussehender Passagier und versuchte, die ihm fremden Schriftzeichen zu entziffern, genau gegenüber öffnete ein Mann mit osteuropäischem Aussehen die Tür zu seiner Kabine. In diesem Moment erreichte die Familie die Ecke und schwenkte in den Gang nach links ein, aus dem Jack und Fabrizio ihnen entgegenkamen. Durch den ratlosen Asiaten auf der einen Seite und den Osteuropäer auf der anderen Seite war der Gang stark verengt, so dass Jack mit der Mutter zusammenstieß.
„Oh, Verzeihung!“, bat er um Entschuldigung und hastete weiter geradeaus zur nächsten Einmündung. Dort fand sich ein Hinweis, dass ihre Kabine im Gang hier rechts liegen musste.
„G-60“, brummte er erneut und bog in den Gang ein. Gleich die erste Tür auf der linken Seite ihrer Laufrichtung trug die gesuchte Beschriftung.
„Oh, hier ist es ja!“, frohlockte Jack und öffnete die Tür. Dahinter präsentierte sich eine vollkommen neue, noch nach knapp getrockneter Farbe riechende Kabine, die im Vergleich zu anderen Auswandererschiffen großzügig bemessen war und für eine Dritter-Klasse-Kabine überaus gut ausgestattet war. Vier Betten in Form von zwei Doppelstockbetten standen an den Seiten, das jeweils obere Bett war mit einer Reling ausgestattet, damit der darin Schlafende nicht bei Seegang einen tiefen Fall erlebte. Ein Bullauge, das Tageslicht hereinließ, bewies, dass diese Kabine – anders als auf anderen Schiffen – nicht unter der Wasserlinie lag. Elektrisches Licht erhellte die Kajüte zusätzlich, eine Zentralheizung sorgte für Wärme – auf anderen Schiffen ein undenkbarer Luxus in der Dritten Klasse. Obendrein boten eine Waschkommode mit fließendem Wasser und einem großen viereckigen Spiegel sowie ein ausklappbarer Tisch den gleichfalls ungeheuer erscheinenden Luxus, die Kabine zum Waschen und Rasieren nicht verlassen zu müssen, ja, nicht einmal Wasser aus einer Kanne zum Waschen in eine Schüssel gießen zu müssen.
Üblicherweise wurden Dritter-Klasse-Passagiere in flächenmäßig großen, aber niedrigen Frachträumen untergebracht, in denen an den Wänden längs doppelt, wenn nicht dreifach gestapelte Kajütbetten angebracht waren und querhängende Hängematten die Unterbringung von noch mehr Passagieren ermöglichten. Je mehr Menschen auf möglichst wenig Raum untergebracht werden konnten, desto höher war der Profit des Reeders. Auf der Titanic hatte die Reederei aber selbst den Passagieren der Dritten Klasse Kabinen einrichten lassen, die deren bisherige Wohnung mit Längen schlug. Das hier war für die einfachen Menschen, die die Auswanderer in der Regel waren, der pure Luxus, schier ein Schloss auf hoher See, strahlend weiß und blitzsauber.
Als Jack und Fabrizio in die Kabine stürmten, waren bereits zwei Passagiere anwesend, Björn und Olaus Gundersen, die die beiden Neuankömmlinge verblüfft ansahen, hatten sie doch jemand ganz anderen erwartet. Jack ging in seiner offenen Art gleich auf die beiden anwesenden Passagiere zu.
„Tag! Wie geht’s denn so? Jack!“, stellte er sich vor. Olaus sah verwirrt auf die Hand des jungen Amerikaners und kam gar nicht dazu, etwas zu antworten, denn Jack akzeptierte auch sein nordmännisches Schweigen als Willkommensgruß in der Kabine.
„Freut mich sehr!“, setzte er hinzu und wandte sich gleich an den zweiten Anwesenden:
„Jack Dawson! Freut mich, euch kennen zu lernen! Alles klar?“, begrüßte er auch ihn.
Fabrizio hatte sich etwas pragmatischer gleich ein Bett ausgesucht ohne lange zu fragen, ob es noch frei war. Er warf sein Bündel auf das obere Bett rechts von der Kajütentür und stieg gleich hinauf, um seine Besitzansprüche deutlich anzumelden. Jack drehte sich um.
„Wer sagt, dass du oben schläfst?“, lachte er scherzend und kitzelte Fabrizio.
Die beiden Schweden sahen sich verstört an.
„Wo ist Sven?“, fragte Björn auf Schwedisch.
Fünf Decks höher bezogen Rose DeWitt Bukater, ihre Mutter und Caledon Hockley ihre Suiten B-52 bis B-56. Kammerdiener Lovejoy dirigierte die Gepäckträger in die Räumlichkeiten, einer der Stewards für den Zimmerservice servierte Champagner in edlen Champagnertulpen. Cal nahm sich eines der Sektgläser und eine Champagnerflasche und ging hinaus auf das zur Suite gehörende Promenadendeck. Es war mit einigen Palmen in Blumenkübeln sowie diversen Sesseln und Liegen aus Rattan üppig ausgestattet. Der Steward eilte dienstfertig hinterher, um dem reichen Fahrgast seine Suite angemessen zu präsentieren. Allein dieses nur von dieser Suite zugängliche Promenadendeck hatte eine Länge von etwa fünfzig Fuß, gut fünfzehn Meter. Das Innere der Suite war im Empire-Stil eingerichtet und bestand aus zwei getrennten Schlafräumen, einem Bad, einem zusätzlichen WC, einem Ankleidezimmer und einem gewaltigen Wohnraum.
„Das ist Ihr privates Promenadendeck, Sir. Haben Sie noch irgendeinen Wunsch?“
Cal wehrte mit einem verneinenden Brummen und einer wegwerfenden Handbewegung ab, peilte aus dem Fenster des Promenadendecks hinunter.
„Entschuldigen Sie mich“, verabschiedete sich der Steward, um im Wohnraum noch nachzuschenken, falls es gewünscht wurde.
An der Stirnseite des Wohnraums prangte ein Kamin, in dessen aus blankpoliertem Messing und weißen Schamottesteinen bestehender Feuerkassette noch nie ein Feuer gebrannt hatte. Die Kohlen waren jedoch schon soweit vorbereitet, dass sie nur noch angezündet werden mussten, um zusätzlich zur ohnehin vorhandenen Zentralheizung noch wohlige Kaminwärme zu bieten. Eine der beiden Zofen stellte eine Vase mit einem kunstvoll gebundenen Strauß frischer Schnittblumen auf den Kaminsims
Rose stand mit Zofe Trudy vor einer der großen Reisekisten, die jetzt geöffnet war. Darin befanden sich zahlreiche großformatige Bilder, die Rose mit Cals Geld in Paris eingekauft hatte. Darunter waren impressionistische Kunstwerke wie ein Monet mit Wasserlilien, ein Degas mit Tänzern und diverse abstrakte und kubistische Werke. Sie nahm eines der Bilder nach dem anderen heraus und betrachtete sie, als ob sie etwas Bestimmtes suchte.
„Dieses hier?“, fragte Trudy und zog ein weiteres Bild aus der Kiste.
„Nein“, erwiderte Rose nachdenklich. „Dieses hatte ganz viele Gesichter drauf. Das hier ist es!“
Sie zog das Bild ganz heraus und betrachtete es intensiv.
„Ah“, bemerkte Trudy. „Möchten Sie alle Bilder auspacken?“, erkundigte sie sich.
„Ja … wir brauchen etwas Farbe in diesem Zimmer“, erwiderte Rose.
Lovejoy lotste unbeeindruckt von seiner eher unkonventionell auspackenden künftigen Arbeitgeberin die Gepäckträger.
„Aah – bringen Sie das ins Ankleidezimmer“, wies er den Träger an, der gehorsam in das Ankleidezimmer abbog.
Cal kehrte von seiner ersten Entdeckungstour vom Promenadendeck in den fast vollständig mit dunkelrotbraunem Holz – vermutlich Mahagoni – getäfelten Raum zurück, dessen Wanddekoration mit Schnitzereien geschmückt war, die ebenso dezent wie verschwenderisch mit Blattgold belegt waren. Als er sah, dass seine Verlobte die Bilder auspackte, die er ihr zwar gekauft hatte, aber weder verstand noch mochte, verdrehte er gereizt die Augen.
„Aaach, nicht doch wieder diese Fingerzeichnungen!“, schnaufte er entnervt. „Die waren die reinste Geldverschwendung!“
Rose stellte das Bild auf dem Sofa ab und nahm ein weiteres aus der Kiste, sah stur auf das Bild, das sie in den Händen hielt. Cals Reue bezüglich dieser Bilder kam etwas spät – sie hatte die Bilder, die sie haben wollte …
„Der Unterschied zwischen Cals Kunstgeschmack und meinem ist, dass ich welchen habe“, ätzte sie selbstbewusst. „Sie sind faszinierend. Es ist, als befände man sich in einem Traum“, kommentierte sie die beiden Bilder, eines in Blautönen im kubistischen Stil und jenes mit den zahlreichen Gesichtern, ebenfalls in pastellenen Blau- und Rosatönen.
Hinter ihr dirigierte Lovejoy den nächsten Gepäckträger in eines der Zimmer.
„Es hat Wahrheit, aber keine Logik“, bemerkte sie. Nein, logisch war die in Würfel und Quader aufgelöste Darstellung einer menschlichen Büste im Herrenanzug wahrhaft nicht, dennoch war erkennbar, dass hier ein Mensch dargestellt wurde. Rose nahm ein bereits ausgepacktes Bild ohne Rahmen zur Hand. Es war das Tänzerbild von Degas.
„Wie heißt der Künstler überhaupt?“, erkundigte sich Trudy.
„Irgendwas mit … äh … Picasso“, gab Rose Auskunft. Cal ließ ein spöttisches Lachen hören.
„Hehehe … Irgendwas mit Picasso!“, äffte er seine Verlobte nach. „Aus dem wird nichts! Niemals! Glaub’ mir!“
Rose ignorierte ihn. Cal hatte nach ihrer Ansicht keine Ahnung von Kunst und würde nie begreifen, welche Faszination für sie gerade von diesen nicht auf den allerersten Blick erkennbaren Bildern ausging.
„Bringen wir den Degas ins Schlafzimmer!“, entschied sie und verschwand mit dem ungerahmten Bild im Schlafzimmer. Cal blieb mit einem tiefen Seufzer zurück und leerte das Champagnerglas nach einem spöttischen Blickwechsel mit Lovejoy.
„Na, wenigstens waren sie billig“, brummte er.
„Der kommt auch nach nebenan!“, wies Lovejoy den nächsten Gepäckträger ein, der mit dem Safe auf einer Sackkarre in die Suite kam.
Rose stellte den großen Degas auf der Kommode neben dem Himmelbett ab. Trudy war ihr gefolgt und hängte einige der Roben ihrer Arbeitgeberin in den Kleiderschrank.
„Es riecht alles so ganz neu“, bemerkte die Zofe. „Als ob sie das nur für uns gebaut hätten. Ich meine … wenn ich daran denke, dass ich, wenn ich heute Abend zwischen die Laken krieche, die Erste bin, die das hier tut …“
Der Blick der Zofe traf auf die Tür, in der Cal stand und Rose mit unübersehbarem Begehren ansah.
„Und wenn ich heute Abend zwischen die Laken schlüpfe, werde ich immer noch der Erste sein“, ließ er eine äußerst anzügliche Bemerkung fallen, die Trudy die Röte ins Gesicht trieb.
„Entschuldigen Sie mich, Miss“, knickste Trudy und verschwand rasch aus dem Schlafzimmer. Sie kam knapp um Cal herum, so eilig hatte sie es. Der betrat das Schlafzimmer, trat hinter Rose und legte ihr beide Hände auf die Schultern. So, wie er es tat, war es kein Ausdruck von Zärtlichkeit oder gar Intimität, sondern eher ein Akt von Inbesitznahme.
„Der Erste und Einzige“, sagte er. „Für immer.“
Rose hatte einen Ausdruck im Gesicht, der deutlich machte, was für düstere Aussichten seine Worte für sie bedeuteten.
Die Titanic erreichte Cherbourg gegen Abend des 10. April 1912. Die Passagiere wurden mit dem Zubringerschiff Nomadic zu der auf Reede liegenden Titanic gebracht, von wo aus zumindest die Passagiere der Ersten Klasse auf bequemen Brücken den Einstieg im D-Deck erreichen konnten. Die Nomadic war ein einhundertfünfzig Fuß langer Tender, fast fünfzig Meter lang; aber neben der Titanic wirkte sie wie ein Beiboot.
„In Cherbourg stieg eine Frau namens Margaret Brown an Bord. Wir nannten sie aber alle Molly. In die Geschichte ging sie ein als die Unsinkbare Molly Brown“, erzählte Rose auf der Keldysh.
Molly Brown war eine ebenso stabile wie resolute Frau von etwa fünfundvierzig Jahren, die sich trotz ihres offensichtlichen Reichtums nicht scheute, ein Gepäckstück auch mal selbst in die Hand zu nehmen, bevor sie gefühlte Ewigkeiten auf einen dienstbaren Geist wartete. Der Page, der zu ihr eilte, bekam einen hochroten Kopf, als er realisierte, dass sie ihr Gepäck selbst an Bord gebracht hatte. Diese Geldadligen konnten ziemlich unangenehm werden, falls der eigentlich erwartete dienstbare Geist nicht augenblicklich zur Stelle war, wenn Gepäck zu befördern war.
„Ich hatte keine Lust, den ganzen Tag auf dich zu warten, Kleiner“, grinste Molly und drückte ihm einen kleinen Koffer in die Hand, den größeren pickte der Page selbst auf.
„Entschuldigung“, flehte der junge Mann um Vergebung. Molly lächelte verschmitzt. Wenn es jemanden zwischen dem A- und dem C-Deck an Bord gab, der für menschliche Schwächen Verständnis hatte und sie eher mit derbem Humor nahm, dann war es Margaret Brown.
„Ich hoffe, das ist nicht zu schwer für dich, Kleiner“, spottete sie.
„Ganz bestimmt, Madame“, erwiderte der Page, der spürte, dass diese Frau nicht böse meinte, was sie sagte. Molly eilte weiter zum Fahrstuhl.
„Hey, Jig!“, rief sie dem Fahrstuhldiener zu, der auch schon den Fahrstuhl bremste, aber Molly eilte am ersten Fahrstuhl vorbei zum nächsten, aus dem ihr Rose und Ruth DeWitt Bukater entgegenkamen.
♦♦♦
„Ihr Mann war irgendwo im Westen auf Gold gestoßen, und sie war – wie meine Mutter es zu bezeichnen beliebte – neureich“, kommentierte die alte Rose auf der Keldysh diese Begegnung, wobei sie das letzte Wort besonders spöttisch betonte. Der alte Geldadel, zu dem ihre Mutter gehört hatte, nahm Neureiche, die sich den überkommenen Gepflogenheiten des alten Geldes nicht anpassen wollten, nicht für voll. „Am nächsten Nachmittag dampften wir von der Westküste Irlands Richtung Westen. Es lag nichts weiter vor uns als der unendliche Ozean.“
Jeder, der ihrer Erzählung auf der Keldysh lauschte, meinte, die kräftig dampfende Titanic einsam auf dem gewaltigen Atlantik gen Westen fahren zu sehen.
♦♦♦
Kapitel 6
Wohin man gehört
Am Freitag, den 12. April 1912, war die Titanic völlig allein mitten im Blau des Atlantischen Ozeans unter dem Frühlingsblau des unendlich erscheinenden Himmels, der am Horizont schier ins Wasser tauchte. Ein Gelb-weiß-schwarzer Zwerg in einer ebenso unendlichen Wasserfläche. Ein feiner weißer Strich, wie mit dem Lineal gezogen, markierte über wenigstens eine ganze Seemeile* den Weg der Titanic. Ein weiterer feiner Strich – zuerst schwarzgrau, dann heller werdend und sich verflüchtigend – dokumentierte den Vortrieb des Schiffes durch kräftige, von brennender Kohle angetriebene Dampfmaschinen.
William Murdoch, der Erste Offizier, stand an der Reling auf der Steuerbordseite des Steuerhauses und sah über das weite Meer. Murdoch war neununddreißig Jahre alt und gehörte mit zwölf Jahren Betriebszugehörigkeit zu den erfahrenen Offizieren der Reederei. Inzwischen hatte er mit einiger Mühe verdaut, dass er den ersehnten Posten des Leitenden Offiziers, des Ranghöchsten nach dem Captain, noch nicht bekommen hatte. Der Captain hatte einen seiner früheren Leitenden, Henry Wilde, von der Olympic mitgebracht und ihm den verantwortungsvollen Posten gegeben. Murdoch und sein Kollege Lightoller hatten jeweils einen Rang hergeben müssen und waren davon nur mäßig begeistert gewesen.
Captain Edward John Smith trat neben ihn. Smith war zweiundsechzig Jahre alt und galt als der wohl erfahrenste und beliebteste Kapitän der White Star Line. Die Titanic war nach Britannic, Majestic, Baltic, Adriatic und Olympic das sechste Schiff, das er kommandierte. Smith war ein Patriarch der See und genauso sah er den Ozean auch an: voller Liebe, aber auch mit Autorität.
„Schicken Sie sie auf See, Mr. Murdoch. Legen Sie ein paar Kohlen auf!“, wies er seinen Ersten Offizier an.
„Jawohl, Sir!“, bestätigte Murdoch und trat ins das Steuerhaus und an den an Steuerbord befindlichen Maschinentelegrafen, um diesen von halber Kraft auf voll voraus zu stellen.
„Volle Kraft voraus!“, wies er den dort wachhabenden Sechsten Offizier, James Moody, an.
„Sehr wohl Sir“, bestätigte Moody und trat an den Backbord*-Maschinentelegrafen, stellte ihn ebenfalls von halber Kraft auf voll voraus. Moody war vierundzwanzig Jahre alt und seit gerade einem Jahr Schiffsoffizier. Die Titanic war seine zweite Station bei der White Star Line. Zuvor hatte er auf der Oceanic seinen Dienst versehen.
Im Maschinenraum ertönte ein Klingeln, als die beiden Telegrafen umgestellt wurden. William Bell, der Leitende Ingenieur, wurde aufmerksam und bestätigte zunächst den Fahrtbefehl von der Brücke, indem er den Maschinentelegrafen im Maschinenraum ebenfalls auf voll voraus stellte. Die Bestätigung von unten wurde dem Wachhabenden auf der Brücke durch den Messingzeiger des dortigen Telegrafen angezeigt.
„Volle Kraft voraus!“, rief Bell laut.
„Volle Kraft voraus!“, bestätigte die gesamte Heizercrew im Chor und machten sich an die Arbeit, die Kohlen in kürzeren Abständen in die Kessel zu schaufeln.
„Los, Männer, bewegt euch!“, befahl der Leitende Heizer Fred Barret. Ingenieure und Heizer machten ihren Job.
„Was sagt die Anzeige?“, fragte Bell einen seiner Ingenieure, der ihm entsprechende Auskunft gab. Bell öffnete das Hauptdampfventil und die Manometer der einzelnen Druckleitungen zeigten an, dass die Maschinen mit der maximalen zur Verfügung stehenden Kraft liefen.
„Na, los, Männer! Legt euch ’n bisschen ins Zeug! Wir brauchen volle Kraft!“, feuerte Barret seine Schwarze Gang an, die mit aller Macht Kohlen schaufelten – und das waren Brocken, die mindestens doppelt faustdick waren.
Die riesigen Pleuel, gut vier Stockwerke hoch, stampften heftiger und trieben die Schraubenwellen der drei Propeller schneller. Drei hausgroße vierblättrige Propeller schoben stärker an und trieben die Titanic auf ihre fast maximale Geschwindigkeit.
Während William Murdoch sich am Geschwindigkeitsmesser überzeugte, dass der Befehl des Captains ausgeführt worden war, rannten Jack Dawson und Fabrizio de Rossi leichtfüßig über die Back zum relinggesicherten Steven, um zu sehen, wie der Bug der Titanic das Wasser zerschnitt. Beide lehnten sich gefährlich weit über die Reling, beobachtet von einem schmunzelnden Captain Smith. Murdoch trat zu ihm.
„Einundzwanzig Knoten*, Sir“, meldete er strahlend. Smiths zufriedenes Schmunzeln wurde noch breiter. Er legte beide Hände auf die Brüstung der Brücke* und sah mit sanftem, väterlichem Lächeln wieder zu den beiden jungen Männern ganz vorn am Bug, die vor Lebensfreude schier zu explodieren schienen.
„Hey, sieh mal da unten! Da unten!“, rief Dawson und deutete auf einen Delfin, der vor dem Bug kreuzte. „Siehst du ihn?“
„Ich seh’ ihn!“, bestätigte Fabrizio fröhlich. Jack ortete einen weiteren Delfin und wies darauf.
„Da ist noch einer! Siehst du den? Siehst du den da? Siehst du, wie er springt?“, fragte er und stieß jauchzende Freudenschreie aus, die bis ans Heck zu hören waren. Es war eine ganze Schule von Delfinen, die mit dem stählernen Koloss um die Wette schwammen und problemlos die hohe Geschwindigkeit hielten, ja sogar übertrafen, denn sie kreuzten auch vor dem Bug hin und her, als spielten sie Fangen mit dem Schiff. Nicht nur die beiden jungen Männer strotzten vor Lebensfreude, auch die Delfine ließen ihrer Lust nach Leben freien Lauf.
Auf der Steuerbordseite der Brücke servierte der Fünfte Offizier Harold Lowe dem Captain eine Tasse Tee. Lowe war mit gut neunundzwanzig Jahren zwar schon seit fünfzehn Jahren Seemann, aber erst ein knappes Jahr bei der White Star Line angestellt. Diese Fahrt auf der Titanic war seine erste Transatlantikfahrt. Mit der Teetasse in der Hand schaute Captain Smith geradezu würdevoll nach vorn, immer noch sehr angetan von den beiden jungen Männern, die ihr Leben so offensichtlich genossen.
Während im Kesselraum die Heizer schwitzten und unermüdlich Kohle in die lodernden Feuer schippten, peilte Fabrizio an der Bugreling nach vorn. Er wies zum Horizont.
„Da vorn kann man schon die Freiheitsstatue sehen“, sagte er. „Ganz klein, natürlich …“, setzte er mit unüberhörbarem italienischem Akzent hinzu. Jack stieg auf die zweite Sprosse der Reling*, jauchzte erneut herzhaft und rief:
„Ich bin der König der Weeeelt! Juchhuuuuu!“
Er ließ das Vorstag* los, breitete die Arme aus und stand freihändig, nur gesichert von der Reling, auch wenn er sie nicht berührte, und dem Fahrtwind. Es war ein Gefühl, als würde er fliegen, frei wie ein Vogel im Wind.
Inzwischen war es Mittag. Im Palmengarten-Restaurant hatte sich eine illustre Gesellschaft am Tisch des Reedereivorstands Bruce Ismay versammelt. Außer ihm selbst saßen noch sein Chefkonstrukteur Thomas Andrews, Caledon Hockley, Rose und Ruth DeWitt Bukater und Margaret „Molly“ Brown an diesem Tisch. Ismay, erfüllt von überschäumendem Stolz, dozierte über die Eigenschaften dieses gewaltigen Transportmittels:
„Sie ist das größte bewegliche Objekt, das Menschen je schufen; das größte aller Zeiten. Unser Chefkonstrukteur, Mr. Andrews, hat sie vom Kiel aufwärts an erschaffen.“
Andrews, ein gut aussehender Mann von neununddreißig Jahren, fühlte sich mit derartiger Aufmerksamkeit, die auf seine Person gelenkt wurde, nicht sonderlich wohl. Er war Ingenieur, gewiss ein guter Mann seines Fachs – aber er stand nicht gern im Mittelpunkt.
„Nun, ich hab’ sie vielleicht zusammengebaut – aber die Idee kam von Mr. Ismay“, spielte er seine eigene Rolle herunter. „Ihm schwebte ein Schiff von solcher … Kraft und Größe … vor, dass seine Überlegenheit niemals in Frage gestellt werden würde. Und hier ist es. Durch Willenskraft zu solider Wirklichkeit geworden.“
„Hört, hört!“, bemerkte Cal.
Ein Steward erschien.
„Was wünschen Sie zu speisen, Sir?“, wandte er sich an Ismay.
„Ich nehme den Lachs, bitte“, bestellte der Reedereivorstand.
Rose fand dieses Gespräch – nein, diesen Vortrag – entsetzlich langweilig. Sie steckte eine Zigarette in ihre Zigarettenspitze und zündete sie an. Sie alle hatten gerade ihre Vorspeise zu sich genommen, damit hatte das Essen begonnen. Rose war durchaus bekannt, dass es während des Essens als unhöflich bis absolut unmöglich galt, zu rauchen. Es war ihre Art, gegen die entsetzlich steifen Konventionen dieser Upper-Class-Gesellschaft zu rebellieren …
Ihre Mutter bemühte sich, sie nicht direkt anzuschauen, als sie sie möglichst leise zurechtwies:
„Du weißt, ich mag das nicht, Rose!“
Es war ein ebenso leises wie grantiges Zischen. Sie reckte sich nur ein wenig zu ihrer Tochter hinüber, um nicht unnötig Aufmerksamkeit auf sich und ihren rebellischen Sprössling zu ziehen. Rose wandte sich ihr zu und sah sie geradezu hochnäsig und trotzig an, blies ihr den Rauch direkt ins Gesicht. Cal reichte es. Er griff zu, zog die Zigarette aus der Spitze und drückte sie im Aschenbecher aus.
„Sie weiß es“, versetzte er mit gewisser Reizung über das unmögliche Benehmen seiner Verlobten. Molly, die ihm gegenüber saß beobachtete ihn, von seiner harschen Reaktion peinlich berührt. Es war einer der Momente, in denen sie sich dazu beglückwünschte, dass sie inzwischen von Mr. Brown geschieden war; dass sie sich von solchen gelackten Typen wie Cal Hockley nicht wirklich beeindrucken ließ. Sie bedauerte Rose, die gleich von zwei Seiten unter Druck gesetzt wurde und sich nur durch solche Trotzreaktionen überhaupt zur Wehr setzen konnte.
„Was wünschen Sie, Sir?“, erkundigte sich der Steward.
„Wir nehmen beide das Lamm – englisch; englisch mit ein wenig Minzsauce“, bestellte Cal, ohne Rose nach ihren Wünschen zu fragen.
„Sehr wohl, Sir.“
Rose sah betreten und trotzig zugleich an Andrews vorbei ins Leere. Wie lange wollte sie sich diese ständige Bevormundung durch ihre Mutter und ihren Verlobten noch bieten lassen? Cal brummte zustimmend auf die Bestellungsbestätigung. Erst ein Blick auf sein Gegenüber Molly Brown, deren Blick strafende Züge annahm, veranlasste ihn, wenigstens der Form halber nachzufragen:
„Du … magst doch Lamm, Zuckerpüppchen?“
Rose legte die Zigarettenspitze weg und wandte sich Cal mit einem derart falschen freundlichen Kaspergrinsen zu, dass ihm – so hoffte sie – klar sein musste, dass sie ihn am liebsten geohrfeigt hätte.
„Für mich den Schellfisch“, orderte Ruth ihr Mittagessen.
„Und? Werden Sie ihr das Fleisch auch noch klein schneiden, Cal?“, spottete Molly bissig und ließ ein spöttisches Lachen hören. „Hey, wer kam eigentlich auf den Namen Titanic?“, fragte sie dann, um die Stimmung am Tisch wieder etwas zu heben. „War’n Sie das, Bruce?“, setzte sie mit einem koketten Blick auf Ismay hinzu. Ihr Sprachduktus und ihr kesser Blick verrieten, dass sie ganz und gar nicht in diese angeblich so piekfeine Gesellschaft hineingeboren worden war.
„Ja, ganz recht“, bestätigte Ismay. „Ich … äh … ich wollte damit die reine Größe zum Ausdruck bringen. Und Größe bedeutet … Stabilität, Luxus und vor allem … Stärke“, bekräftigte er.
„Haben Sie mal was von Dr. Freud gehört, Mr. Ismay?“, fragte Rose spitz. Männer waren so bescheuert in ihrem Größenwahn und merkten es nicht einmal … „Was er über die männliche Besessenheit, was Größe anbelangt, bemerkt hat, dürfte Sie interessieren.“
Andrews hätte sich an dem Happen Vorspeise beinahe verschluckt und schmunzelte dann über die spitze Bemerkung dieser hübschen, klugen und schlagfertigen jungen Frau. Auch Molly ließ ein anerkennendes und spöttisches Lächeln sehen. Mit Rose war im Ernstfall nicht gut Kirschen essen; die Kleine hatte Mumm, erkannte die von Ruth als Neureiche abgetane, energische Frau.
„Was ist nur in dich gefahren!?“, fuhr ihre Mutter sie leise und giftig an. Rose schenkte ihr einen hochmütigen Blick, der ihre ganze Verachtung dieser in Konventionen zu Stein erstarrten so genannten guten Gesellschaft ausdrückte. Sie legte die Serviette weg und erhob sich. Der Appetit war ihr endgültig vergangen – nicht nur wegen des halb roh zu erwartenden Lamms mit Minzsauce.
„Bitte, entschuldigen Sie mich“, verabschiedete sie sich und verließ mit ebenso schnellen wie hoheitsvollen Schritten das Palmengarten-Restaurant. Ismay erhob sich halb, Caledon erstarrte schier vor peinlicher Berührung. Es fehlte nicht viel und ihm wären die Gesichtszüge entgleist. Nur mit der eisernen Beherrschung seiner Erziehung zum Gentleman gelang es ihm, Contenance zu bewahren. Aber seine Verkrampfung ob dieser Peinlichkeit war kaum zu übersehen. Ruth wäre am liebsten im Erdboden versunken. Dieses eigensinnige Früchtchen Rose war drauf und dran, alles zu verderben, was sie mit einiger Mühe eingefädelt hatte. Zuweilen war ihr Name wirklich Programm – Rosen haben Dornen …
„Ich muss mich entschuldigen“, schämte sie sich fremd. Molly grinste noch breiter.
„Sie ist eine Waffe, Cal“, warnte sie spöttisch. „Ich hoffe, Sie können mit ihr umgehen.“
Cals Gesichtsausdruck war pures Eis.
„Ich sollte von jetzt an wohl besser die Abendlektüre meiner Verlobten überprüfen, nicht wahr?“, versetzte er und rang sich den Anflug eines eisigen Lächelns ab. Ismay sah etwas verstört in die Runde.
„Freud? Wer ist das? Ein Passagier?“, fragte er, seine ganze Ahnungslosigkeit preisgebend.
Auf dem Achterdeck, das den Passagieren der Dritten Klasse als Freideck diente, genossen die Auswanderer die frische Luft und den Sonnenschein des wunderschönen Frühlingstages. Bert Cartmell, ein Emigrant aus Manchester, stand mit seiner kleinen Tochter Cora an der Reling, er selbst auf dem Deck, Cora auf der zweiten Sprosse der weiß lackierten Reling. Bert hielt sie von hinten umarmt, damit sie nicht über Bord ging, die Kleine hatte ihre Ärmchen um Vaters Hände gelegt und ließ sich von ihm erklären, wie es kam, dass die Schiffsschrauben sich tief unter dem weit herausgezogenen Heck drehten und das Schiff vorwärts trieben.
Der liebevolle Vater und seine glückliche kleine Tochter waren das gegenwärtige Motiv, das auf dem obersten Blatt von Jack Dawsons Skizzenmappe schwarz-weiße Gestalt annahm. Der junge Amerikaner saß auf einer der Bänke an der Reling, hatte die in Leder gebundene Skizzenmappe – sein einziger wirklich wertvoller Besitz – auf den Knien und führte den Kohlestift mit sicheren Strichen über das Papier.
Neben ihm saß Fabrizio und wandte sich einem anderen Passagier zu, der an der Reling zum unteren Achterdeck lehnte und rauchte.
„Das … äh … Schiffä … istä … ziemlich gutä?“, radebrechte er mit massivem italienischem Akzent.
„Ja, is’ ja auch ’n irisches Schiff“, bemerkte der Raucher.
„Es ist doch englisch, oder?“, wunderte sich der Italiener.
„Nein, es wurde in Irland gebaut“, erwiderte der andere Passagier. „Fünfzehntausend Iren haben es gebaut. Stark wie ein Fels. Geschaffen von kräftigen irischen Händen“, erklärte er.
Im gleichen Moment kamen zwei Stewards mit einigen Hunden unterschiedlicher Rassen, die offensichtlich Herrchen und Frauchen in der Ersten Klasse hatten, und auf dem Deck des normalen Volkes Gassi geführt wurden.
„Is’ ja mal wieder typisch …“, brummte der Raucher „Die Köter aus der Ersten Klasse kommen hier runter, um sich auszuscheißen.“
Jack wurde auch aufmerksam und sah von seinem Skizzenblock auf.
„Damit wird uns gezeigt, wo wir uns im Gesamtbild befinden“, kommentierte er spöttisch. Der Raucher lachte kurz auf.
„Als würden wir das vergessen!“, versetzte er. „Ich bin Tommy Ryan“, stellte er sich vor und reichte seinen Gesprächspartnern die Hand.
„Jack Dawson“, erwiderte Jack die Vorstellung.
„Hallo“, grüßte Tommy.
„Fabrizio“, stellte sich der junge Italiener vor.
„Hi“, grüßte Tommy. Dann sah er Jacks Skizzenblock und wies darauf.
„Hast du mit deinen Bildern schon was verdient?“, fragte er. Doch Jack antwortete nicht, sah an Ryan vorbei zum einen Stock höher gelegenen und etwa hundertzwanzig Fuß vor dem Heck endenden Freideck des B-Decks. Dort kam eine junge Frau an die achtere Reling, die Jack wie ein rothaariger Engel erschien – Rose DeWitt Bukater. Das Kleid aus artischockenfarbenem Satin, über den ein Oberkleid aus zarter weißer Spitze gezogen war und dem breiten orangefarbenen Gürtel direkt unter dem Busen war ein echter Blickfang, besonders für jemanden wie Jack, der einen Blick für Schönheit und das Besondere hatte. Die Spitze des Oberteils setzte sich nach unten in mehreren stufenförmigen Lagen fort, betonte die schlanke Gestalt der jungen Frau. Die stufenförmige Anordnung der zapfenartigen Spitze wirkte wie Fischschuppen und gab ihr beinahe das Aussehen einer Meerjungfrau. Völlig fasziniert klebte sein Blick an der Reling des oberen Decks.
Tommy bemerkte, wohin der Blick seines neuen Bekannten ging. Er drehte sich kurz um und sah ebenfalls nach oben. Der kurze Augenschein demonstrierte ihm eindrucksvoll, dass Jack sich da besser nicht weiter verguckte.
„Aaaah, vergiss es, mein Freund“, sagte er gedehnt. „An eine Frau wie die kommst du nicht ran. Eher fliegen dir kleine Engel aus ’m Hintern“, warnte er. Jack sah weiter unverwandt nach oben. Fabrizio wedelte mit einer Hand vor Jacks Augen. Er reagierte nicht, war immer noch auf die Schönheit auf Deck B fixiert. Sie sah so verloren aus …
Dass sie es tatsächlich war, bewies das weitere Auftreten eines dunkelhaarigen, schlanken Mannes, der sie mit nur knapp beherrschter Wut an der Reling stellte.
„Was war das eben für ein Auftritt?“, fuhr Cal sie an und riss sie am Arm herum. Rose machte sich gleich wieder von ihm frei, ging wieder in Richtung Schiffsinneres und ließ ihn einfach an der Reling stehen. Jack bemerkte, dass der Mann vor Wut schäumte, aber dennoch versuchte, es Außenstehende nicht merken zu lassen. Es wollte ihm in diesem Fall nicht recht gelingen.
Es wurde Abend, der große Speisesaal der Ersten Klasse im D-Deck füllte sich rasch mit Passagieren der beiden oberen Decks in Abendgarderobe. Man kannte sich, man machte Konversation, man lauschte mit einem halben Ohr der Begleitmusik, die das Musikerensemble um Wallace Hartley machte, man blieb unter sich – weit weg von dem, was man in diesen erlauchten Kreisen als Pöbel betrachtete.
♦♦♦
Die alt gewordene Rose auf der Keldysh schüttelte sich innerlich immer noch, wenn sie an diesen Freitagabend dachte. Sie sah sich, mit leerem Blick am Tisch sitzend, unter den Gesellschaftsklatsch verbreitenden feinen Damen, den von gelungenen Geschäften prahlenden Herren, die eigentlich nur äußerlich fein waren, in ihrem Inneren aber ständig überlegten, wie sie ihren Profit auf Kosten anderer steigern konnten.
„Ich sah mein Leben vor mir, als ob ich es bereits hinter mir hätte. Eine endlose Aneinanderreihung von Partys, Bällen, Yachten und Polospielen. Immer dieselben engstirnigen Leute, dieselben geistlosen Gespräche. Ich hatte den Eindruck, als stünde ich vor einem tiefen Abgrund, mit niemandem an der Seite, der mich zurückhalten würde. Niemandem, der sich dafür interessiert oder Notiz davon nimmt“, sagte sie zu ihren gespannten jungen Zuhörern im Computerraum.
♦♦♦
Sie hatte genug von den prahlerischen Reden der Männer und dem Klatsch und Tratsch, den die Frauen verbreiteten. Sie verließ den Speisesaal und begab sich in Richtung ihrer Suite. Ein Steward, der ihr begegnete, grüßte sie höflich, sie nickte, erwiderte den Gruß mit schweigendem Nicken und einem leichten Lächeln. Nach außen wirkte sie beherrscht, wie es sich für eine junge Dame ihrer Gesellschaftsschicht gehörte. Innen sah es ganz anders aus.
Sie erreichte ihre Suite und stand ganz allein mitten in ihrem Schlafzimmer. Sie starrte auf ihr Spiegelbild im Spiegel des Waschtisches. Sie war müde. Müde wegen der Uhrzeit, aber auch des feinen Benehmens müde. Sie wollte schlafen gehen, doch dazu musste sie zunächst aus dem Kleid heraus, das sie trug. Die Zofen waren nicht da, also versuchte sie, das Kleid allein auszuziehen. Sie kam nicht an den Verschluss auf dem Rücken, egal, wie sie sich zunehmend verzweifelt anstrengte.
Und dann brach der Vulkan aus.
Mit einem unmenschlichen Wutschrei riss sie die Perlenkette von ihrem Hals, die einer Explosion gleich im Raum in Einzelteilen verstreut wurde. In ihrer Raserei riss sie an sich selbst, an ihrer Kleidung und an ihrem Haar herum, ohne das Kleid loszuwerden. Ihre wahnsinnige Wut richtete sich gegen die Einrichtung. Sie stürzte zum Schrank und riss heraus, was ihre Hände greifen konnten, schnappte sich den Handspiegel – dieses Sinnbild aller Eitelkeit – und drosch ihn voller Zorn auf den Waschtisch. Der Spiegel zerbrach, hatte mehrere Sprünge, die sich über den Durchmesser der Glasfläche zogen.
Keuchend kam sie wieder halbwegs zur Besinnung, doch dann konnte sie einfach nicht mehr und traf einen verzweifelten Entschluss …
Kapitel 7
Ein irdischer Engel
Rose rannte über das B-Deck, stieß rücksichtslos alles aus dem Weg, was ihr nicht freiwillig Platz machte. Sie schluchzte haltlos, war trotz der wenig frühlingshaften Temperaturen nach Sonnenuntergang nur mit ihrer roten Abendrobe aus Seide mit einem zarten schwarzen Chiffonoberkleid darüber bekleidet, die nur ganz kurze Ärmel hatte, die gerade knapp unter der Schulter endeten und mit einem weiten Ausschnitt, der die Brust bis fast zum halben Busen unbedeckt ließ – ganz sicher keine Kleidung, die den Nachttemperaturen im April auf dem Nordatlantik angepasst war. Sie hetzte in Richtung Niedergang, schubste ein älteres Paar beiseite, das in Gesellschaft einer ebenfalls älteren Dame über das abendliche Deck flanierte.
„Na, hör’n Sie mal Miss!“, beschwerte sich der elegant gekleidete Herr. Rose nahm ihn nicht wahr und rannte weiter, erreichte den Niedergang*, riss die Tür der Reling auf, rannte hinunter auf das C-Deck und hinüber zum Niedergang zum achteren B-Deck, das auch für die Passagiere der Dritten Klasse zugänglich war.
Auf dem Deck, das Roses Ziel war, lag Jack Dawson auf einer der elegant geschwungenen Holzbänke, rauchte eine Zigarette und sah verträumt auf den völlig klaren, tiefschwarzen Himmel, an dem abertausende Sterne wie auf schwarzem Samt ausgelegte Diamanten glitzerten. Das Geräusch schneller, vor rastloser Eile beinahe stolpernder Schritte störte ihn in seinen künstlerischen Betrachtungen dieses Naturwunders auf. Er kam hoch und sah gerade noch die Silhouette einer ebenso fein wie knapp gekleideten Frau an sich vorüberhuschen.
Atemlos und schluchzend erreichte Rose das Achterdeck und prallte auf das Handrad, das in der Mitte der beiden dort befindlichen Poller stand und zum Einholen der Festmachertrossen diente. Durch einen dichten Tränenschleier sah sie das Heck, genauer den beleuchteten Flaggenmast, an dem von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang das britische Blue Ensign*, die Dienstflagge* Großbritanniens, wehte. Jetzt, bei Dunkelheit, war die Flagge eingeholt.
Selbst, wenn sie vorhanden gewesen wäre, hätte es Rose in diesem Moment keinen Deut geschert, dass die Titanic nicht unter dem Red Ensign* fuhr, der normalen britischen Handelsflagge*, sondern unter der dunkelblauen Dienstflagge, weil sie Post der Royal Mail beförderte. Sie sah nur das Ende des Schiffes; das war alles, was sie in ihrer Verzweiflung noch interessierte. Wie von einem Magneten gezogen, beinahe schlafwandlerisch, ging sie langsam auf die achtere Reling zu. Sie drehte sich um, wie um sich zu vergewissern, dass ihr niemand folgte. Nein, da war keiner …
Einen Moment blieb sie eine gute Armlänge von der Reling entfernt stehen, dann legte sie wie in Trance beide Hände auf die oberste Stange des Geländers, packte dann entschlossen zu, stieg mit beiden Füßen auf die unterste Sprosse, hob erst die rechte Hand, dann auch die linke, um sich am Flaggenmast festzuhalten und kletterte auf die andere Seite.
Immer noch schluchzend, aber auch vor Aufregung keuchend, drehte sie sich um. Nur noch ein kaum drei Finger breiter Absatz des Rumpfes hielt ihre Füße über der Wasseroberfläche. Sie schaute hinunter in die dunkle Tiefe. Gut sechzig Fuß (oder zwanzig Meter) unter ihr schäumte das Wasser des Atlantiks im Heckschwell*. Ihr Herz schlug bis unter die Schädeldecke. Sie schwankte zwischen eisiger Entschlossenheit und beklemmender Verzagtheit, ihrem Leben auf diese Art ein Ende zu setzen. Was würde geschehen, wenn sie dort unten aufschlug? Sie nahm an, dass sie sofort tot sein würde …
Jack Dawson war, den Geräuschen folgend, ebenfalls auf dem offenen Teil des Achterdecks angekommen und glaubte, seinen Augen nicht trauen zu können. Da stand doch tatsächlich eine von den hochfeinen Damen der Ersten Klasse jenseits der Reling! Genau jene junge Dame, die er am frühen Abend so verloren auf dem oberen Freideck gesehen hatte! Der junge Künstler erfasste rasch, was die junge Frau da plante.
„Tun Sie’s nicht!“, warnte er und schlich vorsichtig weiter in Richtung Reling, um die Frau nicht so zu erschrecken, dass sie losließ. Rose wandte sich um und sah keine zwei Mannslängen hinter sich einen dunkelblonden jungen Mann in einfacher Kleidung stehen.
„Kommen Sie nicht näher! Bleiben Sie, wo Sie sind!“, fuhr sie ihn mit hysterisch klingender Stimme an.
Vorsichtig pirschte Jack näher zu ihr heran und streckte die rechte Hand langsam in ihre Richtung. Er war erheblich weiter von ihr entfernt als eine Armlänge, erlaubte sich diese Vertrauen erweckende Geste aber gleichwohl.
„Kommen Sie, geben Sie mir Ihre Hand. Ich zieh‘ Sie wieder zurück“, bot er mit leiser, sanfter Stimme an – ganz so, als ob er ein panisches Pferd beruhigen und einfangen wollte.
„Nein! Kommen Sie nicht näher! Ich mein’s ernst! Ich lass los!“, warnte sie ihn, sich weiter anzunähern.
Er blieb stehen und überlegte fieberhaft, wie er ihr nahe genug kommen konnte, um sie festzuhalten, ohne dass sie wirklich losließ. Der Einfall, den er benötigte, kam nach seinem Empfinden schneller, als er eigentlich erwartet hatte: seine Zigarette. Er nahm sie aus dem Mund und deutete schweigend an, dass er den Stummel nur über Bord werfen wolle. Das gab ihm die Gelegenheit, ihr wieder ein Stück näher zu kommen. Sie ließ es zu, er machte noch einen Schritt nach links, um ihr zu signalisieren, dass sie ihn nicht fürchten musste und warf mit den Zigarettenstummel aus respektvoller Entfernung zur Reling über Bord. Dann steckte er die Hände in die Hosentaschen und stellte sich direkt neben den Heckanker, der gleich neben dem Flaggenmast an der Reling lag.
„Nein, tun Sie nicht“, sagte er mit sanfter Provokation in der Stimme.
„Was meinen Sie mit das tu ich nicht?“, fauchte sie mit geradezu hilflos-hysterischer Stimme. „Glauben Sie nicht, Sie könnten mir vorschreiben, was ich tu oder lasse! Sie kennen mich doch gar nicht!“
Es reichte ihr wirklich, dass ihr ständig jemand Befehle geben wollte. Jack zuckte mit den Schultern.
„Na ja … sonst hätten Sie’s längst getan“, stellte er fest.
„Sie irritieren mich!“, keifte sie. „Gehen Sie weg!“
Doch Jack gehorchte schon seit langem nur seinen eigenen Anweisungen.
„Ich kann nicht“, sagte er. „Jetzt geht es mich auch was an“, setzte er hinzu und zog seine Jacke aus, ließ sie hinter sich fallen. „Wenn Sie loslassen … muss ich Ihnen wohl oder übel hinterher springen.“
„Das ist doch absurd!“, protestierte sie. „Sie würden ertrinken!“
„Ich bin ein guter Schwimmer“, versetzte Jack, stellte den rechten Fuß auf den Anker, schnürte den rechten Stiefel auf.
„Allein der Aufprall würde Sie töten!“, warnte Rose verzweifelt. Warum, zur Hölle, ließ er sie nicht einfach in Ruhe sterben? Jack konnte sich ein Grinsen kaum noch verkneifen. Vorstellungen hatte die junge Dame …
„Es würde wehtun, da geb’ ich Ihnen Recht“, sagte er, zog den Stiefel aus und beförderte ihn ebenfalls hinter sich. „Um ehrlich zu sein … beunruhigt mich vielmehr, dass das Wasser so kalt ist“, ergänzte er, entledigte sich auch des linken Stiefels und hoffte, dass sie den Köder schluckte und es sich noch einmal überlegte. In der Tat wurde sie unsicher, wie ihr scheuer Blick in seine Richtung bewies.
„Wie kalt?“, fragte sie vorsichtig.
„Ziemlich kalt. Vielleicht ein paar Grad über Null. War’n Sie schon mal … war’n Sie schon mal in Wisconsin?“
Rose zuckte herum.
„Was?“, fragte sie gereizt. Was sollte dieser unzusammenhängende Quatsch?
„Na ja … die haben dort mit Abstand die kältesten Winter“, sagte Jack. „Ich bin da aufgewachsen, in der Nähe von Chippewa Falls. Ich weiß noch, als ich ganz klein war, war ich mit meinem Vater oft zum Eisangeln auf dem Lake Wissota. Eisangeln ist, wenn man …“
„Ich weiß, was Eisangeln ist! Aacchh!“, schnaufte sie giftig. Jack ging vor der zickigen Reaktion einen Schritt zurück in Deckung und zog den Kopf leicht zwischen die Schultern.
„Entschuldigung“, erwiderte er mit leichter Reizung. So richtig gemütlich war es ihm ohne Jacke und Schuhe nicht wirklich. Ohne dass sie es merkte, arbeitete er sich Inch** für Inch an sie heran.
„Sie … Sie kommen mir nur so vor, als würden Sie sich die meiste Zeit drin aufhalten“, erklärte er seinen Erklärungsversuch. „Na, jedenfalls … jedenfalls bin ich da mal eingebrochen. Sie können mir glauben … so kaltes Wasser … wie das da unten“, er wies mit dem Kinn in Richtung der sechzig Fuß frischer Luft bis nach unten hinter dem Heck, „das ist wie tausend Stiche … die man am ganzen Körper spürt. Man kann nicht mehr atmen … man kann an nichts mehr denken – abgesehen von dem Schmerz.“
Er seufzte leise.
„Aus dem Grund bin ich nicht besonders scharf darauf, Ihnen hinterher zu springen. Aber … wie gesagt“, er zog auch die Weste aus, „ich hab’ keine Wahl. Ich kann bloß hoffen, dass Sie über die Reling zurückklettern und mir das ersparen.“
„Sie sind verrückt!“, schleuderte sie ihm entgegen. Jack grinste schief. Er stand jetzt fast direkt hinter ihr.
„Komisch, das sagen alle“, räumte er ein. „Aber … bei allem Respekt, Miss: Ich bin nicht derjenige, der von diesem Schiff springen will“, setzte er mit einer eher spöttischen Verbeugung hinzu. „Kommen Sie“, sagte er dann sanft. „Geben Sie mir Ihre Hand. Sie woll’n das doch gar nicht“, beschwor er sie und reichte seine Hand über die Reling.
Rose gab auf und Jack atmete auf. Es war ihm gelungen, sie vom Freitod abzuhalten. Vorsichtig – wesentlich vorsichtiger als beim Hinübersteigen – drehte sie sich um, als ihr plötzlich klar wurde, in welche Gefahr sie sich gebracht hatte und sie nun, da sie sich für das Leben entschieden hatte, Angst um ihr Leben bekam. Jack hielt sie fest.
„Ich bin Jack Dawson“, stellte er sich vor.
„Rose DeWitt Bukater“, erwiderte sie die Vorstellung.
„Es ist wohl besser, wenn Sie mir das aufschreiben“, grinste er. „Kommen Sie.“
Sie setzte den rechten Fuß übervorsichtig auf die untere Relingstange, trat dabei auf den Saum ihres Oberkleides, der mit schwarzen Glasanhängern besetzt und mit ebenfalls schwarzen Glasfransen gesäumt war. Als sie das Gewicht auf den Fuß verlagerte, um auch den zweiten auf die Stange zu setzen, rutschte sie ab und verlor den Halt. Hätte Jack nicht ihre Hand gehalten, wäre sie ins Wasser gestürzt. Erschrocken und voller Panik schrie sie auf. Jack packte fester zu.
„Ich hab’ Sie! Ich hab’ Sie!“, rief er, um sie zu beruhigen. „Kommen Sie!“, forderte er sie dann auf, aber sie fand an dem sich nach unten verjüngenden Rumpf keinen Halt. Allein Jacks fester Griff bewahrte sie vor dem Absturz.
„Hilfe! Bitte! Hilfe!“, schrie sie. „Hilfe! Bitte helfen Sie mir!“
Roses verzweifelte Rufe erreichten drei Matrosen, die auf dem offenen C-Deck standen. Sie orientierten sich kurz von wo die Schreie kamen und rannten dann hinauf auf das Achterdeck.
„Hör’n Sie! Hör’n Sie! Ich hab’ Sie! Ich lasse Sie nicht los!“, mahnte Jack sie zur Ruhe, wohl wissend, dass Panik sie erst richtig in Gefahr brachte. „Gut. Und jetzt ziehen Sie sich rauf, na los!“
Das war einfacher gesagt, als getan, aber Rose versuchte es. Jack spürte, dass sie der Reling näher kam.
„Kommen Sie, so ist es gut“, machte er ihr Mut. „Sie schaffen es.“
Es gelang ihr tatsächlich, mit seiner Unterstützung die Reling zu erklimmen, aber sie wagte nicht, die Füße wieder auf die Sprossen zu setzen und überließ es Jack, sie über die Reling zu ziehen. Schocksteif, wie sie war, unterstützte sie ihn nicht, als er sie auf das Deck zog.
„Ich hab’ Sie!“, entfuhr es ihm erleichtert, als er spürte, dass ihr Schwerpunkt sich dem Deck zuneigte. Weil sie ihm allerdings wie eine Schaufensterpuppe in dem Armen lag und die Beine nicht einen halben Inch bog, musste er sie in der ganzen Starre über die Stangen zerren, bekam selbst Übergewicht nach hinten und stürzte auf das Deck. Sie fiel auf ihn, rollte sich dann mit ihm zusammen herum, so dass er auf ihr zu liegen kam, bevor die Rollbewegung stoppte.
Genau in dem Moment erreichten die drei Matrosen das Achterdeck.
„Was ist denn hier los?“, fragte der vorderste Matrose, übersah kurz die Situation: Eine feine Dame im Abendkleid lag unter einem jungen Mann aus der Dritten Klasse, er hatte Schuhe, Jacke und Weste ausgezogen – und wollte sich wohl gerade mit Gewalt über diesen Leckerbissen hermachen …
„Nimm sofort die Finger weg! Und rühr’ dich nicht von der Stelle!“, befahl der vorderste Matrose. Jack richtete sich auf und kniete auf dem Deck. Der Matrose drehte sich um.
„Der Bootsmann soll sofort herkommen!“
Wenig später klickten Handschellen, Caledon Hockley war über den Zwischenfall informiert worden und ohne Mantel, dafür mit Lovejoy und Colonel Archibald Gracie, auf das Achterdeck geeilt. Während Gracie Rose auf den Schreck einen Schluck Brandy anbot, die das Angebot schweigend zurückwies, nahm Cal sich Jack vor.
„Das ist völlig inakzeptabel!“, fauchte er. „Was fällt dir ein, Hand an meine Verlobte zu legen?“
Als Jack nicht ihn ansah, sondern besorgt zu der in eine warme Decke gewickelte Rose schaute, die immer noch geschockt auf einer nahen Bank saß, stellte Cal sich ihm in den Blick.
„Sieh mich an, du Dreckshund!“, donnerte er ihn an.
„Cal!“, meldete sich Rose zu Wort, aber Hockley war zu sehr in Fahrt, um sie jetzt wahrzunehmen.
„Was hast du dir dabei gedacht?“, fuhr er mit seiner Tirade fort, ohne Jack auch nur ansatzweise die Gelegenheit zu geben, ihm zu antworten.
„Cal!“, rief Rose, nun lauter.
„Ich sollte dich …“
„Cal! Hör auf!“
Erst als Rose beide am Arm nahm, registrierte Cal überhaupt, dass sie gesprochen hatte.
„Es war ein Unfall!“, bremste sie ihren Verlobten. Hockley sah sie ungläubig an.
„Äh, ein … ein Unfall?“, stotterte er. Das sah doch sehr viel mehr nach versuchter Vergewaltigung aus …
„Ja … ein ziemlich dummer sogar“, erwiderte sie. „Ich hatte mich über die Reling gelehnt und rutschte plötzlich aus“, erklärte sie und erntete ungläubige Blicke – auch von Jack. „Ich … hatte mich so weit herüber gelehnt, weil ich die … äh … äh … die … ähm …, ähm …“
Sie traf nicht auf das Wort, das sie suchte, und drehte den rechten Zeigerfinger in der Luft.
„Schiffsschrauben?“, half Cal aus. Erleichtert nickte sie.
„… Schiffsschrauben sehen wollte und da bin ich ausgerutscht und … äh … ich war’ beinah’ über Bord gegangen, aber Mr. Dawson hat mich gerettet und ist dabei fast selbst abgestürzt“, vollendete sie ihre Erklärung für die ungewöhnliche Situation, in der sie und Jack von den Matrosen gefunden worden waren.
„Du wolltest die …“, stotterte Cal und entschied sich dann für Spott:
„Sie wollte die … hehehe … Schiffsschrauben sehen!“
Colonel Gracie winkte ab.
„Ich sage es immer wieder: Frauen und Technik – das verträgt sich nicht“, seufzte er. Der Bootsmann, der hinter Jack stand, konnte ebenfalls nicht glauben, was er hörte.
„Hat es sich so zugetragen?“, fragte er streng. Jacks Blick tauchte wieder in den Roses, die ihn geradezu flehentlich anschaute und ihn wortlos bat, ihre Notlüge zu stützen. Er war ihr durchaus dankbar für die Schwindelei, die ihn der Erklärung des tatsächlichen Hergangs enthob.
„Ja … etwa so ist es gewesen“, bestätigte er ihre Version. Gracie schob sich samt seinem Brandyschwenker neben Cal.
„Nun, dann ist der Junge ein Held“, konstatierte er. „Reife Leistung! Gut gemacht, mein Sohn“, sprach er ein ernst gemeintes Lob aus und nickte Jack anerkennend zu. „Dann ist alles in Ordnung, und wir können uns wieder unserem Brandy widmen.“
Der Bootsmann ließ sich auch nicht zweimal bitten und schloss die Handschellen wieder auf, ließ Jack frei.
Cal rieb mit übertriebener Fürsorge über die Decke, die Rose einhüllte.
„Also … Schatz … du musst ja furchtbar frieren! Lass uns doch reingehen!“, sagte er in einem Ton, der bewies, dass er nicht wirklich ernst meinte, was er sagte. Er schob Rose in Richtung des Niedergangs. Gracie drehte sich verstört um.
„Wäre eine kleine Anerkennung nicht angebracht?“, ermahnte er Hockley, der es nicht einmal für nötig zu befinden schien, sich für die Rettung seiner Verlobten zu bedanken. Cal blieb stehen, hätte Gracie beinahe wütend angeblitzt, beherrschte sich aber rechtzeitig.
„Selbstverständlich“, bestätigte er, zerstreut tuend. „Ähm … Mr. Lovejoy … ich denke zwanzig wären angemessen“, sagte er dann, an den Kammerdiener gewandt, der die Anweisung mit unbewegter Miene aufnahm.
„Ist das der Tageskurs für das Erretten der Frau, die du liebst?“, fragte Rose spitz. Cal, der sich schon wieder halb abgewandt hatte, blieb stehen und sah sie mit einer Mischung aus Verstörung und Ärger an.
„Rose ist verstimmt“, ätzte er. „Was kann man da nur tun?“, setzte er mit beißendem Spott hinzu und tat, als ob er angestrengt nachdachte. „Ich weiß …“
Er drehte sich um und ging einige Schritte auf Jack zu.
„Mr. Dawson, vielleicht könnten Sie ja zusammen mit uns dinieren und unsere Gesellschaft mit … äh … Ihrer Heldengeschichte ergötzen“, schlug er vor. Jack zog sich die Jacke wieder über und schüttelte sie auf den Schultern zurecht, ohne den Blick von Hockley zu wenden.
„Klar doch. Bin dabei“, bestätigte er.
„Gut, dann wäre das geklärt“, sagte Cal süffisant und wandte sich wieder dem Niedergang zu. Gracie war direkt neben ihm und schlug nun ebenfalls diese Richtung ein.
„Dürfte amüsant werden“, raunte Hockley dem Colonel zu und übersah Roses strafenden Blick, der absolut klar war, dass ihr Verlobter ihren Retter richtig unmöglich machen wollte, indem er ihn in dieses Labyrinth aus gesellschaftlichen Gepflogenheiten lockte, von denen dieser junge Mann mit größter Wahrscheinlichkeit keine Ahnung hatte.
Jack, dem das ebenfalls klar war, nahm es dennoch locker. Er hatte nichts zu verlieren, schließlich hatte er nie behauptet, ein so genannter feiner Gentleman zu sein. Dass er in diesem Moment keinesfalls die Absicht hatte, einen solchen vorzuspiegeln, bewies sein Pfiff, mit dem er den Kammerdiener des feinen Pinkels davon abhielt, das Achterdeck sofort zu verlassen. Lovejoy drehte sich tatsächlich um.
„Kann ich … äh …‘ne Zigarette schnorren?“, fragte er ungeniert. Lovejoy kam näher und klappte sein metallenes Zigarettenetui auf, bot Jack das Verlangte an. Sein Blick ging nach unten auf die offenen Schnürsenkel des Dritter-Klasse-Passagiers.
Jack wollte ihn ignorieren, nahm sich eine Zigarette und schnappte sich dann gleich noch eine, die er hinter dem Ohr verschwinden ließ.
„Die sollten Sie zuschnüren“, gab Lovejoy ihm einen ungefragten Rat und wies mit dem wieder geschlossenen Etui nach unten. Jack folgte dem prüfenden Blick des Kammerdieners.
„Es ist interessant, dass die junge Lady zwar ganz plötzlich ausrutschte, Sie aber trotzdem noch Zeit hatten, Jacke und Schuhe auszuziehen“, bemerkte Spicer bissig. Er wollte diesen ungehobelten Zwischendeckpassagier wissen lassen, dass er Roses Version des Hergangs ganz und gar nicht glaubte und ihn im Auge behalten würde.
Kapitel 8
Intensive Gespräche
Rose saß nach den aufwühlenden Ereignissen des Freitagabends in einem Nachthemd, das problemlos für ein Sommerkleid durchgegangen wäre, vor dem Spiegel ihres Schlafzimmers und schaute müde und mit leerem Blick in den großen Spiegel und auch in ihren Handspiegel. Die Tür zum benachbarten Schlafraum öffnete sich und Cal schaute herein. Auch er war bereits im Nachthemd, darüber trug er einen Hausmantel, den er nicht einmal geschlossen hatte.
„Ich weiß, dass du melancholisch bist“, sagte er leise. „Ich weiß allerdings nicht, warum.“
Langsam kam er in Roses Schlafzimmer hinein, fixierte sie im Spiegel, wie auch sie ihn im großen Spiegel ansah, immer noch mit müdem, leerem Blick. Er kam zur Spiegelkommode, stützte sich mehr mit dem Gesäß daran ab, als dass er sich wirklich daraufsetzte. In seinen Händen hielt er ein zwei bis drei Finger flaches Kästchen, das in Länge und Breite etwa die Größe eines Buches hatte.
„Ich hatte eigentlich vor, hiermit …“, setzte er an und öffnete den Verschluss, „bis zur Verlobungsgala nächste Woche zu warten. Aber … ich dachte … heute Abend …“
Er öffnete das Kästchen ganz. Auf schwarzem Samt war ein Collier drapiert. Die Kette bestand aus maiskorngroßen, lanzettförmigen Gliedern aus hellem Gold, deren Flächen mit kleinen weißen Brillanten besetzt waren. Ein herzförmig geschliffener transparenter Stein hing daran, der im Licht der Lampen in tiefem Blau erstrahlte. Die Fassung, an der die Öse befestigt war, um diesen Stein an eine Kette anhängen zu können, bestand aus Silber oder Weißgold und war ebenfalls mit kleinen weißen Diamanten besetzt. Rose wurde noch blasser, als sie ohnehin schon war.
„Grundgütiger!“, entfuhr es ihr. Dieses Schmuckstück, das sich ihr in dem Kästchen in Cals Händen präsentierte, war der absolute Wunschtraum einer jeden Frau – gleich, ob Dienstmagd oder leibhaftige Königin. Die Frage, die sich ihr aufdrängte war, ob das ein Saphir war – in dieser Größe schon fast unbezahlbar – oder doch ein … nein, das wagte sie nicht einmal zu denken!
„Ist das ein …“, setzte sie dennoch an, brach aber ab, weil sie es einfach nicht aussprechen konnte. Cal lächelte verschmitzt.
„… Diamant?“, fragte er. Sein Lächeln wurde richtig strahlend, dann lachte er leise. Die Überraschung in ihrem Gesicht war echt; ebenso echt, wie seine Freude darüber, ihr eine solche Überraschung bieten zu können.
„Ja“, bestätigte er, rutschte von der Spiegelkommode herunter, legte das Schmuckkästchen darauf ab, nahm das Collier heraus und legte es Rose sanft um den Hals. „Sechsundfünfzig Karat, um genau zu sein.“
Rose musste schlucken. Grundgütiger war noch untertrieben, durchfuhr es sie. Allein dieses Collier war ein Vermögen wert. Cal sah ihr im Spiegel in die Augen.
„Er wurde von Ludwig XVI. getragen“, fuhr er fort. „Er nannte ihn la coeur de la mer. Das Herz des Ozeans.“
Die Übersetzung sprachen sie beide gleichzeitig aus. Der Name war völlig passend – so blau und so riesig wie der Ozean war dieser Diamant.
„Er ist überwältigend“, bekannte Rose. Sie meinte damit sowohl die reine Gestalt, die künstlerische Verarbeitung dieser ungeheuren Kostbarkeit, aber auch das pure Gewicht, mit dem der Stein nun um ihren Hals hing. Wenn sie Freude über dies Geschenk empfand, erreichte sie kaum die Lippen und erst recht nicht die Augen. Roses Gesicht war immer noch wie zu einer Maske erstarrt, sprachfähig zwar, aber ausdruckslos und leer.
„Er ist für Könige“, sagte Cal und sah auf ihr gemeinsames Spiegelbild. „Wir sind königlich“, setzte er hinzu und meinte dies – republikanischer Amerikaner oder nicht – auch völlig ernst. Caledon Hockley gehörte zur Spitze des amerikanischen Geldadels, zum Hochadel des Geldes, sozusagen, dessen Krone aus Geldscheinen oder gleich Golddollars bestand. Er kniete neben dem Stuhl nieder, auf dem sie saß, stützte den Kopf auf den linken Arm, den Arm auf die Spiegelkommode und sah sie an, zunächst weiterhin im Spiegel.
„Es gibt nichts, was ich dir nicht schenken könnte“, sagte er sanft. Sein Blick wurde sehnsüchtig. Zum ersten Mal, seit Rose ihn kannte, wirkte er schier entwaffnet durch ihre Schönheit und ihre Eleganz, die von diesem wunderschönen Schmuckstück nur noch unterstrichen wurde. Zum ersten Mal zeigte er Emotionen, die nicht durch Zynismus und Bissigkeit gezügelt wurden, zum ersten Mal wirkte er … verliebt. Er wandte den Blick vom Spiegel ab und sah sie direkt an. Seine dunkelbraunen Augen wirkten wahrhaft warm.
„Ich würde dir nichts verweigern … wenn du dich mir nicht verweigerst“, sagte er und bekam einen richtigen Hundeblick.
„Öffne dein Herz für mich, Rose.“
Er flüsterte beinahe. Rose wusste nicht, wohin mit ihrem Blick. Sie sah wieder in den Spiegel und fühlte sich schon wieder in die Ecke gedrängt. Nein, Cal gab nichts, ohne eine Gegenleistung zu fordern, nicht einmal ein Verlobungsgeschenk …
***
Die gespannten Zuhörer im Computerraum der Keldysh hingen an Roses Lippen und hatten das Gefühl, sie wären direkt in Roses Schlafzimmer auf der Titanic, während sie von bislang gänzlich unbekannten Einzelheiten dieser ersten und letzten Reise dieses legendären Schiffes erzählte
„Natürlich hatte dieses Geschenk nur den Zweck, auf ihn zurückzustrahlen, Caledon Hockleys Größe zu illuminieren. Es war ein kalter Stein … ein Herz aus Eis“, sagte sie und holte ihr Publikum damit wieder in die Gegenwart auf der Keldysh zurück. „Und nach all den Jahren fühle ich noch, dass es sich wie ein Hundehalsband um meine Kehle legte. Ich kann noch immer sein Gewicht spüren. Wenn Sie das gefühlt hätten, nicht nur gesehen …“
„Nun, das ist genau das, was uns vorschwebt, meine Liebe“, warf Brock ein.
„Äh, nur, dass ich das richtig verstanden habe: Sie hatten wirklich vor, sich umzubringen, indem sie von der Titanic springen wollten?“, hakte Lewis ein. „Is’ ja irre!“, jauchzte er und brach in schallendes Gelächter aus
„Lewis …“, versuchte Brock ihn zu bremsen, aber Rose stimmte in das Gelächter ein.
„Sie hätten bloß zwei Tage warten müssen“, kicherte Bodine und wischte sich die Lachtränen ab.
Lovett, der außerhalb von Roses Blickfeld stand, sah auf die Uhr. Er hatte ja nichts gegen spannende Geschichten, er hatte durchaus schon von so etwas profitiert, aber in diesem Fall lief ihm einfach die Zeit weg. Das dauerte hier definitiv zu lange.
„Rose, erzählen Sie uns doch mehr über den Diamanten. Was machte Hockley danach damit?“, fragte er. Rose sah ihn an und durchschaute die Absicht prompt. Nein, so schnell wollte sie ihn nicht von der Angel lassen – nicht, bevor sie nicht die ganze Geschichte losgeworden war und diesen Piraten davon überzeugt hatte, dass auf diesem Schiff Menschen gestorben waren. Menschen mit einer eigenen Geschichte, eigenen Schicksalen; Menschen mit ihrem ganz persönlichen Glück und ihren ebenso ganz persönlichen Katastrophen, auch unabhängig vom Untergang der Titanic. Die Titanic war wesentlich mehr gewesen als ein Luxusdampfer, mit dem durchaus Gegenstände von beträchtlichem Wert ins Reich von Davy Jones gesunken waren.
„Ich fürchte, ich bin ein bisschen müde, Mr. Lovett“, erwiderte Rose. Lizzy griff das Stichwort prompt auf und schob den Rollstuhl mit ihrer Großmutter aus dem Raum.
„Warten Sie!“, rief Lovett hinterher. „Können Sie uns etwas geben, damit wir weitermachen können? Etwa, wer Zugang um Safe hatte? Was ist mit diesem Lovejoy? Kannte er die Kombination?“
„Es ist genug für heute“, bremste Lizzy ihn aus. Sie schob den Rollstuhl weiter, Roses alte Hand winkte noch locker zum Abschied – schier wie zum Hohn.
Am folgenden Tag schwangen die Davits*, in denen die Mir-U-Boote hingen, wieder außenbords, um die Tauchboote erneut zu Wasser zu lassen. Lovett ging mit Buell über das Deck. Sie schlängelten sich zwischen Deckskränen, den Crews zum Ausbooten und Instandhaltungstrupps hindurch.
„Unsere Partner sind ziemlich angepisst“, warnte Buell.
„Bobby, verschaff’ mir Zeit! Ich brauche noch Zeit!“, keuchte Lovett.
„Wir verpulvern hier dreißigtausend am Tag – und wir sind sechs Tage über die Zeit!“, versetzte Buell. „Ich sag’ ihnen, was du mir gesagt hast, aber ich warne dich: Die Hand ist am Hebel und ist drauf und dran, die Reißleine zu ziehen.“
„Dann sag der Hand, ich brauche noch zwei Tage! Bobby, Bobby, Bobby … wir sind ganz nah dran! Ich rieche es, ich rieche das Eis! Sie hat den Diamanten getragen. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo er geblieben ist. Ich muss sie nur noch ein bisschen bearbeiten, okay?“
Brock drehte sich um und stand geradewegs Lizzy gegenüber. Er ging zu ihr und schob sie von Buell weg, zu einem ruhigeren Platz auf dem Deck.
„Hey, Lizzy, ich würde Sie gern mal ‘ne Sekunde sprechen“, flötete er. Lizzy sah ihn von oben bis unten an.
„Meinen Sie nicht eher, mich zu bearbeiten?“, fragte sie mit beißendem Spott. Brock seufzte. Sie hatte den letzten Satz offensichtlich mitbekommen und auf sich bezogen.
„Sehen Sie, mir läuft die Zeit weg. Ich brauche Ihre Hilfe“, entgegnete er.
„Ich werde Ihnen ganz bestimmt nicht helfen, meine hundertundein Jahr alte Großmutter unter Druck zu setzen. Ich bin hier runtergekommen, um Ihnen zu sagen, sie in Ruhe zu lassen“, versetzte Lizzy eisig. Lovett packte die nackte Verzweiflung.
„Lizzy, Sie sollten etwas wissen: Ich habe alles in die Suche nach dem Herz des Ozeans gesteckt; alles, was ich habe. Meine gesamte Kohle steckt in diesem Unternehmen; meine Frau hat sich über dieser Jagd von mir scheiden lassen. Ich brauche das, was in den Erinnerungen Ihrer Großmutter verschlossen ist“, erklärte er ohne weitere Verbalarabesken. „Sehen Sie das? Genau das hier?“, fuhr er fort und hielt seine Hand auf. Lizzy sah auf seine Handfläche. Sie war leer, aber leicht gewölbt, als ob er sie um ein imaginäres Stück von der Größe eines Hühnereies gelegt hatte.
„Was?“, fragte sie verständnislos.
„Genau so wird meine Hand aussehen, wenn sie sich um das Ding schließen wird. Verstehen Sie? Ich werde hier nicht ohne das Teil verschwinden, klar?“
Lizzy verstand ihn besser, als es für ihn zunächst den Anschein hatte. Sie zuckte mit den Schultern.
„Sehen Sie, Brock, sie macht das auf ihre Art, in der Zeit, die sie dafür braucht. Vergessen Sie nicht, dass sie den Kontakt mit Ihnen gesucht hat. Sie ist aus ihren eigenen Gründen hier draußen. Gott allein weiß, welche das sind.“
„Will sie vielleicht ihren Frieden mit der Vergangenheit machen?“, mutmaßte Lovett.
„Welche Vergangenheit?“, fragte Lizzy, erneut mit den Schultern zuckend. „Bis vor zwei Tagen hat sie nie – nicht ein einziges Mal – ein Wort darüber verloren, dass sie auf der Titanic war.“
Er nickte.
„Dann treffen wir allesamt Ihre Großmutter zum ersten Mal“, konstatierte er mit einem Seufzen. Da lag noch harte Arbeit vor ihm – sowohl, was Rose betraf als auch seine Geldgeber …
Im Computerraum startete Bodine wieder den Kassettenrecorder. Rose starrte auf den Bildschirm, auf dem Livebilder vom Wrack zu sehen waren, die Snoop Dog gerade übertrug. Der Tauchroboter glitt an der Steuerbordseite des Rumpfes in Richtung Heck. Die rechteckigen Fensterausschnitte wanderten nach rechts aus dem Bild.
„Der nächste Tag. Ich erinnere mich, wie sich das Sonnenlicht anfühlte … als ob ich jahrelang keine Sonne auf mir gespürt hätte “, begann sie ihre Erzählung. Die Zuhörer waren sofort wieder von ihrer plastischen Erzählweise gefangen und tauchten ebenso wie Rose in die Vergangenheit ein und hatten das Gefühl, mit ihr zusammen auf dem sonnenüberfluteten Deck der Titanic zu stehen. Der rostige Rumpf wurde in ihrer Vorstellung wieder zur nagelneuen, strahlenden Titanic des Jahres 1912.
***
Es war Samstag, der 13. April 1912. Rose trat in das strahlende Licht des Tages, ging entschlossen zum Ende des Bootsdecks der Ersten Klasse, öffnete die Tür der Reling und stieg auf das Freideck der Dritten Klasse hinunter. Dort hielten sich praktisch ausschließlich männliche Passagiere draußen auf, die von Roses schöner Erscheinung augenblicklich so fasziniert waren, dass sie sofort mit dem aufhörten, was sie gerade taten und der schönen jungen Frau hinterher sahen. Rose kümmerte sich nicht um sie, sondern hielt geradewegs auf den Zugang zum Aufenthaltsraum der Dritten Klasse zu. Dieser Aufenthaltsraum war das soziale Zentrum des Lebens im so genannten Zwischendeck. Er hielt keinem Vergleich mit der Opulenz der Ersten Klasse stand, aber es war ein lauter, wilder Platz voller Leben. Mütter mit Babys saßen auf den Bänken, Kinder tobten dazwischen herum, in diversen Sprachen durcheinander schreiend. Alte Frauen riefen durcheinander, Männer spielten Schach, junge Mädchen stickten oder lasen Groschenromane. Sogar ein Piano stand hier, auf dem Tommy Ryan herum klimperte. Drei Jungen tollten umher, jagten eine Ratte unter die Bänke, droschen mit Schuhen auf sie ein, verursachten damit fast vollständiges Chaos.
Fabrizio versuchte angestrengt, bei einer hübschen Norwegerin namens Helga Dahl, die mit ihrer Familie um einen der Tische saß, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen.
„Nicht mal ein kleines bisschen Italienisch?“ fragte er. „Vielleicht ein bisschen Englisch?“
„Nein, nein. Norwegisch. Nur“, kratzte sie ihren begrenzten englischen Sprachschatz zusammen. Etwas forderte ihre Aufmerksamkeit, und sie richtete ihren Blick darauf. Fabrizio bemerkte das gleiche und folgte Helgas Blick. Jack, der mit der fünfjährigen Cora Cartmell auf einer Bank saß und mit ihr zusammen lustige Gesichter in seine Skizzenmappe malte, wurde neugierig und sah in die gleiche Richtung, in die auch sein Freund peilte – und sah Rose.
Das Leben im Raum erstarrte plötzlich, als auch andere auf die ungewöhnlich schöne Erscheinung aufmerksam wurden. Es wurde mucksmäuschenstill. Es war nicht allein ihr königliches Auftreten, es war in diesem Fall auch ihr Kleid, das die Aufmerksamkeit erregte und handfest bewies, dass sie hier nicht hergehörte: Es war ein leichtes Tageskleid aus goldfarbenem Satin mit einem breiten Gürtel aus dem gleichen Material, der sich an diesem Kleid tatsächlich um die schmale Taille schlang und mit einer ovalen Schnalle verschlossen war, die wie eine handgroße Brosche wirkte. Darüber trug sie ein schon auf halber Höhe des Busens endendes extra kurzes Boleroteil aus weißer Seide mit doppelten Ärmeln – einem kurzen Oberärmel und ergänzend dazu einem darin eingesetzten langen Unterärmel – das an den Schulternähten, dem Saum des kurzen Oberärmels und dem kleinen Stehkragen mit goldfarbenen Ranken bestickt war.
Rose spürte plötzlich eine ziemliche Verlegenheit, als die Zwischendeckpassagiere sie anstarrten, als sei eine Prinzessin – manche mit Abneigung, manche mit Ehrfurcht. Dann sah sie Jack und schenkte ihm ein kleines Lächeln, ging direkt auf ihn zu. Er erhob sich höflich, um sie zu begrüßen und lächelte.
„Hallo, Jack“, grüßte sie freundlich.
Fabrizio und Tommy waren platt vor Staunen und bekamen den Mund fast nicht mehr zu. Das war eine Situation wie der Moment im Märchen, wenn Cinderella der Schuh passte … Nur, dass hier die Prinzessin ihrem männlichen Aschenbrödel den Schuh anzog …
„Auch hallo“, grüßte Jack mit einem sanften Lächeln.
„Könnte ich Sie einen Moment allein sprechen?“, fragte sie.
„Oh … ja. Natürlich. Nach Ihnen“, sagte er und lotste sie wieder zurück, folgte ihr. Fabrizio und Tommy warf er einen Blick über die Schulter zu, eine Augenbraue hochgezogen – von wegen: Da ist kein Herankommen …
Wenig später spazierten sie auf dem B-Deck, dem Bootsdeck der Ersten Klasse. Rose wollte den jungen Mann, der ihr Leben gerettet hatte, gern etwas näher kennen lernen – und damit der Anstand sicher gewahrt wurde, ging das am besten mit einem Spaziergang in aller Öffentlichkeit, so dass jeder sehen konnte, dass nichts geschah, was ihre Ehre in irgendeiner Form in Gefahr geraten lassen würde.
„Seit meinem fünfzehnten Lebensjahr bin ich auf mich allein gestellt. Da sind meine Eltern gestorben. Ich hatte keine Geschwister und keine Verwandten in der Gegend. Also hab’ ich das Weite gesucht und bin seitdem auch nicht mehr da gewesen. Ich bin wie ein Blatt, das vom Wind hin und her geweht wird“, berichtete er. Dann verzögerte er den Schritt. „Also … Rose …“, setzte er vorsichtig an, „wir sind jetzt etwa eine Meile auf diesem Deck herumgelaufen, haben darüber geredet, was für ein herrliches Wetter wir haben und darüber wie ich aufgewachsen bin. Aber das war sicher nicht der Grund, weshalb sie mich sprechen wollten“; sagte er. Rose knetete verlegen die Hände.
„Mr. Dawson, ich …“, setzte sie nun ihrerseits zögernd an.
„Jack!“, korrigierte Dawson mit einem sanften Lächeln.
„Jack …“, probierte sie vorsichtig die vertrauliche Anrede aus und hoffte, dass niemand mitbekam, dass sie den Zwischendeckpassagier mit Vornamen anredete. „Ich wollte mich bei Ihnen bedanken. Nicht nur dafür, dass Sie … dass Sie mich wieder heraufgezogen haben, sondern auch für Ihre Diskretion“, sagte sie. Jack lächelte sie freundlich an.
„Gern geschehen“, erwiderte er.
„Hören Sie …“, fuhr sie fort und wandte sich von ihm ab. „Ich kann mir gut vorstellen, was Sie von mir denken: armes, kleines reiches Mädchen. Was weiß die schon vom Elend“, mutmaßte sie und sah wieder vorsichtig zu ihm zurück. Er trat an die Reling und hielt sich an einer der Wanten* fest, die einen der Schornsteine fixierten.
„Nein“, widersprach er, „das hab’ ich nicht gedacht. Ich hab’ mir gedacht: Was kann diesem Mädchen zugestoßen sein, dass sie glaubt, keinen Ausweg mehr zu haben?“, gab er seine Gedanken preis. Rose sah ihn an und fand Ehrlichkeit in seinem Blick. Sie beschloss, ihn über ihre Situation aufzuklären.
„Nun ja, es … es gibt sehr viele Gründe dafür“, setzte sie an, machte eine schrecklich hilflos wirkende Bewegung mit beiden Armen und trat ebenfalls an die Reling. „Meine ganze Welt und alle Menschen darin. Die Leere, die sich in meinem Leben ausbreitet und meine Machtlosigkeit, etwas dagegen zu unternehmen“, sagte sie, was für Jack zunächst noch etwas rätselhaft klang. Sie streckte ihm ihre linke Hand entgegen, an der ein diamantbesetzter Verlobungsring im Sonnenlicht glitzerte. Jack bekam große Augen.
„Oh, Gott! Was für ein Klunker!“, stieß er hervor. „Damit wär’n Sie ganz sicher untergegangen“, setzte er scherzend hinzu.
„Fünfhundert Einladungen sind verschickt worden. Die ganze Gesellschaft von Philadelphia wird da sein! Und die ganze Zeit habe ich das Gefühl, ich stehe in der Mitte eines überfüllten Raumes und schreie aus vollen Leibeskräften, doch niemand sieht auch nur zu mir hoch“, erklärte sie ihre Not. Jack begriff, dass es ihr vor der offiziellen Verlobung und wohl auch vor der Ehe mit dem Mann, den er bei ihr gesehen hatte, graute. Er fragte er sich im Stillen, weshalb sie dem Typen nicht den Laufpass gab, wenn das so war.
„Lieben Sie ihn?“, fragte er. Rose sah ihn an, als wären ihm Hörner gewachsen.
„Wie bitte?“, hakte sie nach, weil sie meinte, sich verhört zu haben.
„Lieben Sie ihn?“, wiederholte Jack.
„Sie sind sehr taktlos! Sie dürfen mich so etwas nicht fragen!“, wies sie ihn zurecht. Diese Frage stellte man in ihren Kreisen nicht – erstens deshalb, weil Liebe in dieser gesellschaftlichen Größenordnung keine Rolle spielte und Geld gerne mit Geld verheiratet wurde, um es zu vermehren. Gefühle störten da nur. Zum anderen, weil die Frage gesellschaftsmoralisch in etwa der gleichkam, ob sie nackt auf dem Times Square mit ihrem Verlobten tanzen würde …
Jack fand allerdings nichts Falsches an seiner Frage. In seinen Kreisen wurde in der Regel aus Liebe geheiratet. Ob das ein Leben lang hielt, mochte eine andere Frage sein, aber man entschied sich bewusst füreinander, weil man sich mochte. Selbst wenn die Frage der Versorgung durchaus eine Rolle spielte, suchte sich das einfache Volk immer noch einen Partner fürs Leben, den man jedenfalls zu dem Zeitpunkt gut leiden konnte, an dem man sich für diese Person entschied. Ihre Reaktion zeigte die ganze Diskrepanz ihrer gesellschaftlichen Stellung und Weltanschauung.
„Ist doch ’ne ganz einfache Frage“, bohrte er hartnäckig weiter. „Lieben Sie den Kerl oder lieben Sie ihn nicht?“
„Hä? Das ist ja wohl kein Thema für eine Konversation!“, giftete sie. Jacks Lächeln verbreiterte sich noch. Irgendwie war sie richtig süß, wenn sie sich aufregte …
„Wieso können Sie nicht einfach antworten?“, fragte er mit einem unübersehbaren Grinsen im Gesicht. Rose allerdings regte sich nicht künstlich auf. Die Frage nach Liebe gehörte sich einfach nicht – so war sie erzogen worden. Sie lachte gereizt auf, warf die Hände in einer geradezu verzweifelten Geste hoch. Das kam davon, wenn man sich mit dem einfachen Pack einließ, schienen ihr Engelchen und Teufelchen gleichzeitig zu sagen, die es sich in imaginärer Gestalt auf ihren Schultern bequem gemacht hatten.
„Das ist absurd!“, stieß sie hervor. „Sie kennen mich nicht und ich kenne Sie nicht! Und wir sollten nicht so eine Unterhaltung führen!“
Sie nahm seine Hand und schüttelte sie – viel zu lange. Jack überließ sie ihr mit einem spöttischen Lächeln. Wirklich niedlich, wie sie sich gerade aufplusterte …
„Sie sind taktlos, ungehobelt und unverschämt und ich … werde jetzt gehen. Jack – Mr. Dawson – es war mir ein Vergnügen. Ich wollte Sie sehen, um mich bei Ihnen zu bedanken. Das hab’ ich auch getan …“
„… und Sie haben mich beleidigt“, grinste Jack und schüttelte weiterhin ausdauernd ihre Hand.
„Sie haben es auch verdient!“, grollte sie.
„Genau“, schmunzelte er.
„Genau“, bestätigte sie.
„Ich dachte, Sie wollten gehen“, spöttelte er, als sie immer noch seine Hand hielt, sie kräftig schüttelte und keine Anstalten machte, das Deck zu verlassen.
„Ja, das tue ich auch!“, knurrte sie, drehte sich um, und setzte zum Gehen an. „Über Sie kann man sich wirklich ärgern!“, schnaubte sie noch. Jack konnte sich nicht mehr beherrschen und lachte los.
Im selben Moment fiel ihr ein, wo sie tatsächlich waren. Sie machte wieder kehrt.
„Warten Sie! Das ist mein Bereich des Schiffes! Ich brauche gar nicht zu gehen! Sie werden gehen!“, fauchte sie und machte eine hinfort weisende Handbewegung.
„Hohoho, sieh an, sieh an! Wer ist hier taktlos?“, stimmte er – sich weiterhin köstlich über sie amüsierend – in ihren Streitton ein. Rose wirkte ertappt. Sie hatte ihn hierher eingeladen … Es war unhöflich, ihn nun fortzujagen. Ganz abgesehen davon, dass er sich nicht fortjagen ließ. Sie bemerkte die Ledermappe, die er die ganze Zeit unter dem Arm trug. Mit einem schnellen Griff schnappte sie sich die Mappe.
„Was ist das eigentlich Albernes, was Sie da mit sich herumtragen?“, fuhr sie ihn im Kontrolleurston an. „Was sind Sie? Ein Künstler oder so etwas?“, versetzte sie schnippisch und begann, in der Mappe zu blättern. Jack ließ sie gewähren. Es dauerte nur Sekunden, bis sie stutzte. Das, was sie hier zu sehen bekam, waren Zeichnungen von jemandem, der davon etwas verstand …
„Also … die sind ziemlich gut“, gestand sie zögernd ein und setzte sich mit der Mappe auf einen freien Deckstuhl. „Die sind … äh … sehr gut, um ehrlich zu sein. Jack, das sind hervorragende Arbeiten!“
Das klang absolut ehrlich und war auch so gemeint, wie er schnell feststellte. Er setzte sich auf den Stuhl links neben ihr, knetete die Hände und stützte sich mit den Unterarmen auf den Knien ab. Er zuckte mit den Schultern. Enttäuschung warf Schatten auf sein bisher so sonniges Lächeln.
„Im alten Pari’“ – er sprach es französisch aus – „war’n sie davon nicht so begeistert“, sagte er.
„Paris?“, hakte sie nach um sicherzugehen, dass sie ihn richtig verstanden hatte. Er nickte nur. Rose begriff, dass er dort nichts damit verdient hatte … Das Bild, das sie gerade ansah war wohl auch das, was man am Ende dieses noch so jungen Jahrhunderts recycelt nennen würde: Es zeigte eine Frau mit Hut und Mantel mit Pelerine und Fuchsfell. Den Mantel hatte sie geöffnet und die Brüste freigelegt, um dem Kind in ihren Armen die Brust zu geben. Nachdem es offenbar keinen Käufer gefunden hatte, hatte Jack den linken Teil der freien Fläche für die Studie eines verschränkten Handpaares genutzt.
„Sie kommen ja viel herum für einen A…“, setzte sie an, brach aber ab, weil ihr das Wort beleidigend erschien, das sie beinahe benutzt hätte. „Na ja, für jemanden mit begrenzten Mitteln …“, entsann sie sich einer höflicheren Formulierung. Jack fand sein strahlendes Lächeln wieder.
„Raus mit der Sprache: für einen armen Kerl. Sie können’s ruhig sagen“, erwiderte er mit dem ihm eigenen sonnigen Lächeln. Rose blätterte weiter. Sie fand das Bild eines kleinen Mädchens, das nackt auf dem Schoß seines Großvaters saß. Von dem Großvater war kaum mehr zu sehen als die großen Hände, die die Kleine hielten. Dann fand sie Aktzeichnungen, teilweise ebenfalls zusätzlich für Detailstudien genutzt. Die Zeichnungen wirkten derart lebensecht, dass sie das Gefühl hatte, die gezeichneten Frauen würden sich im nächsten Moment bewegen.
„Wunderbar! Fantastisch!“, schwärmte sie „Haben Sie das nach lebenden Modellen gezeichnet?“, fragte sie und schloss die Mappe, als jemand vorüberging. Besonders ältere Herrschaften – ganz speziell die Damen der Gesellschaft – waren überaus prüde, schienen zu fürchten, beim Anblick nackter Körper blind zu werden und hätten sie sicher gehörig angefahren, hätte sie gesehen, was sie so faszinierte.
„Ja, das ist eine der guten Seiten von Paris. Viele Frauen sind bereit, ihre Sachen auszuziehen“, sagte er. Rose blätterte weiter
„Diese Frau mochten Sie“, bemerkte sie. „Sie haben sie mehrere Male gezeichnet.“
„Sie … äh … hat wundervolle Hände. Sehen Sie“, warf Jack ein und blätterte weiter. Die Studie einer weiblichen Brust mit einer davor gehaltenen Hand kam zum Vorschein, dann beide Hände, die offenbar hinter den Rücken gehalten wurden.
„Ich könnte mir vorstellen, Sie hatten eine Affäre mit ihr …“, mutmaßte Rose mit einem schelmischen Lächeln.
„Nein, nein, nein“, entgegnete er. „Nur mit ihren Händen. Sie war … eine einbeinige Prostituierte.“
Er blätterte weiter und zeigte Rose ein Bild, das sie ganz zeigte.
„Oh …“, bemerkte sie mit gewisser Verlegenheit.
„Tjaaa … Sie hatte Sinn für Humor.
Er blätterte noch weiter und zeigte ihr das Bild einer älteren Dame, die mit Hut und Mantel an einem Tisch saß, vor sich ein Glas Wein, die über und über mit Schmuck behangen war. Nur der rechte Ringfinger war ohne Ring.
„Oh, und diese Dame hier … sie saß jeden Abend in einer Bar“, kommentierte er. „Sie trug allen Schmuck, den sie besaß und … äh … wartete auf ihre längst verflossene Liebe. Wir nannten sie Madame Bijoux. Ihre Sachen … waren ganz mottenzerfressen.
„Ach … wirklich … Sie haben Talent, Jack. Ganz ehrlich. Sie sehen die Menschen“, lobte sie seine Kunst. Es klang absolut ehrlich und aufrichtig. Er sah sie von unten her an.
„Ich sehe Sie“, sagte er – und auch das klang sehr ehrlich, schon fast vertraulich, so wie er leise sprach. Rose konnte nicht anders, als den vorsichtigen Flirt aufzugreifen.
„Und?“, fragte sie kokett. Jack sah sie ernsthaft an, für einen Flirt viel zu ernsthaft.
„Sie wär’n nicht gesprungen“, stellte er fest.
Kapitel 9
Peinlichkeiten
Ruth DeWitt Bukater saß mit Lucy Noël Martha Dyer-Edwards, der Gräfin von Rothes, beim Tee in der Empfangshalle des D-Decks. Die Damen unterhielten sich über Bildung im Allgemeinen und Universitäten im Besonderen.
„Der Zweck einer Universität ist, dort einen geeigneten Ehemann zu finden“, gab Ruth ihre persönliche Vorstellung von der Daseinsberechtigung einer solchen Bildungseinrichtung preis, jedenfalls, wenn es um darum ging, ob Frauen Universitätsbildung haben sollten.
„Und das ist Rose bereits gelungen“, setzte sie hinzu, womit sie klarstellen wollte, dass ihre Tochter auf einer Universität nun sicher nichts mehr zu suchen hatte. Die Gräfin saß im rechten Winkel zu Ruth und hatte die Rezeption im Blick, wo in diesem Moment gerade Molly Brown um die Ecke kam.
„Sehen Sie nur, da kommt Mrs. Brown, diese vulgäre Person“, zischte sie mit aller Verachtung, die der alte Adel einer solchen neureichen Person entgegenbrachte. Ruth hatte die bemerkenswerte Fähigkeit, missachtenswerte Menschen wahrzunehmen, ohne sie anzusehen. Sie spürte Mollys Anwesenheit und sah doch stur geradeaus.
„Schnell, stehen wir auf, bevor sie sich zu uns setzt“, entschied sie. Doch Molly Brown war ebenfalls mit Scharfblick gesegnet und hatte ihre angestrebten Gesprächspartnerinnen bereits gesichtet. Sie kam näher.
„Hallo, Mädels!“, grüßte sie burschikos. „Ich hatte gehofft, Sie hier beim Tee zu treffen“, sagte sie. Ruth sah sie geradezu von oben herab an, obwohl sie noch nicht einmal ganz aufgestanden war.
„Den haben Sie verpasst. Wir sind untröstlich“, erwiderte sie. Es war deutlich zu hören, dass sie ganz und gar nicht traurig war, Molly nicht beim Tee dabei gehabt zu haben. „Die Komtesse** und ich wollten uns gerade auf dem Bootsdeck ein wenig die Füße vertreten“, setzte sie hinzu. Molly Brown ließ sich nicht davon beeindrucken, zwischen den Worten herauszuhören, dass sie eigentlich nicht zur Begleitung ausersehen war.
„Toll“, frohlockte sie vielmehr, „dann könnte ich meinen Klatsch und Tratsch auf den neuesten Stand bringen.“
Die Damen, die beim Tee gesessen hatten, wollten die Amerikanerin ignorieren und schwebten geradezu an ihr vorbei, aber Molly ließ nicht locker. Mit freundlichem Lächeln wandte sie sich der Gräfin zu.
„Guten Tag, Komtesse …“, grüßte sie. Eisig schweigend ging die Gräfin an ihr vorbei, Molly folgte ihnen hartnäckig.
Alle gingen an einem Tisch vorbei, an dem Bruce Ismay und Captain Smith saßen. Ismay rauchte eine Zigarette und sah auf gefaltete Papiere in seiner rechten Hand, die den Tagesbericht enthielten.
„Die letzten vier Kessel sind also noch gar nicht angefeuert worden“, stellte der Reedereivorstand fest. Es klang nur mäßig begeistert. Der Umstand entsprach offensichtlich nicht seinen Vorstellungen davon, wie dieses Schiff gefahren zu werden hatte. Captain Smith schüttelte sein in Ehren weiß gewordenes Haupt.
„Nein, ich sehe keinen Grund dazu“, entgegnete er. „Wir liegen hervorragend in der Zeit.“
Ismay faltete den Bericht wieder zusammen.
„Die Presse kennt die Größe der Titanic. Jetzt will ich, dass sie ihre Geschwindigkeit bewundert. Wir müssen ihnen etwas Neues zu berichten geben“, sagte er und nahm die Hände zum Reden zu Hilfe. „Die Jungfernfahrt der Titanic muss unbedingt Schlagzeilen machen.“
So, wie er bestimmt gestikulierte, duldete seine Rede keinerlei Widerspruch. Doch Smith hatte gute Gründe, mit dem nagelneuen Schiff vorsichtig umzugehen.
„Mr. Ismay …“, setzte er gleichwohl leicht zögernd an. Der Vorstand der Reederei kam nach seiner eigenen Auffassung gleich nach Gott, wenn nicht noch davor, dessen war Smith sich bewusst. Wenn er dessen Wünschen widersprach, konnte er das nur mit äußerster Vorsicht tun.
„Ich würde die Maschinen ungern unter Volllast laufen lassen, solange sie nicht eingefahren sind“, gab er seinen Bedenken Ausdruck.
Ismay nahm einen tiefen Zug aus seiner Zigarette. Er liebte es nicht, wenn man ihm widersprach. Andererseits war sein Fachgebiet die kaufmännische Seite der Reederei. Er war kein Nautiker. Er beugte sich etwas vor.
„Ich bin nur ein Passagier. Ich überlasse es Ihrem Sachverstand, zu entscheiden, was am besten ist“, räumte er ein, um gleich darauf nachzusetzen: „Aber was wäre es für ein grandioser Abschluss Ihrer letzten Überfahrt, wenn wir schon Dienstagabend in New York einlaufen und alle überraschen würden! Es wäre in allen Morgenzeitungen. In den Ruhestand mit einem Feuerwerk! Na, E. J.?“
Smith wurde das Gefühl nicht los, dass Ismay eher eine Meuterei anzetteln würde, als auf den Captain dieses Schiffes zu hören. Wer konnte schon wissen, was für Schwierigkeiten er ihm noch machen würde, wenn er sich diesen Wünschen nicht beugte. Zögernd nickte der Captain. Ismay lächelte maliziös.
„Guter Mann“, lobte er. Er bekam eben immer, was er wollte …
Rose und Jack spazierten noch immer über das Deck, kamen an Passagieren vorbei, die im sich neigenden Tageslicht in Deckstühlen den Tag genossen, Stewards huschten herum, um Tee oder Kakao zu servieren. In Jacks Gesellschaft wurde Rose zu einer unbekümmerten Siebzehnjährigen, die aufgeregt und mädchenhaft von ihren Träumen sprach.
„Wissen Sie, es war schon immer mein Traum, das alles hinzuschmeißen und Künstlerin zu werden … in einer Dachkammer zu leben … arm, aber frei“, gab sie einen geheimen Wunsch preis. Jack bekam die Assoziation mit Carl Spitzwegs berühmtem Gemälde vom armen Poeten, der in seiner ungeheizten Dachkammer im Bett liegt, um sich warmzuhalten, einen Schirm aufgespannt hat, um sich der Undichtigkeit des Dachs zu erwehren … Er musste lachen.
„Das würden Sie keine zwei Tage durchhalten. Da gibt’s kein heißes Wasser, keinen Kaviar …“, spöttelte er. Rose blieb stehen und blitzte ihn an.
„Hör mal, Bursche: Ich hasse Kaviar!“, grollte sie. „Und ich habe die Leute satt, die mir über den Kopf streicheln und über meine Träume nur lachen können!“, fauchte sie in einem erneuten plötzlichen Wutausbruch. Jack spürte, dass er einen Fehler gemacht hatte. Anders als die so genannte gehobene Gesellschaft hatte er aber kein Problem damit, das auch zuzugeben.
„Es tut mir Leid. Wirklich. Entschuldigung“, bat er. Rose merkte, dass er es absolut ehrlich meinte. Er war anders als die anderen. Besonders anders als Cal, mit dem sie über ihre Träume gewiss nicht reden konnte – obwohl er den finanziellen Hintergrund hatte, ihr das oft mühsame Anlaufen einer Künstlerkarriere zu ermöglichen.
„Schon gut“, ruderte sie zurück und akzeptierte seine Bitte um Entschuldigung. „Da ist etwas in mir, Jack. Ich fühle es. Ich weiß nicht was es ist, ob ich eine Künstlerin sein sollte oder … ich weiß nicht … eine Tänzerin. Wie Isadora Duncan – ein wilder, heidnischer Geist“, sagte sie. Isadora Duncan, die berühmte Tänzerin und Choreografin, geboren in Amerika, hatte es in Europa zu Weltruhm gebracht, hatte mit dem Ausdruckstanz antike Vorbilder wiederbelebt und trug auch gern antike Kleidungsstücke wie den griechischen Chiton** oder die römische Tunika.
Rose sprang nach vorn, landete geschickt und wirbelte wie ein Derwisch herum. Es war erkennbar, dass sie Ballettunterricht gehabt hatte. Ihr Gesicht leuchtete noch mehr auf, als es das bereits ob dieser gelungenen Übung tat, denn weiter vorn hatte sie etwas erspäht.
„… oder eine Filmschauspielerin“, fügte sie hinzu, nahm Jack bei der Hand und rannte mit ihm dorthin, wo Mary und Daniel Marvin auf dem Deck waren. Daniel drehte einen Film, kurbelte an seiner großen hölzernen Kamera, was das Zeug hielt, während Mary immer noch steif wie die Gliederpuppe eines Malers an der Reling posierte.
„Du bist traurig. Traurig, traurig, traurig. Du hast deinen Liebsten an Land zurückgelassen. Vielleicht wirst du ihn nie wiedersehen. Versuch’, noch etwas trauriger zu sein, Liebling“, gab er Regieanweisungen. Mit einem Mal platzte Rose in die Aufnahme und warf sich in eine theatralische Pose gleich neben Mary, die in Gelächter ausbrach. Rose zog auch Jack ins Bild und animierte ihn, ebenfalls zu posieren. Er ließ sich nicht zweimal bitten.
Daniel Marvin lächelte und ergriff die sich bietende Gelegenheit beim Schopf, improvisierte Szenen eines Stummfilms zu drehen. Er gestikulierte und gab lauthals Regieanweisungen. Mary, Rose und Jack spielten vor der Kamera, wie Daniel es ihnen ansagte: Rose posierte in tragischer Haltung an der Reling, den Handrücken in schierer Verzweiflung vor die Stirn drückend – deutlich besser als Mary zuvor, die diese Tragik nicht auszudrücken vermochte. Mal gaben die Mädchen die Sklavinnen, die dem als Pascha im Deckstuhl lümmelnden Jack Luft zufächelten; mal kniete Jack händeringend und flehend wie ein jammervoller Romeo vor Rose, die eine ge-langweilte Julia spielte und sich voller Verachtung von ihm abwandte. Dann drehte Rose, während Jack und Daniel sich ein dramatisches Westernduell lieferten, das Jack gewann, sich grinsend der Kamera zuwandte und einen imaginären Schnurrbart zwirbelte wie der Serial-Bösewicht Snidely Whiplash.
Den ganzen Nachmittag über amüsierten sich die jungen Leute auf diese Weise. Als das Licht sich zum westlichen Horizont neigte, die Sonne das Schiff und seine Passagiere in orangerotes Licht tauchte, standen Rose und Jack Schulter an Schulter an der Backbordreling des Promenadendecks der Ersten Klasse. Es war ein wahrhaft magischer Moment, ein perfekter Augenblick.
„Und wie ging es dann weiter, Mr. Wandering Jack?“, erkundigte sich Rose mit einem spitzbübischen Lächeln, das so dekorative Grübchen um ihre Mundwinkel erscheinen ließ.
„Später hab’ ich auf einem Fischerboot in Monterrey gearbeitet. Als das in Arbeit ausartete, ging ich zum Santa-Monica-Pier in Los Angeles. Das is’ ‘n toller Platz! Die haben sogar eine Achterbahn da! Dort hab’ ich angefangen, für zehn Cent das Stück Porträts zu zeichnen“, sagte er.
„Ein ganzes Porträt für zehn Cents?“ hakte sie verblüfft nach. Gegen Jack war der billige Jakob ein Wucherer … Er begriff nicht, was sie meinte.
„Ja, das war richtiges Geld“, erwiderte er, durchaus stolz auf dieses selbst erarbeitete Geld. „Manchmal habe ich einen Dollar am Tag verdient – aber nur im Sommer. Als es kalt wurde, bin ich nach Paris gegangen, um zu sehen, was richtige Künstler tun.“
Sie wandte sich wieder der sinkenden Sonne zu, seufzte leise.
„Wieso kann ich nicht wie Sie sein, Jack? Einfach auf den Horizont zugehen, wann immer mir danach ist?“
Sie machte eine Pause und wandte sich wieder Jack zu.
„Warum fahr’n wir nicht mal gemeinsam zu dem Pier? Und sei’s drum, dass wir nur darüber reden …“, fragte sie ihn. Er lächelte.
„Nein, wir werden es machen“, entgegnete er. „Wir trinken Bier, wir fahr’n mit der Achterbahn bis uns schlecht wird“, entwarf er einen Reiseplan. Rose lachte amüsiert.
„Wir mieten uns ‘n paar Pferde am Strand und reiten durch die Brandung“, fuhr er fort. „Sie müssen dann wie ‘n richtiger Cowboy reiten. Vergessen Sie diesen Damensattel.“
Rose sah ihn verblüfft an.
„Sie meinen … ein Bein auf jeder Seite???“, entfuhr es ihr. Sie ging beinahe in Deckung, als sie das halblaut aussprach. Wie skandalös! Und wie aufregend … Jacks Lächeln wurde zu einem breiten Grinsen.
„Ja“, bestätigte er. Rose musste schlucken.
„Zeigen Sie mir das?“, fragte sie beinahe schüchtern.
„Klar, wenn Sie woll’n?“, versprach er.
„Sie bringen mir bei, wie ein Mann zu reiten“, hakte sie nochmals nach. Er nickte.
„Und wie ein Mann Tabak zu kauen“, setzte er hinzu.
„Und wie ein Mann zu spucken“, ergänzte sie amüsiert, ohne es wirklich ernst zu meinen.
„Haben Sie das etwa auf der Höheren Töchterschule nicht gelernt?“, erkundigte er sich spöttisch.
„Nein“, lachte sie. Er nahm sie bei der Hand.
„Kommen Sie, ich zeig’s Ihnen. Na los!“, rief er fröhlich.
„Was?“, fragte sie verstört. Das meinte er doch wohl nicht ernst!
„Kommen Sie, ich zeig Ihnen wie das geht“, sagte er und zog sie von der Reling weg. Rose realisierte, dass er ihr tatsächlich Unterricht im Weitspucken geben wollte. Ihre Erziehung trat umgehend auf die Bremse.
„Nein!“, protestierte sie und wollte ihn zurückhalten. Er ließ nicht locker.
„Kommen Sie!“, wiederholte er und zog sie einfach mit sich.
„Nein, Jack!“
„Keine Angst“, beruhigte er sie, aber Rose war klar, dass das einfach unmöglich war – und nicht nur, weil sie sich auf einem Erster-Klasse-Deck befanden …
„Warten Sie, Jack! Nein!“
„Kommen Sie!“
„Nein, Jack, das geht auf gar keinen Fall!“
Doch ihr dauernder Protest prallte an ihm ab wie das Wasser vom Bug der Titanic. Er zerrte sie zum überdachten Teil des Decks, wo bei entsprechenden Übungen niemand getroffen werden konnte, weil hier nur die glatte Schiffswand unter ihnen war. Jack nahm zum Reden eine Hand zu Hilfe, als er sagte:
„Sehen Sie genau zu.“
Er zog mit der Nase hoch, bog den ganzen Oberkörper nach hinten, holte Schwung und spie mit diesem Schwung kräftig über Bord
„Das ist ja ekelerregend!“, rief sie geradezu angewidert. Jack störte sich nicht daran.
„Gut. Jetzt sind Sie dran“, lächelte er. Sie tat es ihm gleich, aber es wurde ein Miniaturspritzer.
„Das war erbärmlich“, kritisierte er ihren untauglichen Versuch. „Na los! Sie müssen es von ganz tief unten hochholen“, ergänzte er und führte es ihr nochmals vor.
„Ungefähr so. Dann zurück, den Hals zurück“, kommentierte er und schleuderte nochmal ordentlich was von sich. „Haben Sie gesehen, wie weit das war?“, jubelte er über den Erfolg wie ein kleiner Junge. Rose bestätigte mit zustimmendem Brummen und bekam nun doch Spaß daran.
„Okay, versuchen Sie’s“, sagte er. Sie folgte seiner Lehre. Das Ergebnis war schon anders als vorher.
Nicht weit von den jungen Leuten entfernt, spazierten Ruth DeWitt Bukater, die Gräfin von Rothes und Margaret Brown über das Deck in Richtung Heck, steuerten genau auf Jack und Rose zu, die davon freilich nichts ahnten.
„Das war schon besser“, lobte er Roses Bemühungen, „aber Sie müssen noch etwas üben“, sagte er. Ruth, die Gräfin und Molly hatten Lehrer und Lernende erreicht und sahen mit blankem Entsetzen, was da geschah. Rose bemerkte sie und schüttelte Jack mehrfach am Arm, um ihn an der Ausführung zu hindern, aber er bekam es in seinem Lehreifer nicht mit.
„Versuchen Sie, ganz viel zusammenzukriegen, dann ist es einfacher. Schön hochziehen“, sagte er und machte es gleich erneut vor. Erst jetzt wirkte Roses Bremse mit der Folge, dass nicht alles wegflog, sondern etwas an seinem Kinn hängenblieb. Er drehte sich um und wäre nun doch beinahe im Erdboden versunken, wären nicht Schiffsplanken und Wasser dazwischen gewesen. Rose versuchte mit nervösem Lachen die Situation zu retten:
„Mutter … Darf ich dir Jack Dawson vorstellen?“
Ruth sah den jungen Mann an und hatte einen derart kalten Blick, dass Eiszapfen an ihren Worten zu hängen schienen, als sie sagte:
„Ich bin entzückt.“
Selten war die damit eigentlich verbundene Anerkennung des Gegenübers mit größerer Falschheit ausgesprochen worden als diese. Molly, die einen Schritt hinter Ruth stand, bemerkte den feuchten Klecks an Jacks Kinn und wies auf ihr eigenes Kinn. Er verstand und wischte eilig den Fleck des Anstoßes ab.
♦♦♦
„Die anderen waren dankbar und neugierig auf den Mann, der mir das Leben gerettet hatte. Aber meine Mutter sah ihn an wie ein … Insekt. Ein gefährliches Insekt, das schnellstens zerquetscht werden musste“, kommentierte die alt gewordene Rose auf der Keldysh das Verhalten ihrer Mutter und der beiden anderen Damen.
♦♦♦
Molly jedoch fand erheblich wärmere und ernster gemeinte Worte für den jungen Mann:
„Nun, Jack; klingt, als wär‘n Sie der Mann, den man in seiner Nähe haben sollte, wenn’s brenzlig wird.“
Im selben Moment trat hinter ihnen ein Steward auf das Deck hinaus und blies auf der Trompete das Signal zum Dinner. Alle zuckten erschrocken zusammen.
„Wieso machen die zum Essen immer so einen Krach, als würde ein ganzes Regiment angreifen?“, fasste Molly kopfschüttelnd den Unmut der vier Damen und des einen Herrn zusammen. Rose ergriff die Gelegenheit beim Schopf, um weitere Peinlichkeiten abzuwenden. Sie nahm ihre Mutter am Arm.
„Gehen wir uns umziehen, Mutter?“, fragte sie mit nervösem Lachen. Ruth nickte hoheitsvoll und wandte sich mit ihrem rebellischen Früchtchen ab, um zur Suite zwecks Umkleidens zurückzukehren. Rose drehte sich noch einmal um und winkte Jack.
„Wir sehen uns beim Dinner, Jack.“
Er sah ihr nach und gestand sich ein, von diesem Mädchen fasziniert zu sein. Molly erkannte die Gefahr, die dem jungen Mann drohte.
„Kleiner“, sprach sie ihn an, doch er war völlig von Rose abgelenkt wie schon am Abend zuvor, als er sie auf dem oberen Freideck gesehen hatte.
„Kleiner!“, machte Molly ihn etwas amtlicher auf sich aufmerksam. Er wendete ihr tatsächlich den Blick zu.
„Haben Sie die leiseste Ahnung, worauf Sie sich da einlassen?“, fragte sie, als er sie ansah. Er grinste jungenhaft.
„Nein, nicht so ganz“, räumte er ein.
„Nun, Sie begeben sich in eine Schlangengrube“, sagte sie und sah ihn von oben nach unten prüfend an. „Was wollten Sie eigentlich anziehen?“, erkundigte sie sich skeptisch. Er machte eine hilflose Geste. Er besaß nichts anderes, als das, was er gerade am Leibe trug.
„Dzzzz … hab’ ich mir doch gedacht!“, seufzte Molly. „Kommen Sie mit!“
Sie brachte Jack in ihre Suite, wo sie ihn zunächst ins Bad steckte. Während er badete, packte sie einen nagelneuen Frackanzug nebst Hemd, Weste und weißer Fliege aus, den sie für ihren Sohn in Paris hatte anfertigen lassen. Als Jack aus dem Bad kam, kleidete er sich mit Mollys Hilfe an. Zu guter Letzt zog sie ihm den Frack über.
„Ich wusste es!“, jubelte sie. „Sie und mein Sohn haben beinahe dieselbe Größe.“
Jack zupfte den Frack zurecht und betrachtete sich im Spiegel. Kleider machten Leute, diese Annahme galt immer noch. Er erkannte sich fast nicht wieder.
„Ja, fast“, bestätigte er. Mollys Blick glitt anerkennend über den eleganten jungen Mann. Er hatte schon in der einfachen Kleidung ganz annehmbar ausgesehen; jetzt – frisch gebadet, ordentlich gekämmt und elegant angezogen – stand ein wirklich gutaussehender Junge vor dem Spiegel. Er war wie ein Rohdiamant, erkannte sie. Richtig geschliffen würde er alle anderen Männer auf diesem Schiff mühelos ausstechen. Seine offene Art, seine Unbekümmertheit und seine Freundlichkeit, die keinesfalls gespielt war, hoben ihn wohltuend von jenen ab, die meinten, die Welt sei ihnen als Eigentum in die Wiege gelegt worden.
Ein anerkennender Pfiff entwich Mollys Lippen. Sie konnte nicht anders. Sie trat hinter ihn und nahm ihn an den Armen, drückte ihn kräftig.
„Sie glänzen wie ein neuer Penny!“, sagte sie und lachte herzhaft. Hockley meinte, sich einen Spaß machen zu können, das wusste sie. Sie hatte die kleine Teufelei in dessen Einladung erkannt. Was der konnte, konnte sie schon lange. Und dieser Junge hier, der würde sich nicht hochnehmen lassen. Dafür würde sie sorgen. Im Geiste hatte sie den gutaussehenden jungen Mann für die Dauer dieser Reise adoptiert …
Kapitel 10
Schaulaufen zum Dinner
Von Molly herausgeputzt steuerte Jack auf den Zugang des Treppenhauses der Ersten Klasse zu. Ein Steward öffnete die Tür und verbeugte sich leicht.
„Guten Abend, Sir“, begrüßte er den jungen Mann, der die Verbeugung leicht und in angemessener Geringfügigkeit erwiderte. Doch während es bei den männlichen Passagieren der Ersten Klasse tatsächlich Geringschätzung des arbeitenden Personals war, war es bei Jack eher Unsicherheit, was der Steward jedoch nicht einmal ahnte. Auf dem Schiff waren über zweitausend Menschen. Kein Steward wäre in der Lage gewesen, jedes Gesicht in die gebuchte Klasse einzuordnen. Der Neuankömmling trug Frack und Fliege, also war er hier richtig …
Vorsichtig ging Jack weiter und kam sich richtig verkleidet vor, fast wie ein Spion, der sich unerkannt unter die Feinde mischte, um brisante Informationen zu sammeln. Von unten drang Musik herauf, die von Wallace Hartley und seinem kleinen Orchester gespielt wurde. In dem Moment, als Jack hereingekommen war, hatten die Musiker An der schönen blauen Donau intoniert, einen berühmten Walzer von Johann Strauß.
Er fand sich auf dem obersten Stockwerk der riesigen geschwungenen Treppe wieder und näherte sich der Balustrade, gefertigt aus geschnitztem Eichenholz, die einzelnen Balken jeweils etwa eine Handbreit hoch und breit. Die offenen Felder zwischen den tragenden Stützen waren mit schmiedeeisernen, verspielten Art-Deco-Mäanderbändern gefüllt und mit gleichfalls schmiedeeisernen, aber vergoldeten, ovalen Medaillons und geschwungenen Ranken versehen. Die Balustrade ging nahtlos in das gleichartig gestaltete Treppengeländer über. Jacks Blick ging nach oben zu der aus weißem, durchscheinendem Kristallglas gefertigten unglaublich großen Kuppel, die von dahinter verborgenen Lampen indirekt erleuchtet wurde, deren Zentrum aber ein gewaltiger Kristallleuchter war. Die das Licht streuende Kuppel und der Lüster tauchten das Treppenhaus in gleichmäßiges Licht.
Immer wieder passierten einzelne Passagiere oder Paare den staunenden jungen Mann, der sich rechtschaffen bemühte, sein Staunen zu verbergen, um nicht auf den ersten Blick als Landei der ganz armen Sorte erkannt zu werden. Die Leute sprachen leise miteinander, man nickte ihm grüßend zu, er erwiderte den Gruß ebenfalls mit stummem Nicken.
Da stand er nun in der Ersten Klasse und hatte keine Ahnung, wie man sich hier eigentlich benahm. Er beschloss, sich von den anderen Passagieren abzuschauen, wie man sich verhielt. Langsam ging er die Treppe hinunter. Auf dem Absatz des halben Stockwerks, wo sich die geschwungenen Treppen der Backbord- und der Steuerbordseite trafen, um dann als eine einzige Treppe mit zusätzlichem Mittelgeländer zum nächsten Deck hinunterzuführen, war in die Wandtäfelung aus Eichenholz eine reich verzierte Mitteltafel eingelassen, in deren Zentrum zwei geflügelte Frauenfiguren den Rahmen für eine Uhr bildeten. Die Uhr zeigte fünf Minuten nach sieben, Zeit fürs Dinner. Am Fuß der Treppe auf dem C-Deck waren die äußeren Abschlusssäulen jeweils mit einem aus Eichenholz geschnitzten, aufrecht stehenden Pinienzapfen versehen, das mittlere Geländerende wurde von einer aus dunkler gebeiztem, auf Hochglanz poliertem Eichenholz geschnitzten Putte geschmückt, die eine Fackel trug, deren Flamme eine weiße, durchscheinende Lampe war.
Jack ging ganz hinunter, zupfte sich im Weitergehen den Frack zurecht und stellte sich an die erste Säule, die sich rechts vom Treppenfuß befand. Dort stellte er sich mit verschränkten Armen hin und beobachtete die übrigen Leute, die hier vorbeiflanierten. Ein älteres Paar kam, in leiser Unterhaltung vertieft, von der anderen Seite der Treppe und blieb einander zugewandt genau vor der Treppe stehen. Ein anderes Paar kam die Treppe herab. Jack schaute auf den älteren Herrn mit hellgrauem Haarkranz um die spiegelblanke Glatze und dem würdevollen, gepflegten, hellgrauen Vollbart im Frack am Treppenfuß, der kerzengerade stand. Der junge Mann straffte sich und nahm dieselbe Haltung wie der ältere Herr ein, der den anderen Mann mit einer leichten Verbeugung begrüßte und die linke Hand im rechten Winkel angelegt hinter dem Rücken hielt. Es wirkte so, als schöbe er damit eine zusätzliche Stütze ins Kreuz. Jack machte es nach, nahm auch die Nase hoch und fand, dass das schon mehr nach Erster-Klasse-Passagier aussah, als jemand, der mit verschränkten Armen zusammengesunken an einer Säule lehnte.
Der ältere Herr bot seiner Begleiterin – wohl seiner Gattin, wie Jack unterstellte – elegant den rechten Arm, in den sie sich gern einhakte. Gemeinsam schritten sie weiter zum Speisesaal, an Jack vorbei. Sie nickten ihm grüßend zu, er erwiderte das Nicken mit einem leichten Lächeln und drehte sich steif wie eine Figur auf der Spieluhr nach links, um die Herrschaften im Blick zu behalten und sich jede Bewegung des älteren Herrn genau abzuschauen und einzuprägen. Unglücklicherweise ging er mit seiner Begleitung die nächste gleichartig gestaltete Treppe zum Speisesaal auf dem D-Deck hinunter, ohne noch jemand anderem zu begegnen und Jack die Gelegenheit zu weiteren Benimmstudien zu bieten.
Stimmen, die sich von oben her näherten, forderten Jacks Aufmerksamkeit. In der Tat, er hatte sich nicht verhört. Caledon Hockley schritt herab, neben sich seine künftige Schwiegermutter, mit der er weniger leise parlierte, als es die übrigen Passagiere sonst taten, die Hände in den Hosentaschen.
„Wussten Sie, dass mehrere tausend Tonnen Hockley-Stahl in diesem Schiff verarbeitet wurden?“, fragte Cal voller Stolz. Ruth DeWitt Bukater war darüber offensichtlich nicht informiert, tat aber interessiert.
„An welchen Stellen?“, erkundigte sie sich.
„Nur an wichtigen, natürlich“, erwiderte Cal. Es war pure Prahlerei, schließlich hatte er die Bauarbeiten nicht selbst beaufsichtigt und konnte nicht wissen, in welchen Bereichen des Schiffes der aus dem Werk seines Vaters stammende Stahl eingesetzt worden war.
„Dann wissen wir ja, an wen wir uns wenden müssen, wenn es Probleme gibt“, setzte Ruth die Konversation fort. „Wo ist meine Tochter?“
„Sie müsste gleich kommen“, antwortete Hockley. Beide grüßten Jack mit einem leichten Kopfnicken, ohne ihn zu erkennen. Jack hielt sich zurück, zumal Hockley ihm eine Erwiderung abnahm, weil er schon jemand anderes gesehen hatte: die Gräfin von Rothes.
„Da ist ja die Komtesse!“, erkannte Cal und ging mit ausgestrecktem rechtem Arm auf die edle Dame zu, die ihm huldvoll ihre rechte Hand reichte und sich einen Handkuss auf den behandschuhten rechten Handrücken hauchen ließ.
„Guten Abend, meine Liebe!“, grüßte er geradezu überschwänglich. Jack drehte sich wiederum mit und beobachtete genau, was Hockley machte, ahmte die Bewegungen sofort nach, ohne dass Cal und Ruth etwas davon mitbekamen.
Rose erschien auf dem Treppenabsatz bei der Uhr und sah am Fuß der Treppe einen elegant gekleideten jungen Mann mit ordentlich zurückgekämmtem blondem Haar stehen, der wohl noch neu im Club war. Er übte die Bewegungen der anderen männlichen Passagiere und sah aus wie ein aufgezogener Pinguin auf einer Spieluhr.
Jack spürte etwas und sah verstohlen nach oben. Was er aus dem Augenwinkel sah, ließ ihn sich der Treppe zuwenden: Da kam eine leibhaftige Prinzessin! Rose kam herab, gehüllt in einen Traum aus lachsfarbenem Unterkleid, über das sich ein Überkleid aus reich besticktem, schwarzem, durchsichtigem Chiffon in Spiralen wand wie die Ringe eines Meeresschneckenhauses. Über die Ellenbogen reichende lange, weiße Satinhandschuhe ergänzten das kurzärmelige Kleid, das eine gewisse Ähnlichkeit mit dem vom Abend zuvor hatte – jedenfalls, was die Farbzusammenstellung betraf –, nur war es noch aufwändiger in der Verarbeitung.
Ihr langes Haar, das farblich hervorragend mit dem Ton des Unterkleides harmonierte, war zu einem ebenfalls meeresschneckenartig gewundenen Dutt zusammengebunden, die Windungen mit einem Haarband gehalten – oder verziert, so genau war es für Jack nicht zu erkennen –, das über und über mit glitzernden Steinen besetzt war. Jack fragte sich lieber nicht, ob es echte Steine waren oder reiner Zierrat aus Strass. Er vermutete fast Ersteres. In der linken Hand hielt sie ein schwarzes Täschchen, in dem vermutlich die für Damen so unentbehrlichen Dinge wie Taschentuch, Riechsalz und vielleicht ein Lippenstift waren. Ihre Erscheinung verschlug ihm für einige Momente die Sprache.
Rose allerdings ging es nicht anders, als sie erkannte, wer der übende Pinguin am Treppenfuß war. Der Frack saß wie angegossen, als wäre er für Jack gemacht. Wo hatte er den bloß hergezaubert? Von Cal ganz sicher nicht. Der hatte Jack eingeladen, um ihn vorzuführen, wollte ihn einfach nur lächerlich machen – sozusagen als unfreiwilligen Hofnarren missbrauchen. Sie behielt ihre Frage für sich, um ihn nicht versehentlich vor anderen Passagieren bloßzustellen, die keine Ahnung von Hockleys miesem Spiel mit ihrem Retter hatten.
Das angedeutete Lächeln, das sich auf seinen Lippen zeigte, als die ebenfalls sprachlose Rose die Treppe herunterkam, wirkte jedoch selbstsicher genug, um sie nochmals zu verblüffen. Er ließ sich nicht einschüchtern, erkannte sie – oder er hatte die erste Unsicherheit überwunden, nachdem er sich die steifen Posen der Herren abgeschaut hatte. Er trat näher an die Treppe, erwartete sie mit kerzengerader Haltung, die nicht mehr gespielt oder unsicher wirkte.
Als sie drei Stufen vor dem Treppenfuß war, nahm er ihre rechte Hand, hob sie sanft an seine Lippen, verbeugte sich leicht, ohne den Blick von ihren grünen Augen zu wenden und drückte einen sachten Kuss auf ihren Handrücken, der jedem jugendlichen Liebhaber im Stummfilm zur Ehre gereicht hätte. Die Tatsache, dass er die Hand tatsächlich küsste, entlarvte ihn als gesellschaftlich unerfahren – die gesellschaftliche Konvention lehnte die Berührung des Handrückens mit den Lippen ab. Eigentlich führte der Herr die Hand nur bis kurz vor seine Lippen, ohne die Hand damit wirklich zu berühren. Rose war dennoch tief berührt. Das hier geschah nicht aus Gründen der Konvention, sondern war ernst gemeint …
„So einen Handkuss kenne ich aus dem Varieté und wollt’ das seitdem auch mal tun“, sagte er leise, ihre Augen weiterhin fest im Blick behaltend. Rose lachte leise, aber entspannt auf. Er übertrug doch tatsächlich gespielte Verehrung zurück ins richtige Leben und gab ihr Leben. Er konnte offensichtlich nicht nur hervorragend zeichnen …
Sie überließ ihm ihre Hand, als er ihr den Arm zum Einhaken bot. Gleich darauf musste sie wieder lachen, als er in tadellos gespielter Überheblichkeit die Nase hochnahm. Rose zog ihn mit leichtem Druck zu Cal und stupste ihn leicht an.
„Darling … du erinnerst dich bestimmt noch an Mr. Dawson“, sprach sie ihn an. Cal drehte sich um. Erst jetzt bemerkte er, dass er Jack bereits versehentlich begrüßt hatte, ohne ihn mit dem Mann vom vorigen Abend in Verbindung zu bringen. Caledon Hockley gehörte eindeutig zu den Menschen, die andere nur an der Kleidung identifizieren konnten. Ohne ein solches Zeichen war er blind für andere Personen.
„Dawson?“, fragte er verblüfft. Er hatte wirklich damit gerechnet, dass der Retter seiner Verlobten in seiner schäbigen Arbeiterkleidung versuchen würde, in die Erste Klasse vorzudringen. Darauf hatte Cal sich schon geradezu diebisch gefreut. Jetzt entgleisten ihm fast die Gesichtszüge, doch er fing sich erstaunlich schnell.
„Verblüffend“, räumte er ein. „Sie könnten fast als Gentleman durchgehen“, ließ er eine spitze Beleidigung fallen, die an Jack aber abprallte.
„Ja … fast“, erwiderte der kühl.
„Außerordentlich“, entfuhr es Cal, der sich zu fragen begann, woher, um alles in der Welt, dieser Dritter-Klasse-Abschaum einen nagelneuen Frack hergezaubert hatte. Er wandte sich wieder Ruth zu, die immer noch sprachlos über die Erscheinung des jungen Mannes war, den sie als Nichtsnutz betrachtete, und begleitete sie in den Speisesaal. Dort begegneten sie Sir Cosmo und Lucile Lady Duff Gordon, die Cal sogleich begrüßte und in ein kurzes Gespräch verwickelte.
Rose nutzte die Gelegenheit, Jack mit den wichtigsten Bewohnern dieser Schlangengrube, vertraut zu machen – jedenfalls mit dem Klatsch, der über sie kursierte. Sie wies zunächst mit dem Kinn auf die Komtesse, die mit Captain Smith sprach:
„Das ist die Komtesse von Rothes“, stellte sie vor, drehte sich in die andere Richtung um und wies mit der ganzen rechten Hand auf einen distinguiert wirkenden Herrn mit leicht grauen Schläfen und markantem Gesicht.
„Das ist John Jacob Astor, der reichste Mann auf dem Schiff. Sein kleines Frauchen ist in anderen Umständen und etwa so alt wie ich. Sie versucht, es zu verstecken – ein regelrechter Skandal“, flüsterte sie mit mädchenhaftem Kichern. „Und das ist Benjamin Guggenheim und seine Mätresse, Madame Aubert“, wies sie mit dem Kopf in eine andere Richtung zu einem älteren Herrn und einer Dame von etwa dreißig Jahren. „Mrs. Guggenheim und die Kinder sind selbstverständlich zu Hause“, setzte sie bissig hinzu. „Und da drüben hätten wir Sir Cosmo und Lady Lucile Duff Gordon“, präsentierte sie ihm schließlich die momentanen Gesprächspartner ihres Verlobten und ihrer Mutter, winkte Lady Lucile und Sir Cosmo neckisch zu, die sie bemerkt hatten und sie entsprechend begrüßten. „Sie entwirft schlüpfrige Dessous, sie besitzt viele Talente. Sie pflegt Kontakte zum Königshaus“, schloss sie die einstweilige Vorstellung der wichtigeren Leute auf diesem Deck.
„Herzlichen Glückwunsch, Hockley, sie ist prachtvoll“, lobte Sir Cosmo die Wahl Cals mit einem Blick auf Rose, als betrachtete er eine besonders wertvolle Zuchtstute.
„Sie sieht bezaubernd aus“, pries auch Lady Lucile Rose.
„Ich danke Ihnen“, nahm Cal die Glückwünsche entgegen, als habe er eine olympische Medaille gewonnen oder als sei Rose ein besonders schönes Produkt aus der Fabrikation seines Vaters.
„Cal ist ein glücklicher Mann. Ich kenne ihn gut – und das kann nur Glück sein“, bemerkte Colonel Archibald Gracie. Ruth nahm in einer koketten Geste den Arm ihres künftigen Schwiegersohns.
„Wie können Sie das sagen, Colonel? Caledon Hockley ist ein großartiger Fang“, erklärte sie lächelnd, was ihre Worte zu einem heiteren Scherz entschärfte.
„Wann findet die Hochzeit statt?“, erkundigte sich Colonel Gracie.
Die Antwort bekamen Jack und Rose nicht mit, da der junge Mann in diesem Moment von Margaret Brown angesprochen wurde:
„Lust, ‘ne Lady zum Dinner zu geleiten?“
„Sicher doch“, lächelte Jack gewinnend und bot Molly den freien linken Arm, in den sie sich nur zu gern einhakte.
„Zuckerpüppchen?“, rief Cal im Weitergehen. „Zuckerpüppchen!“
Jack führte seine beiden Damen elegant in den Speisesaal hinein.
„Das reinste Kinderspiel, nicht wahr, Jack? Denken Sie daran, die haben nur Geld im Kopf. Behaupten Sie einfach, Sie besäßen eine Goldmine und schon gehör’n Sie zum Club“, gab Molly ihm einen Tipp. Rose bekam eine Ahnung, wer Jack zu der noblen Kleidung verholfen hatte. Hatte Molly etwa …? Ja, der war es zuzutrauen, einen gesellschaftlich unerfahrenen jungen Mann mal eben unter die Fittiche zu nehmen und ihm zu helfen – und zwar nur Molly. Alle anderen, die sich der oberen Gesellschaftsklasse zurechneten, hätten Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um die Abgrenzung nach unten ja nicht in Gefahr geraten zu lassen.
„Hey, Astor!“, rief Molly in ihrer burschikosen Art und steuerte auf das Ehepaar Astor zu.
„Sieh mal an! Hallo, Molly. Schön, Sie zu sehen!“, erwiderte der Krösus ebenso jovial und strahlte sie unverstellt freundlich an.
„Jay-Jay, Madeleine, ich möchte Ihnen Jack Dawson vorstellen“, führte Rose Jack bei den Astors ein.
„Sehr angenehm“, begrüßte Madeleine Astor ihn huldvoll und reichte ihm die Hand zur Begrüßung.
„Ganz meinerseits“, erwiderte Jack und schüttelte ihr die Hand. Auch J. J. Astor reichte ihm die Hand und erntete ein kräftiges Händeschütteln.
„Nun, Jack …“, setzte er an, „gehören Sie zu den Bostoner Dawsons?“
Jack verbeugte sich leicht.
„Nein, äh, zu den Chippewa-Falls-Dawsons, genauer gesagt“, erklärte der junge Mann lächelnd.
„Ach ja …“, erwiderte Astor und tat so, als würde er die Sippe kennen. Dennoch war ihm anzusehen, dass er keine Ahnung hatte, welche Familie Dawson es tatsächlich war – wenn er denn je von einem Ort in Wisconsin mit Namen Chippewa Falls gehört hatte …
Kapitel 11
Gemeinheiten
Captain Smith war inzwischen ebenfalls zum Captain’s Dinner erschienen und ließ sich von einem der Stewards den ihm zugedachten Platz zeigen.
Rose leitete Jack so geschickt durch die Reihen der langen, ovalen Tafeln, dass es gleichwohl so aussah, als führe der junge Mann seine Dame zum Tisch. Dort angekommen, begrüßte er die dort bereits sitzende Gräfin von Rothes, die ihm die Hand zum Handkuss reichte, was Jack auch prompt tat.
♦♦♦
„Er war sicher nervös, aber er ließ es sich nicht anmerken“, kommentierte die alt gewordene Rose auf der Keldysh die Ereignisse jenes Abends „Alle nahmen an, dass er einer von ihnen war. Der Erbe eines Vermögens bei der Eisenbahn vielleicht. Neureich … keine Frage, aber trotzdem ein Mitglied des Clubs. Doch auf Mutter war wie immer Verlass.“
♦♦♦
„Erzählen Sie uns von den Unterkünften der Dritten Klasse, Mr. Dawson. Sie sollen auf diesem Schiff recht annehmlich sein“, forderte Ruth den Gast am Tisch auf, um klarzustellen, dass da ein Wolf im Schafspelz saß – oder umgekehrt, je nach Sichtweise, wo Wölfe und Schafe verteilt waren …
Es war eine illustre Gesellschaft, die an diesem Tisch versammelt war. Gleich links neben Jack saß die Gräfin, im Uhrzeigersinn weiter Bruce Ismay, Colonel Archibald Gracie, Madame Aubert, Benjamin Guggenheim, Lady Lucile und Sir Cosmo Duff Gordon, Ruth DeWitt Bukater, Caledon Hockley, Rose DeWitt Bukater, Thomas Andrews. Rechts neben Jack schloss Margaret Brown den Kreis.
Jack lächelte sanft, geradezu erleichtert, dass er sich nun nicht mehr zu verstellen brauchte.
„Die besten, die ich je gesehen hab’, Ma’am. Fast keine Ratten“, erwiderte er.
„Mr. Dawson ist aus der Dritten Klasse zu uns gestoßen“, stieß Cal in das gleiche Horn. „Er kam gestern Abend meiner Verlobten zu Hilfe“, rechtfertigte er dann gegenüber den feinen Tischgenossen die Einladung an den Zwischendeckpassagier.
„Es hat sich herausgestellt, dass Mr. Dawson ein hervorragender Künstler ist“, griff Rose ein. „Er war so freundlich, mir einige seiner Werke zu zeigen.“
„Rose und ich definieren Kunst in nicht ganz derselben Weise“, ließ Cal eine spitze Bemerkung fallen und dachte an die Fingerzeichnungen eines gewissen Pablo Picasso. „Ohne Ihre Werke beleidigen zu wollen“, setzte er mit einem seiner falschesten Lächeln hinzu. Er kannte die Arbeiten nicht, hatte aber den leisen Verdacht, dass sie ihm ebenso unverständlich sein würden wie die Bilder von Picasso. Jack hob abwehrend die Hand, womit er ausdrückte, dass er Cal die Bemerkung nicht übelnahm. Die übrigen Gäste am Tisch wirkten ob dieser Enthüllung unterschiedlich beeindruckt, einige tuschelten leise.
„Was will Hockley damit beweisen, dass er diesen … Bohemien … hier herauf bringt?“, flüsterte Guggenheim seiner Mätresse zu. Nach einigen Momenten des Unbehagens siegte in den Reichen und Schönen am Tisch die Einstellung, dass man ungeheuer liberal war, ein solches Element am eigenen Tisch zu dulden.
Ismay fand, dass es an der Zeit war, die Aufmerksamkeit wieder dem Schiff zuzuwenden.
„Sein Blut und seine Seele stecken in diesem Schiff“, sagte er. „Auf dem Papier mag sie mir gehören, aber in den Augen Gottes gehört sie Thomas Andrews.“
Rose bedeutete Jack stumm, aber mit deutlichen Gesten, die Serviette vom Teller zu nehmen und sie sich auf den Schoß zu legen, was Jack dann unauffällig tat. Dabei fiel ihm die schier ungeheure Menge an Besteck auf, die drei- bis fünffach neben seinen Tellern lag: Drei Gabeln links, rechts ein kleiner Hornlöffel, eine kleine Gabel, ein Löffel, ein Fischmesser und schließlich ein Tafelmesser. Dazwischen zwei Teller übereinander, auf dem kleineren Teller rechts oben ein Brötchen
„Ist das alles für mich?“, fragte Jack Molly ebenso leise wie erschrocken.
„Ja, arbeiten Sie sich einfach von außen nach innen vor“, gab Molly ihm einen Tipp.
„Er kennt jede einzelne Schraube, nicht wahr, Thomas?“, fuhr Ismay fort, als nicht jeder umgehend in seine Lobeshymne einstimmte. Rose tat ihm schließlich den Gefallen, auch um Jack vor weiteren Attacken zu schützen.
„Ihr Schiff ist ein wahres Wunderwerk, Mr. Andrews“, sagte sie, Andrews zugewandt.
„Ich danke Ihnen, Rose“, antwortete der Ingenieur höflich und absolut ernst gemeint. Auch er verfiel zunehmend Roses mädchenhaftem Zauber.
„Wie wünschen Sie Ihren Kaviar, Sir?“, erkundigte sich der Steward bei Jack.
„Mit einem Spritzer Zitrone“, antwortete Cal an seiner Stelle. „Das hebt den Geschmack mit dem Champagner hervor“, wandte er sich empfehlend an Jack.
„Für mich keinen Kaviar, danke“, erwiderte Jack, an den Steward gewandt, bevor der Cals Empfehlung – oder auch Anweisung – folgen konnte. „Den hab’ ich noch nie gemocht“, setzte er zum allgemeinen Erstaunen seiner Tischgenossen hinzu. Rose lächelte verschmitzt, als sie die Anspielung auf die Unterhaltung vom Nachmittag erkannte.
Ruth fand, dass ein erneuter Ansatz nicht schaden konnte, den zeitweiligen Emporkömmling unmöglich zu machen.
„Und wo genau wohnen Sie, Mr. Dawson?“, erkundigte sie sich mit ausgesucht falscher Freundlichkeit.
„Also … im Augenblick ist meine Adresse noch die RMS Titanic. Was danach kommt, weiß nur der liebe Gott“, erwiderte Jack mit entwaffnender Ehrlichkeit.
„Und woher haben Sie die Mittel, zu reisen?“, bohrte Ruth weiter.
„Ich erarbeite mir die Fahrtkosten normalerweise. Sie wissen schon: Handelsmarine und so was“, versetzte Jack und ließ nun seinerseits eine gemeine Spitze gegen die nicht selbst arbeitende High Society fallen, die in der Regel ihr Geld oder Heerscharen schlecht bezahlter Arbeiter für ihren Reichtum sorgen ließ. „Aber meine Fahrkarte für die Titanic verdanke ich einem glücklichen Händchen beim Poker – einem ausgesprochen glücklichen Händchen“, setzte er hinzu.
„Das ganze Leben ist doch vom Glück bestimmt“, pflichtete ihm Colonel Gracie bei. Caledon brummte verneinend
„Ein richtiger Mann hilft seinem Glück auf die Sprünge“, sagte er und räumte damit zweifellos Manipulationen des Glücks zu seinen Gunsten ein – böswillig oder pur juristisch betrachtet konnte man das auch Betrug nennen … „Nicht wahr, Dawson?“, wandte er sich an Jack und unterstellte ihm damit, beim Pokern gemogelt zu haben. Der brummte zustimmend, gab damit aber nicht zu, selbst betrogen zu haben. Die anderen hatten einfach die schlechteren Karten gehabt, dazu hatte er nichts beigetragen. Aber es war doch interessant, was man bei solchen Tischgesprächen über die oberen Zehntausend und ihre Methoden, zu Reichtum zu kommen, erfahren konnte …
„Und Sie finden dieses wurzellose Dasein ansprechend?“, erkundigte sich Ruth spitz. Es wäre ihr nicht in den Sinn gekommen, freiwillig ohne festes und vor allem hohes Einkommen leben zu wollen.
Jack warf die letzte Zurückhaltung über Bord.
„Oh ja, Ma’am, so ist es. Ich meine … ich hab’ alles, was ich benötige, bei mir. Ich hab’ Luft in meinen Lungen und paar leere Blatt Papier. Ich find’ es schön, morgens aufzuwachen, ohne zu wissen, was passiert … oder wer mir begegnet … oder wohin es mich verschlägt. Vor einigen Tagen hab’ ich noch unter einer Brücke geschlafen und jetzt sitz’ ich hier: Auf dem größten Schiff der Welt und trinke mit vornehmen Leuten wie Ihnen Champagner“, sagte er und hob sein Glas. „Ich hätt’ gern noch was“, sagte er leise zum Steward, der auch gehorsam nachschenkte. „Ich finde, das Leben ist ein Geschenk – und ich habe nicht vor, etwas davon zu verschleudern. Man weiß nie, was man als Nächstes für Karten kriegt. Man lernt, das Leben so zu nehmen, wie es gerade kommt.“
Cal wollte nach der ersten Vorspeise eine Zigarette rauchen – egal, ob das verpönt war oder nicht –, zog eine aus seinem Etui, schob sie zwischen die Lippen und suchte dann nach seinem Feuerzeug. Er fand es nicht und wollte gerade unauffällig den Steward auffordern, ihm Feuer zu geben, als Jack seine Verlegenheit bemerkte.
„Oh, hier, Cal“, sagte er und schmiss ihm fast nebenbei eine Schachtel Streichhölzer hinüber, die Cal gerade noch auffangen konnte und über diese Indiskretion indigniert aus der Wäsche guckte.
„Weil jeder Tag zählt“, setzte Jack hinzu.
„Gut gesagt, Jack“, lobte Molly die selbstbewusste Äußerung des unerschrockenen jungen Mannes.
„Hört! Hört!“, stimmte auch Gracie in das Lob auf Jack ein, dessen Aussagen bei den anderen an der Tafel ein gelöstes Lächeln hervorrief. Saß hier etwa der sprichwörtliche Tellerwäscher, der es noch zum Millionär bringen würde? Rose erhob ihr Glas.
„Weil jeder Tag zählt“, sagte sie und münzte Jacks Ausspruch in einen Trinkspruch um, der von den anderen geradezu begeistert aufgegriffen wurde. Alle erhoben die Gläser und schlossen sich dem Trinkspruch an, nur Ruth verzog keine Miene dabei; Cal ließ ein eher gequältes Lächeln sehen, voller Gram, dass es ihm nicht gelungen war, den jungen Mann aufs Glatteis zu führen und ihn unmöglich zu machen.
Für den weiteren Verlauf des Dinners hatte Jack Ruhe vor den verbalen Attacken von Ruth und Cal, die einsahen, dass er ihnen über war. Schließlich wurde das Dessert serviert, die Stimmung am Tisch hatte sich deutlich gelockert, was sowohl auf den Genuss von Champagner und Wein, aber auch auf Molly Brown zurückzuführen war, die eine Anekdote nach der anderen erzählte und damit die Tischgenossen zu herzhaftem Lachen brachte.
„… und Mr. Brown hatte keine Ahnung, dass ich das Geld im Ofen versteckt hab’. Und als er nach Hause kam, betrunken wie eine Trauergemeinde, zündete er den Ofen an!“, jubelte sie mit einer ausladenden Handbewegung; brüllendes Gelächter am Tisch war die Folge.
Als weitere Stewards erschienen, die den Herren aus Humidoren** Zigarren anboten, wandte Rose sich leise an Jack:
„Als nächstes werden Brandys im Rauchsalon eingenommen.“
Colonel Gracie erhob sich.
„Aaalso … würden Sie mir bei einem Brandy Gesellschaft leisten, Gentlemen?“, fragte er und hob damit die Tafel auf.
„Vorzügliche Idee“, antwortete Sir Cosmo und stand ebenfalls auf. Die anderen Herren folgten ihrem Beispiel und erhoben sich gleichfalls.
„Nun werden sie sich in eine Rauchwolke zurückziehen und sich beglückwünschen, die Schöpfer des Universums zu sein“, giftete Rose leise.
„Ladies, ich danke Ihnen für diesen wunderbaren Abend“, sagte Ismay und verbeugte sich leicht zur weiterhin sitzenden Damenwelt am Tisch.
„Rose, darf ich dich zu deiner Kabine geleiten?“, erkundigte sich Cal mit ausgesuchter Höflichkeit bei seiner Verlobten.
„Nein, ich geh’ noch nicht“, wehrte sie ab. Dieser Abend war zu nett, um ihn schon vergehen zu lassen. Sie hoffte, dass Jack bleiben würde und sah mit böser Ahnung, dass Gracie auf ihn zusteuerte. Was sie nicht bemerkte, war, dass Jack Molly einen Schreiber zurückgab, mit dem er eine Notiz geschrieben hatte.
„Hier … danke, Molly“, sagte er zu ihr in ehrlicher Dankbarkeit. Ohne ihre Hilfe hätte er es wohl nicht geschafft, hierher zu kommen
„Leisten Sie uns Gesellschaft, Dawson? Sie wollen doch nicht etwa bei den Frauen bleiben, oder?“, sprach Gracie ihn an. Der Junge hatte ihn schon am Abend zuvor beeindruckt, die Vorstellung beim Dinner hatte Gracies Wohlwollen nur noch verstärkt.
„Nein, vielen Dank“, erwiderte Jack, durchaus erfreut über die in diesem Fall ernst gemeinte Einladung. Er wollte sein Glück nicht noch weiter strapazieren. „Ich muss wieder zurück“, ergänzte er. Cal atmete auf.
„Ist wohl am besten so. Es geht sowieso nur um Politik und Geschäfte. Würde Sie nicht interessieren“, sagte er, womit er erneut eine spitze Beleidigung fallen ließ. Jack spürte einen Stich, ließ sich aber nichts anmerken.
„Ach … und Dawson: danke fürs Kommen“, sagte Cal, als er einige Schritte weitergegangen war und warf die Streichhölzer wieder zurück, die Jack geschickt auffing.
„Jack, Sie müssen schon gehen?“, erkundigte Rose sich mit sichtlicher Enttäuschung. Er lächelte sanft.
„Es ist Zeit für mich, wieder mit den anderen Sklaven zu rudern. Gute Nacht, Rose“, sagte er, nahm ihre Hand und zauberte erneut einen ehrerbietigen Handkuss darauf. Dabei schmuggelte er seine Notiz in Roses Hand, die sie eher unbewusst abnahm. Ruth bemerkte die Verabschiedung und lächelte zufrieden. Endlich verschwand er!
Während er durch den Saal davon ging, sah er sich immer wieder um, bemerkte Roses Verblüffung, als sie den Zettel in der Hand fühlte. Erst als er den Speisesaal verlassen hatte, traute sie sich, die Notiz unter dem Tisch auseinanderzufalten und zu lesen:
Damit jeder Tag zählt. Treffen Sie mich an der Uhr, war der Inhalt der Notiz.
Rose verließ den Speisesaal, kam zur Treppe, auf deren halber Höhe die Uhr war. Tatsächlich. Jack stand dort und schaute auf die Uhr. Sie zeigte neun Uhr abends. Rose raffte ihren Rocksaum und stieg die Treppe hinauf. Jack spürte, dass sie kam und drehte sich mit einem Lächeln um.
„Haben Sie Lust, auf eine richtige Party zu gehen?“, fragte er.
Kapitel 12
Party in der Dritten Klasse
Unten, im Aufenthaltsraum der Dritten Klasse, ging es in der Tat völlig anders zu als in der steifen Atmosphäre im Speisesaal der Ersten Klasse auf dem D-Deck. Es war laut, es war voll, es war unglaublich lebensfroh. Hier spielte kein Kammerorchester sanfte Walzerklänge wie oben im feinen Speisesaal, hier hatte sich eine improvisierte Band zusammengefunden, die mit Dudelsack, Fiedel und Tamburin, aber auch mit Löffeln irische Folkmusik zum Besten gab, die einfach in die Beine ging. Hier blieb keiner lange sitzen.
Es wurde in allen denkbaren Varianten getanzt, gehüpft, gedreht und gelaufen; Nationalität, Geschlecht und Alter spielten keine Rolle. Man tanzte wilde Rundtänze, bei denen sich die Tanzpartner einhakten und umeinander wirbelten, wie ein Mann offensichtlich russischer Herkunft und ein Mann, der wohl aus Nordeuropa war. Fabrizio und Helga wirbelten ebenfalls durch den Raum.
„Darf ich meine Hand hierhin legen, ja?“, fragte er höflich, Helga nickte und erlaubte ihm, die Hand an ihre Hüfte zu legen.
„Okay!“, jubelte er und stob mit ihr drehend davon. Andere – in dem Fall hauptsächlich Frauen – veranstalteten in größerer Zahl eine Polonaise, bei der immer wieder zwei Personen anhielten und für die Nachfolgenden eine Brücke bauten, unter der diese durchgingen. Auf diese Weise bückten und streckten sie sich immer abwechselnd.
Jack und seine kleine Freundin Cora Cartmell hielten sich an den Händen, Cora drehte sich immer wieder unter Jacks Händen durch.
An einem Tisch saß Rose mit Olaus Gundersen, der gegen den Lärm aus Musik, Gejohle und gegrölten Gesprächen anbrüllte, um mit ihr ins Gespräch zu kommen, aber vergeblich. Auf Schwedisch fragte er sie etwas.
„Was?“, rief Rose. Er versuchte es erneut laut brüllend.
„Ich kann Sie leider nicht verstehen!“, brüllte sie zurück. Sie verstand ihn weder akustisch noch verstand sie seine Sprache überhaupt.
Tommy Ryan kam ebenfalls an diesen Tisch, hatte vier Pint**-Gläser mit dunklem Ale und den Händen, die er geschickt auf der Platte abstellte. Rose und Olaus nahmen sich je eines der Gläser, Rose trank durstig. Der Lärm und Hitze der vielen Menschen hier unten erhöhten den Flüssigkeitsbedarf. Dann beobachtete sie mit einem entspannten Lächeln wieder Jack, der nach wie vor mit der kleinen Cora tanzte.
Hinter ihr krachte es vernehmlich. Sie sah sich um. Ein Betrunkener war auf einen Tisch gefallen und hatte ihn umgeworfen, was johlendes Gelächter der Leute verursachte, die um den Tisch saßen. Man half ihm wieder auf, eine ältere Dame hatte sein zur Hälfte geleertes Glas aufgefangen und gesichert, reichte es ihm zurück. Er musste schon ziemlich genau zielen, um das Glas sicher zu fassen. Rose stimmte in das Lachen der anderen Leute ein, sah wieder zu Jack zurück und bemerkte hinter ihm Fabrizio, der mit Helga tanzte. Worte, gleich in welcher Sprache, waren jetzt unnötig, Musik und Rhythmus übernahmen die Kommunikation – und es funktionierte. Er wirbelte sie herum, sie wirbelte ihn herum und Fabrizio durfte verblüfft feststellen, dass die hübsche Norwegerin stärker als er war.
Die Band spielte die letzten Akkorde des improvisierten Stücks, tosender Applaus und Rufe nach Zugabe wurden laut.
„Wir spielen noch weiter“, kündigte der Bandleader an – und schon ging die Party weiter. Jack beugte sich zu Cora hinunter.
„Ich werde jetzt mal mit ihr tanzen, okay?“, sagte er mit einer Geste zu Rose, die hinter ihm am Fuß des Tanzbodens saß. Cora nickte zwar, aber sie verließ ihren großen Freund doch etwas zögernd.
„Kommen Sie“, forderte er Rose mit ausgestreckter Hand auf. Erst jetzt begriff Rose, dass sie gemeint war.
„Was?“, entfuhr es ihr verstört.
„Kommen Sie!“, winkte Jack erneut. Als sie nicht reagierte, griff er einfach zu und zog sie auf den Tanzboden hinauf.
„Wir tanzen“, entschied er.
„Jack … Jack … warten Sie!“, versuchte sie ihn zu bremsen. „Ich kann das nicht.“
Grinsend zog er sie nah an sich.
„Wir müssen etwas näher zusammen“, sagte er. Sie spürte seine rechte Hand, die sich sanft, aber bestimmt auf ihre linke Hüfte legte, während seine Linke ihre Rechte nahm. Ein leises Knistern durchfuhr sie beide, als sie so nah beieinander standen, dass sie sich berührten.
„Genauso“, sagte er lächelnd. Cora betrachtete das Ganze nun doch mit gewissem Argwohn. Machte ihr die große hübsche Dame etwa ihren großen Freund streitig? Jack bemerkte ihre Sorge.
„Keine Angst“, beruhigte er sie. „Du bist meine beste Freundin“, versprach er und entlockte Cora damit wieder ein zufriedenes Kinderlächeln. Ihr Vater, der hinter ihr saß, quittierte die Situation mit einem väterlich-liebevollen Lächeln, das auch Rose und Jack galt.
„Ich kenne die Schritte überhaupt nicht“, protestierte Rose. Jeder Tanz hatte seine ganz bestimmten Schritte, so hatte man es ihr in der Tanzschule beigebracht.
„Ich auch nicht“, beruhigte Jack sie. „Machen wir’s wie die anderen“, schlug er vor. „Denken Sie nicht nach.“
Füße haben zuweilen eigene Gedanken – und zum Tanzen genügen die jedenfalls dann völlig, wenn solche Rhythmen in den Ohren klingen wie die, die diese irische Band produzierte. Es war einfach unwiderstehlich schwungvoll. Die irischen Klänge verführten Rose und Jack zu einem flotten Galopp, den sie hinunter vom Tanzboden quer durch den Saal tanzten. Rose spürte dabei ein aufkommendes Lebensgefühl, wie sie es bisher nicht gekannt hatte. Hier war Schluss mit jeglicher Beherrschung und steifer Etikette, hier tobte das Leben – und Rose tobte zusammen mit Jack mit.
Fabrizio und Helga enterten im gleichen Takt den Tanzboden und umkreisten einander eingehakt, jauchzend und jubelnd.
„Jack, Jack, warten Sie!“, keuchte Rose. „Halt, Jack! Einen Moment!“
Er wirbelte weiter mit ihr herum. Sie kamen wieder am Tanzboden an, sie stoppte.
„Warten Sie!“
Jack sprang auf den Tanzboden und zog sie hinter sich her. Oben ließ er sie los, strich sich das wild herunterhängende Haar aus dem Gesicht und legte eine Steppeinlage hin. Rose zog ihre Schuhe aus, gab sie einer älteren Dame am Fuß des Tanzbodens und konterte Jacks Stepptanz nur auf ihren schwarzen Seidenstrümpfen. Jack ließ sich davon zwar beeindrucken, aber er legte nach, diesmal mit einer Drehung. Rose wiederholte seine Version. Ihr fröhlicher Wettstreit war von einem Balztanz nur noch schwer unterscheidbar. Schließlich hakten sie sich wie Fabrizio und Helga ein und wirbelten umeinander. Während die Norwegerin und der Italiener die Richtung wechselten, fassten sich Rose und Jack an den Händen und sausten gegen den Uhrzeigersinn wie im Karussell herum, wobei ihre Hände die Nabe des Karussells waren.
„Jack, nein!“, rief Rose, aber Jack ließ nicht los.
„Ooaahhaaa!“, entfuhr es ihm, als die zunehmende Geschwindigkeit sie beinahe vom Tanzboden schleuderte. Rose musste lachen.
Einige Decks höher war von dem lauten, trunkenen Tanz in der Dritten Klasse nichts zu hören oder zu spüren. Im Rauchsalon war es still, es wurde nur leise gesprochen. Über Geschäfte und Politik, ganz wie Cal zu Jack gesagt hatte, aber auch über juristische Probleme – und eines davon hatte Caledon Hockley. Die Firma seines Vaters war nach dem Sherman Antitrust Act angeklagt worden, nach einem Gesetz, das Monopolbildung und übermäßige Marktmacht verhindern sollte.
„Das ist durch die Sherman-Verfügung gedeckt“, sagte er, während ein Steward ihm und Benjamin Guggenheim Feuer für die Zigarren gab. „So werden meine Anwälte argumentieren.“
Guggenheim zog an der Zigarre.
„Das hat Rockefeller auch gesagt“, entgegnete er. „Aber der Oberste Gerichtshof hat da nicht mitgespielt.“
Guggenheim bezog sich auf einen Antitrustprozess, der sich von 1906 bis 1911 hingezogen hatte, bei dem der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten entschieden hatte, Standard Oil** in vier-unddreißig kleinere Einheiten aufzuteilen, die nicht mehr in der Lage waren, Kunden und Lieferanten die Geschäftsbedingungen zu diktieren.
Unten im Aufenthaltsraum der Dritten Klasse ging es inzwischen schon handfester zu. Tommy Ryan und Olaus Gundersen saßen beim Armdrücken. Rechts neben Tommy standen drei volle Pint-Gläser mit dunklem Ale. Die umstehenden Passagiere feuerten sie an. Jack kam ebenfalls an den Tisch, langte über Olaus hinweg zu den Gläsern und nahm zwei davon weg. Eines gab er Rose, das andere behielt er. Er trank einen größeren Schluck, sie setzte an und stürzte zu Jacks sichtlicher Verblüffung durstig das halbe Glas auf Ex herunter. Sie sah ihn amüsiert von der Seite an, dann setzte sie ab.
„Was? Dachten Sie, ein Mädchen aus der Ersten Klasse verträgt nichts?“, fragte sie schelmisch. Jack sah sie einen langen Moment an, sein Blick wurde weicher, geradezu verliebt. Bevor er dazu kam, sie zu küssen, bekam er einen heftigen Schubs, als Björn Gundersen in ihn hineinstürzte. Er verschüttete den größten Teil seines Biers, der hauptsächlich Rose traf, die darüber aber nur lachte. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wie lange es her war, dass sie sich so amüsiert hatte – wenn es denn jemals der Fall gewesen war. Jack, ganz der Beschützer, griff zu, erwischte Björn und gab ihm einen saftigen Stoß in die andere Richtung.
„Verschwinde!“, herrschte er ihn an. „Alles in Ordnung?“, wandte er sich besorgt an Rose.
„Mir ist nichts passiert“, erwiderte sie.
Im gleichen Moment gewann Olaus beim Armdrücken die Oberhand. Tommys Faust krachte auf den Tisch – rein in die Gläser, deren Inhalt sich auf den nächsten zwölf Quadratfuß** großzügig verteilte.
„Zwei von drei“, grunzte Olaus zufrieden und triumphierend. Rose lugte über Tommy und Olaus auf die Glastrümmer und das verschüttete Bier. Das von ihr selbst getrunkene Bier tat seine Wirkung, sie spürte aufkommenden Übermut. Keck nahm sie Tommy die Zigarette aus dem Mund und zog kräftig daran.
„Ihr Jungs glaubt, ihr seid harte Burschen?“, fragte sie. Die Männer sahen sie verblüfft an.
„Könnt ihr denn auch das hier?“, fragte sie herausfordernd und raffte den Saum ihres Kleides, gab Jack den Saum in die Hand.
„Halten Sie das mal, Jack. Ziehen Sie’s nach oben“, wies sie ihn an und stellte sich freihändig allein auf die Zehenunterseiten, Fußsohle und Ferse schon in der Luft. Dann hob sie auf die Zehenspitzen ab, stand einen Moment mit ihrem ganzen Gewicht nur auf den Spitzen ihrer beiden Großzehen.
Ihre Körperbeherrschung entlockte den Zuschauern erstaunte Rufe und Jubel.
„Grundgütiger!“
„Jesus, Maria und Josef!“
Nach einigen Sekunden verlor sie das Gleichgewicht und sackte direkt in Jacks Arme.
„Alles in Ordnung?“, erkundigte er sich besorgt. Ihr entspanntes und glückliches Lachen überzeugte ihn, dass alles bestens war.
„Das hab’ ich schon seit Jahren nicht mehr gemacht!“, jauchzte sie.
Neben ihnen standen Fabrizio und Helga, händchenhaltend, grinsend, glücklich.
„Wie geht’s euch beiden?“, fragte Jack, ebenfalls grinsend.
„Sie versteht nicht, was ich sage; ich verstehe nicht, was sie sagt; also alles bestens mit uns“, lachte Fabrizio.
Oben, auf der Hälfte der Treppe zeigte sich Spicer Lovejoy, den Hockley angewiesen hatte, Rose im Auge zu behalten. Er hatte eine ganze Weile suchen müssen, bevor er darauf gekommen war, sie in der Dritten Klasse zu vermuten. Sein finsterer Gesichtsausdruck verhieß nichts Gutes, aber Rose bemerkte ihn nicht und amüsierte sich weiterhin königlich.
Die irische Band setzte erneut an.
„Josie, fang an!“, rief der Bandleader. „Holly, steig ein! Und los!“
Wieder schien der Aufenthaltsraum der Dritten Klasse im ansteckenden Rhythmus des neuen Stücks schier zu explodieren. Irgendwo hinten begann jemand eine Polonaise, Fabrizio und Helga wurden von der Polonaise eingefangen.
„Komm!“, forderte Helga Jack auf.
„Andiamo!“, rief Fabrizio Rose zu, nahm sie bei der Hand, wie sie Jacks Hand ergriff. Fröhlich hüpften sie gemeinsam in der Schlange mit, die sich durch den ganzen Saal wand.
Sehr viel später kamen Rose und Jack auf das sternenbeschienene Bootsdeck. Die Party wirkte nach, sie alberten weiter, sangen das populäre Lied von Josephine in der Flugmaschine:
„Come Josephine in my flying machine
And it’s up she goes! Up she goes!
In the air she goes. Where? There she goes!“
Sie verknoteten sich in den Wörtern und brachen lachend ab. Als sie den Zugang zur Ersten Klasse erreichten, gingen sie nicht hinein, sondern blieben davor stehen. Diesen Abend wollten sie noch nicht beenden. Durch die Türen war wie von fern die Musik des Kammerorchesters zu hören, das die Ohren der hier anwesenden Passagiere mit sanfterer Musik erfreute, als sie unten in der Dritten Klasse tobte.
Rose griff nach einem Davit, lehnte sich dagegen und schaute in den tiefschwarzen Himmel hinauf, der wie mit Diamanten übersät schien.
„Ist das nicht großartig?“, fragte Rose berührt. „So riesig und grenzenlos.“
Sie ging weiter an die Reling und lehnte sich daran an.
„Meine Leute, Jack, sie sind so kleine Lichter. Sie glauben, sie sind Giganten auf der Erde, dabei sind sie in den Augen Gottes allenfalls Staub. Sie leben in dieser süßen, kleinen Champagnerperle … aber eines Tages platzt diese Blase“, sinnierte sie. Er trat ebenfalls an die Reling, seine Hand berührte eben gerade ihre. Es war der leichteste, denkbare Kontakt. Das einzige, was sie in diesem Moment spürten war dieser winzige Fleck Haut, an dem sie sich berührten. Jack lächelte.
„Nein, Sie sind keine von ihnen“, sagte er. „Da ist ein Fehler passiert.“
„Ein Fehler?“, erkundigte sie sich verwirrt. Sein Lächeln wurde breiter.
„Sie wurden vom Storch an die falsche Adresse geliefert.“
Sie lachte.
„So ist es, nicht wahr?“
Sie zeigte zum Himmel.
„Sehen Sie: Eine Sternschnuppe!“
„Das war eine sehr lange Sternschnuppe. Mein Vater sagte immer, wann immer du eine siehst, dann ist es eine Seele, die in den Himmel steigt.“
„Ich mag das. Sollten wir uns nicht etwas wünschen können?“, fragte sie. Jack sah sie an und stellte fest, dass sie sehr nah beieinander waren. Es wäre ihm ein leichtes gewesen, die verbliebene kurze Distanz zu überwinden, um sie zu küssen. Rose schien dasselbe zu denken, so kam es ihm vor.
„Und … was würden Sie sich wünschen?“, fragte er. Sie sah ihn einen Moment an, dann zog sie sich vorsichtig zurück.
„Etwas, das ich nicht haben kann“, antwortete sie. Sie lächelte traurig. „Gute Nacht, Jack.“
Sie verließ die Reling und huschte in den Eingang zur Ersten Klasse.
„Rose!“, rief Jack. Aber die Tür fiel ins Schloss, sie war fort – zurück in ihrer Welt.
Kapitel 13
Katerfrühstück
Der folgende Tag, Sonntag, der 14. April 1912, war erneut ein strahlend schöner Tag.
Rose und Cal saßen beim Frühstück auf ihrem sonnendurchfluteten privaten Promenadendeck und schwiegen sich an, während der ihnen zugeteilte Steward schon die ersten Geschirrteile abräumte und Trudy noch mit der Kaffeekanne hantierte. Sie goss bei Rose noch nach, die ihr die Kaffeetasse hinhielt.
„Kaffee, Sir?“, bot sie Cal an, der aber nur schweigend und mit grimmigem Gesicht leicht den Kopf schüttelte. Trudy zog sich ebenso wie der Steward zurück. Cal sah ihr nach, als wollte er sich sicher sein, dass das Gespräch, das er nun aufzunehmen gedachte, nur an Roses und seine Ohren drang. Er stellte die geleerte Tasse beiseite, während Rose eher teilnahmslos in ihrem Kaffee rührte.
„Ich … hatte gestern gehofft, du würdest noch zu mir kommen“, sagte er. Die darin verborgene Anzüglichkeit, dass Rose noch vor der offiziellen Hochzeitsnacht mit ihm das Bett teilen würde, wollte er keinesfalls vor Dienstboten laut werden lassen. Rose trank von ihrem Kaffee und hätte sich bei diesen Worten beinahe verschluckt. Sie fing sich gerade noch, stellte die Tasse auf die Untertasse, die sie in der Hand hielt.
„Ich war sehr müde“, begründete sie ihr Nichtkommen. Cal fühlte sich von ihr auf den Arm genommen – und das konnte er überhaupt nicht ausstehen.
„Du … musst dich zweifellos unter Deck etwas verausgabt haben“, bemerkte er spitz. Jetzt war es Rose, die den ironischen, spitzzüngigen Ton gar nicht leiden konnte.
„Du hast also deinen Totengräber von Diener beauftragt, mich zu verfolgen“, stellte sie fest. „Typisch für dich!“, versetzte sie eisig.
Cal beherrschte sich nur noch mit Mühe. Er brachte es gerade noch fertig, halbwegs ruhig zu klingen, doch seine höher steigende Wut war unüberhörbar, als er zischte:
„Du wirst dich nicht noch einmal so aufführen. Hast du verstanden?“
Rose war es leid, in dieser Familie nur als Repräsentationsfigur und Befehlsempfängerin angesehen zu werden.
„Ich bin keiner deiner Vorarbeiter, die du herumkommandieren kannst. Ich bin … deine Verlobte, Caledon“, entgegnete sie kühl.
„Meine Verlobte“, äffte er ihren eisigen Tonfall nach. „Meine Ver… meine Verlobte!“, explodierte er, sprang auf und schleuderte mit einer zorngeladenen Armbewegung den Rattantisch weg, der zwischen ihnen stand, so dass er auf die Platte fiel. Das noch auf dem Tisch befindliche Geschirr samt Tischdecke flog im hohen Bogen zu Boden, gleich, ob noch etwas darin oder darauf war, dass es sich einem Hagelschauer gleich auf dem Boden des privaten Promenadendecks verteilte.
„Genauso ist es! Und meine Frau! Praktisch meine Frau, wenn auch noch nicht vor dem Gesetz!“, brüllte er und fasste ihren Sessel an beiden Armlehnen, als wollte er sie mitsamt dem Sessel umwerfen.
Rose war starr vor Schrecken. Bis jetzt hatte er gespottet, hatte bissige Bemerkungen gemacht, aber er hatte sie noch nie derartig angebrüllt. Sie befürchtete, dass er es nicht beim gewaltsamen Wegschleudern des Tisches belassen würde …
„Und deshalb wirst du mich ehren!“, donnerte er weiter, ganz nahe bei ihr. Sie hatte keine Chance, ihm auszuweichen, weil er sie in ihrem Sessel praktisch gefangen hielt. „Du wirst mich so ehren, wie es sich für eine Frau gehört, ihren Mann zu ehren. Denn ich werde mich nicht zum Narren machen lassen, Rose“, zischte er, wieder leiser, aber keinesfalls weniger bedrohlich. „Gibt es noch irgendwelche Unklarheiten?“, fragte er dann – es war klar, dass er nur eine ganz bestimmte Antwort erwartete und zulassen würde.
Rose zitterte am ganzen Leib.
„Nein“, erwiderte sie mühsam und mit vor Angst bebender Stimme. Cal fand sein übliches, arrogantes Lächeln wieder.
„Gut“, säuselte er sarkastisch. „Entschuldige mich.“
Damit verließ er das private Promenadendeck und ließ eine zutiefst geschockte Rose zurück, die ob dieser offenen Drohung mit rabiater Gewalt völlig eingeschüchtert war.
Trudy, die die Szene von der Tür aus mitbekommen hatte, war über den lautstarken Ausbruch Hockleys nicht weniger erschrocken als ihre junge Arbeitgeberin.
„Oh, Miss Rose!“, keuchte sie entsetzt und eilte hinzu, um das Trümmerfeld zu beseitigen, das Cals Wutanfall hinterlassen hatte.
„Das war ein kleines …“, japste Rose tränenerstickt.
„Das macht nichts, Miss Rose“, beruhigte Trudy die junge Frau, die ihr noch nie so verängstigt erschienen war. Diener waren schließlich dazu da, hinter ihren Herren herzuräumen …
„… kleines Miss… geschick“, stotterte Rose. „Tut mir Leid“, bat sie um Entschuldigung.
Sie war so durcheinander, dass sie einerseits Cal sogar schützen wollte und andererseits der Dienerin, die dieses Chaos in keiner Weise zu verantworten hatte, die Arbeit nicht allein überlassen wollte.
„Warten Sie, ich helfe Ihnen“, keuchte sie und ging zu Trudy hinunter in die Knie.
„Nein, lassen Sie nur“, tröstete Trudy erneut und half Rose von den Scherben weg. Sie fiel nach hinten und riss den Rattansessel dabei noch fast um, schluchzte haltlos.
„Ist schon gut“, beruhigte Trudy sie weiter und sammelte nebenbei die Scherben auf.
Etwas später hatte Rose sich wieder von dem Schrecken erholt und bat Trudy in ihrem Schlafzimmer, ihr ins Korsett zu helfen. Es war unmöglich, dieses Körpergefängnis aus Stoff und Fischbein allein anzuziehen oder abzulegen. Schon ihr erster Nervenzusammenbruch vor gerade einmal eineinhalb Tagen war auf die mangelnde Praxistauglichkeit weiblicher Mode zurückzuführen gewesen. Äußerlich schien sie sich mit einem Leben im goldenen Käfig abgefunden zu haben, innerlich suchte sie bereits nach der nächsten Fluchtmöglichkeit.
Trudy zog die Schnüre des Korsetts vorsichtig zu, um ihre junge Arbeitgeberin nicht wieder zu verschrecken.
Die Tür wurde geöffnet und Ruth DeWitt Bukater trat ein.
„Den Tee, Trudy!“, befahl sie der Dienerin in scharfem Ton. Trudy ließ augenblicklich die Korsettschnüre los, drehte sich um und knickste ehrerbietig vor ihrer Arbeitgeberin.
„Jawohl, Ma’am“, bestätigte sie und verließ die Suite. Ruth schloss hinter ihr die Tür und verriegelte sie gleich. Rose sah ihr nach und ahnte schon aus dem eisigen Gesichtsausdruck ihrer Mutter Böses. Mit eiligen, harten Schritten, die ihre Wut deutlich spüren ließen, trat Ruth an das Himmelbett, an dessen einem Pfosten ihre Tochter sich festhielt. Sie griff nach den Korsettschnüren und zurrte sie höchstpersönlich fest – und wesentlich weniger feinfühlig, als Trudy es getan hatte. Rose zuckte zusammen, als die unnachgiebigen Fischbeinstäbe ihr zunehmend die Luft nahmen.
„Du wirst diesen Jungen nicht wiedersehen! Hast du mich verstanden?“, fuhr sie Rose an. Ihre Tochter antwortete nicht, sondern ließ es einfach über sich ergehen, dass sie grob eingeschnürt und erneut im Befehlston daran erinnert wurde, wo sie in der familiären Hierarchie stand – auf der letzten Stufe vor den Dienern …
„Rose!“, fauchte Ruth drohend. „Ich verbiete es!“, stellte sie mit unverblümter Härte klar. Rose seufzte, ebenso gereizt wie entnervt und resigniert.
„Ach, hör bitte auf, Mutter! Du bekommst nur wieder Nasenbluten“, warnte sie vor den Folgen aufregungsbedingten Bluthochdrucks. Ruth war nicht in der Stimmung, um sich Bissigkeiten dieser Art gefallen zu lassen, schon gar nicht, wenn sie dabei war, ihre chronisch rebellische Tochter zurechtzuweisen. Sie packte Rose und riss sie herum.
„Das hier ist kein Spiel“, fuhr sie sie an. „Du weißt ganz genau: Wir haben kein Geld mehr! Wir sind in einer prekären Lage!“
„Ich weiß, dass unser Geld weg ist“, erwiderte Rose mit einem Anflug von Müdigkeit. „Du erinnerst mich täglich daran.“
Ruth kam noch näher heran.
„Dein Vater hat uns nichts außer einem Schuldenberg hinterlassen, der sich hinter einem guten Namen versteckt! Dieser Name ist die einzige Karte, die wir noch ausspielen können“, sagte sie eindringlich. Rose schwieg.
„Ich verstehe dich nicht!“, fuhr ihre Mutter nach einer Pause fort. „Die Verbindung mit Hockley ist tadellos! Sie wird unser Überleben sichern!“
„Wie kannst du mir bloß so eine Last aufbürden?“, entgegnete Rose. Sie hatte den Ruin der Familie nicht verursacht, aber sie sollte dafür herhalten, dass ihre Mutter den Luxus nicht aufgeben musste, den sie gewohnt war, seit sie Roses Vater geheiratet hatte. Rose fühlte sich regelrecht verkauft.
„Wie kannst du nur so selbstsüchtig sein?“, fauchte Ruth. Seit die Menschen zu denken begonnen hatten, war es üblich, dass Kinder, die erwachsen wurden, für ihre Eltern sorgten, wenn diese nicht mehr in der Lage waren, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Sie hatte dabei nur eine Kleinigkeit übersehen … Es war nicht so, dass sie nicht hätte für ihren Lebensunterhalt sorgen können – sie wollte es nicht, sah es als unter ihrer Würde an, von ihrer Hände Arbeit zu leben.
Rose glaubte, sich jetzt wirklich verhört zu haben. Sie sollte einen Mann heiraten, den sie nicht mochte, damit ihre Mutter weiterhin die feine Lady geben konnte, die im Geld schwamm. Wer war hier selbstsüchtig?
„Ich bin selbstsüchtig???“, fragte Rose mit unüberhörbarer Bitterkeit und wachsender Wut. Ruth erkannte durchaus, dass ihre Tochter wieder Boden unter den Füßen gewann und wütend wurde. Sie hatte diese Ehe eingefädelt, hatte Rose weniger gefragt, ob sie Hockley heiraten wollte, als sie dahingehend manipuliert, dass sie als brave Tochter für das Wohlergehen ihrer Mutter zu sorgen hatte. Jetzt packte sie die Panik, dass Rose nicht mehr mitspielen würde, sich mit diesem … Zwischendeckschmarotzer … davonmachen würde und ihre Mutter einem ungewissen Schicksal überlassen würde. Für Ruth war es eine grauenhafte Vorstellung, selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen zu müssen, nicht mehr anderen die unangenehmen alltäglichen Verrichtungen überlassen zu können … Schrecklich …
„Willst du etwa, dass ich als Näherin unser Geld verdiene? Ist es das, was du willst?“, fragte sie und erwartete Schuldbewusstsein von Rose, ihre arme Mutter zu solch niederen Tätigkeiten zu zwingen, um selbst davon zu leben. Dass Rose vielleicht eigene Vorstellungen von ihrer Zukunft hatte, interessierte sie nicht. Sie erwartete Dankbarkeit für ihre bisherige Fürsorge und eine Gegenleistung. „Willst du, dass all unsere schönen Sachen versteigert werden? Und unsere geliebten Erinnerungen verstreut werden?“
Sie wandte sich ab, schlug die Hand vor den Mund, weil sie schon allein der Gedanke dran fast umbrachte, Schmuck, teure Kleidung, schöne Möbel, kostbares Tafelsilber, edles Geschirr und ebenso schöne wie teure Gemälde in die Hände von Menschen zu geben, die damit außer einem gewissen praktischen Nutzen oder einem schönen Anblick nichts verbanden.
Rose resignierte erneut und verlor ihre aufrechte Haltung.
„Das ist so ungerecht!“, seufzte sie. Ihre Mutter drehte sich wieder um.
„Natürlich ist es ungerecht“, bestätigte sie. „Wir sind Frauen. Unsere Entscheidungen sind niemals leicht zu treffen.“
Sie nahm Roses Gesicht in beide Hände und gab ihr einen liebevollen Kuss.
„Komm …“, sagte sie leise. Rose drehte sich wieder um und ließ es geschehen, dass ihre Mutter ihr das Korsett schnürte – nun allerdings nicht mehr mit zornigem, strafendem Reißen an den Schnüren, sondern so vorsichtig, wie es sich gehörte.
Wenig später, es war halb elf am Vormittag, hatten sich die Passagiere der Ersten Klasse zum Sonntagsgottesdienst im Speisesaal auf dem D-Deck eingefunden, an dem auch Captain Smith und seine Offiziere teilnahmen, soweit sie nicht auf der Brücke sein mussten. Der Captain stand vor dem Rednerpult, das hier als Kanzel diente, rechts neben ihm seine Offiziere. Zwischen ihm selbst und den Passagieren war einer der Restauranttische mit chamoisfarbener Tischdecke, Blumenschmuck und hölzernem Standkreuz als Altar hergerichtet. Der Gottesdienst, der hier gefeiert wurde, war ein Wortgottesdienst ohne Pfarrer, den jeder christliche Gläubige abhalten konnte, sofern er eine Bibel oder ein Messbuch hatte. Die Teilnehmer des Gottesdienstes hielten eine Broschüre im Folio-Format mit geistlichen Liedern in den Händen, die die White Star Line für die Gottesdienste an Bord ihre Schiffe herausgab.
Man sang den Choral „Eternal Father, Strong To Save“:
Protect them by Thy guiding hand
From every peril on the land
O spirit whom the Father sent
To spread abroad the firmament
O wind of heaven, by Thy might
Save all who dare the eagle’s flight
And keep them by Thy watchful …
Unter den Gästen der Ersten Klasse, die am Gottesdienst nicht teilnahmen, war Thomas Andrews, der wie immer mit möglichen Verbesserungen seines Meisterstücks beschäftigt war. Mit einem Notizbuch bewaffnet streifte er durch die Gänge und schrieb sich auf, was wo noch zu optimieren war. In diesem Moment stand er auf dem Treppenabsatz des halben Stockwerks und notierte etwas, als von oben her Schritte klangen.
Von dort, vom C-Deck, kam Jack Dawson herunter. Er sprang ebenso lässig wie elegant die Stufen hinunter. Seine Kleidung war wieder die einfache Arbeitergarderobe, die er sein eigen nennen konnte, seine einzige eigene Kleidung. Er wollte sich vergewissern, dass es Rose gutging – behauptete er vor seinem Gewissen. Tatsächlich steckte schon ein deutlich darüber hinausgehendes Gefühl hinter diesem Besuch …
„Hallo, Mr. Andrews“, grüßte er höflich, als er den Ingenieur bemerkte. Andrews sah von seinen Notizen auf und erwiderte Jacks ansteckendes Lächeln.
„Hallo, Jack“, grüßte er freundlich zurück. Jack hüpfte die letzten Stufen hinunter und ging geradewegs auf den Speisesaal der Ersten Klasse zu.
Zwei Stewards standen davor und hatten die Aufgabe, den vornehmen Herrschaften die Türen zu öffnen und die weniger vornehmen Fahrgäste davon abzuhalten, den Speisesaal zu betreten. Sie stellten sich Jack prompt in den Weg.
„Sir …“, bremste der links neben der Tür stehende Steward, der Jack am Abend zuvor eingelassen hatte, ohne auch nur ansatzweise irgendwelche Schwierigkeiten zu machen – aber da war der junge Mann im geliehenen Frack erschienen …
„Ich muss nur mal ganz kurz …“, setzte Jack an, aber der Steward ließ ihn nicht vorbei.
„Sir, Sie dürfen sich hier nicht aufhalten“, erklärte er so freundlich wie möglich und fuhr einen Arm als Schranke aus.
„… mit jemandem reden …“, versuchte Jack es weiter.
„Es tut mir Leid …“, erwiderte der Steward und schob den offensichtlich aus der Dritten Klasse gekommenen Passagier vorsichtig, aber bestimmt von der Tür weg. Jack wand sich wie ein Aal, um vorbeizuschlüpfen, aber auch der andere Steward bewachte die Tür wie ein Beefeater den Tower von London.
Spicer Lovejoy stand zwar im Speisesaal, aber mehr als wachsamer Beobachter und nicht als Teilnehmer des Gottesdienstes. Die Diskussion vor dem Saal erregte seine Aufmerksamkeit. Er ging zur Tür.
„Erinnern Sie sich nicht?“, appellierte Jack an das Gedächtnis des Stewards, der ihn am Abend zuvor ohne weiteres eingelassen hatte. „Ich war gestern Abend auch hier.“
Der Steward schüttelte den Kopf.
„Bedaure, ich erinnere mich nicht“, erwiderte er. „Und jetzt muss ich Sie bitten …“
„Er kann es bestätigen“, versuchte Jack, Lovejoy als Zeugen für seine Anwesenheit in diesen heiligen Hallen am Vorabend zu gewinnen und gestikulierte in Richtung des grimmig dreinschauenden Dieners von Roses Verlobtem, der gerade aus der Flügeltür des Speisesaales kam. „Ich möchte nur mit ihr reden …“
Lovejoy baute sich zwischen den beiden Stewards auf wie Zerberus vor dem Tor zur Unterwelt.
„Mr. Hockley und Mrs. DeWitt Bukater sind Ihnen weiterhin für Ihre Dienste sehr verbunden“, sagte er zu Jack und zückte zwei Zwanzig-Dollar-Scheine aus der Hosentasche.
„Sie haben mich gebeten, Ihnen das als Zeichen Ihrer Anerkennung zu geben“, ergänzte er und hielt Jack die Geldscheine hin.
„Ich will das Geld nicht“, wehrte Jack ab. „Bitte, ich will doch nur …“
„Ich soll Sie auch noch mal daran erinnern, dass Sie eine Fahrkarte der Dritten Klasse haben und Ihre Anwesenheit hier nicht länger erwünscht ist“, versetzte Lovejoy. Doch Jack wollte die Sache noch nicht verloren geben.
„Bitte, ich möchte doch nur ganz kurz mit Rose reden, okay?“
Lovejoy zog den Arm zurück, nahm in jede Hand einen der Geldscheine und bot sie den Stewards an, den Blick stur auf Jack gerichtet.
„Gentlemen, würden Sie bitte dafür sorgen, dass Mr. Dawson wieder dorthin gelangt, wo er hingehört – und auch dort bleibt!“, sagte er. Die Stewards griffen zu. Ein derartiges Trinkgeld bekam man auch als Steward in der Ersten Klasse wahrlich nicht alle Tage.
„Bitte!“, bettelte Jack, aber die beiden Stewards packten ihn an den Armen.
„Jawohl Sir. Kommen Sie, bitte“, sagte der Steward, der Jack am Abend zuvor eingelassen hatte.
Im Speisesaal sah Caledon Hockley mit höhnischem Grinsen, dass der Störenfried vor der Tür auf Lovejoys Intervention weggebracht wurde.
Die Gemeinde im Speisesaal sang die letzten Zeilen des Chorals:
Hear us when we cry to Thee
For those in peril on the sea.
Sie ahnten nicht einmal, dass diese Zeilen sie in guten zwölf Stunden selbst betreffen würden …
Kapitel 14
Verbotenes Wiedersehen
Nach dem Gottesdienst bot Thomas Andrews in Abstimmung mit Captain Smith einigen Passagieren der Ersten Klasse, darunter auch Rose und Ruth DeWitt Bukater und Caledon Hockley, eine Besichtigung des Schiffes an. Die Tour begann im Fitnessraum, wo eine Dame im langen Kleid auf einem stationären Fahrrad strampelte. Cals Blick wurde augenblicklich von dem Rudergerät angezogen. Er setzte sich, nahm die Stangen, die die Riemen ersetzten und legte los. Es war unverkennbar, dass er Übung mit diesem Gerät hatte.
„Das erinnert mich an meine Zeit in Harvard“, sagte er mit jungenhaftem Grinsen, während er kräftig pullte. T. W. McCauley, der Fitnessinstrukteur, war ein eher kleiner, dafür umso agilerer Mann, der in weißem Flanellanzug die Passagiere zu sportlicher Aktivität animierte. Er war sehr eifrig darin, den Gästen seine modernen Geräte vorzuführen. Er legte einen Schalter um und ein Gerät mit Sattel setzte sich einen eine wellenförmige Bewegung.
„Das elektrische Pferd ist sehr gefragt. Wir haben auch ein elektrisches Kamel, wenn Sie es ausprobieren möchten“, warb er mit dem Talent eines berufsmäßigen Marktschreiers. Rose legte neugierig eine Hand an das elektrisch dahin galoppierende „Pferd“.
„Wagen Sie es und versuchen Sie es mal mit rudern, Ma’am“, wandte er sich an Ruth. Sie sah ihn abweisend an.
„Wie absurd! Ich kann mir wohl keine Fähigkeit vorstellen, die mir nutzloser erscheint als diese, Sir“, versetzte sie eisig. Andrews verkniff sich gerade noch ein zu amüsiertes Schmunzeln.
„Die nächste Station auf unserer Tour ist die Brücke. Hier entlang, bitte“, lud er zum Weitergehen.
Auf der Brücke, wunderte Ruth sich gleich darüber, dass es hier zwei Steuerräder gab.
„Und warum gibt es zwei Steuerräder?“, fragte sie.
„Dieses wird nur in Küstennähe eingesetzt“, erwiderte der Captain mit geduldigem Lächeln.
Harold Bride, einer der beiden Funker der Titanic, kam mit eiligen Schritten auf die Brücke und räusperte sich, um die Aufmerksamkeit des Captains zu bekommen, der den reichen Passagieren die Brücke erklärte.
„Verzeihung, Sir“, sprach er ihn an. Smith wandte sich ihm zu.
„Noch eine Eiswarnung. Diesmal von der Noordam“, sagte Bride und reichte Smith die handschriftliche Dechiffrierung des Funkspruchs .
„Danke, Sparks …“, nahm ihm der Captain die Meldung ab und steckte sie in die Tasche.
Sparks, also Funke, war eine scherzhafte Bezeichnung für die Funker im militärischen Bereich, besonders aber auf See, wo die Funktechnik noch in den Kinderschuhen steckte. Längst nicht alle hochseetüchtigen Schiffe verfügten über Funkanlagen. Auf der Titanic war sie als von der Firma Marconi betriebene Luxuseinrichtung eingebaut, damit die reichen Passagiere von Bord aus ihre Ankunft ankündigen konnten, ihnen wichtig erscheinende Nachrichten absetzen konnten oder damit wichtig tun konnten. Die Funkanlage der Titanic hatte eine Wichtigkeits- und Sicherheitsstufe für das Schiff, die vielleicht mit dem hundert Jahre später für ähnliche Zwecke genutzten Twitter vergleichbar wäre – praktisch Null …
Smith sah die augenblicklich auf den Gesichtern seiner Brückengäste aufkeimende Besorgnis. Eiswarnung? Das klang nicht wirklich gut …
„Oh, kein Grund zur Aufregung. Zu dieser Jahreszeit völlig normal. Wir legen sogar noch an Geschwindigkeit zu. Ich habe angeordnet, den letzten Kessel zu beheizen“, beruhigte der Captain mit väterlich-ruhiger Stimme die Damen und den jungen Herrn.
Während Thomas Andrews den nach Ansicht der Reederei wichtigen Passagieren sein Schmuckstück von Schiff präsentierte, nahm Jack Dawson gezielt Kurs auf das A-Deck, auf dem er seiner Fahrkarte nach gar nichts zu suchen hatte. Tommy Ryan und Fabrizio de Rossi begleiteten ihn, Tommy versuchte ihm auszureden, was er vorhatte:
„Sie ist eine Göttin unter sterblichen Menschen, keine Frage. Aber sie ist in ‘ner anderen Welt, Jackie, vergiss sie! Sie hat die Tür zugeschlagen.“
Jack ließ sich davon nicht beeindrucken und schlich weiter nach achtern zu der Wand, die unter der Promenade des A-Decks war.
„Ihre Leute waren das, nicht sie“, korrigierte er Tommys Sicht der Dinge und sah sich vorsichtig um. Die Luft war rein.
„Fertig? Los!“, kommandierte er. Tommy schüttelte resigniert den Kopf, ging in die Knie und formte seine Hände zur Räuberleiter. Jack stieg auf Tommys kräftige Hände und bekam den nötigen Schub, um geschickt über die Reling auf das A-Deck zu steigen.
„Er handelt nicht gerade logisch, sag’ ich dir“, brummte Tommy. Fabrizio grinste breit.
„Amore ist nicht logisch“, erwiderte er mit einer ausholenden, sehr italienischen Geste mit beiden Armen, die Ratlosigkeit und Fatalismus gleichzeitig ausdrückte.
Nahe bei dem Teil der Reling, die Jack überkletterte, waren Arthur Ryerson, sein Sohn Jack und ein älterer Passagier. Ryerson zeigte seinem Jungen, wie man einen Kreisel richtig startete:
„Du musst es ganz fest rumbinden“, erklärte er.
„Etwa so?“, fragte Master Jack, wie der Kleine von den Dienern genannt wurde und wickelte die Schnur fest um den Kreisel.
„Ja, so ist es gut … Und jetzt wirf ihn“, sagte Ryerson. Seinen Mantel hatte er in der warmen Sonne des Frühlingstages abgelegt und auf einem Deckstuhl liegen gelassen, der ältere Herr hatte seine Melone ebenfalls auf dem Stuhl abgelegt. Jack Dawson bemerkte die unbeaufsichtigte Kleidung und den Umstand, dass die beiden Herren ihre Aufmerksamkeit ganz dem Jungen widmeten, der seinerseits ganz auf den Kreisel konzentriert war. Auf Zehenspitzen näherte er sich dem Stuhl, schnappte sich Hut und Mantel, verschwand damit hinter der Ecke, wo er sich den Mantel überzog und den Hut aufsetzte.
Jack Ryerson ließ den Kreisel mit einem geschickten Wurf auf das Deck fallen, der Kreisel begann zu rotieren und stand kerzengerade auf der Spitze.
„Das war doch schon sehr gut“, lobte der ältere Passagier.
„Ist auch gut. Ich probier’s noch mal“, jubelte Klein-Jack.
„Tu das“, bestätigte sein Vater.
„Ein fabelhafter Junge“, schwärmte der Ältere.
„Das ist er in der Tat“, erwiderte Ryerson angetan.
„Wie gefällt es ihm auf dem Internat?“, erkundigte sich der Ältere.
„Bestens“, lächelte Ryerson.
Jack Dawson half seiner äußeren Erscheinung noch etwas nach und strich sich die Haare auf beiden Seiten hinter das Ohr. Dann sah er einige Passagiere angeführt von Thomas Andrews kommen und stellte sich an eines der Rettungsboote, um nicht sofort erkannt zu werden. Der unerlaubt geborgte Mantel und der Hut boten eine gewisse Tarnung und ließen ihn – von weitem betrachtet – wie einen Gentleman aussehen.
Die Gruppe, die Andrews führte, war seine Besichtigungsgruppe. Rose suchte die Nähe des Ingenieurs.
„Mr. Andrews … verzeihen Sie. Ich hab’ das mal nachgerechnet. Und bei der Kapazität der Rettungsboote, wie Sie es gerade erwähnten … verzeihen Sie bitte, aber … es scheint mir, es gibt nicht genügend Platz für alle Passagiere“, sagte sie. Andrews blieb stehen und sah die junge Frau einen Moment an. Wieder verzauberte sie ihn mit ihrer königlichen Erscheinung, die auch von ihrem Kostüm unterstrichen wurde: Es bestand aus einem königsblauen Samtjackett mit langen Ärmeln, das komplett mit ebenso königsblauer Seide gefüttert war, die an den Ärmelaufschlägen, Kragen und Revers nach außen sichtbar war. Die Revers waren mit asiatisch anmutenden Blumenmustern Ton in Ton bestickt. Ein gut handbreiter Seidengürtel umschloss das Jackett an der Taille und betonte Roses ohnehin schlanke Figur, die vom Korsett noch schmaler gepresst war. Das Jackett endete unter der Hüfte, wurde aber optisch noch durch vier schmale Lätze verlängert, die bis auf Kniehöhe reichten und am Ende mit goldfarbenen Metallkugeln abgeschlossen wurden. Der fast bodenlange Rock bestand ebenfalls aus königsblauer Seide, war gewickelt, ließ wenig Beinfreiheit und betonte wiederum die schlanke Silhouette. Am vorderen Saum wiederholte sich die Stickerei der Revers in einem Dreieck, dessen Spitze etwa bis zur Hälfte des Schienbeins reichte. Darunter trug sie ein weißes Mieder, das mit Spitze besetzt war. Um die Arme und den Rücken schlängelte sich ein cremefarbener Seidenschal, der mit goldfarbenen Applikationen besetzt war. Weiße Seidenhandschuhe, die weit unter die langen Ärmel reichten, sowie eine cremefarbene Häkelhandtasche ergänzten ihre Ausstattung.
„Für die Hälfte, um genau zu sein“, räumte Andrews ein. Dies entsprach den gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen Großbritanniens für Schiffe, die mehr als zehntausend Tonnen Verdrängung hatten. Dass es inzwischen Schiffe gab, die wie die Titanic erheblich mehr Wasser verdrängten, war bis zu den Verantwortlichen im zuständigen Ministerium noch nicht durchgedrungen …
„Rose, ich muss schon sagen: Ihnen entgeht nichts“, sagte der Ingenieur anerkennend. „Ich hab’ sogar diese neuartigen Davits einbauen lassen“, fuhr er fort und wies auf die Hebeeinrichtung einige Yards weiter achtern.
„Sie könnten noch eine Reihe Rettungsboote auf der Innenseite aufnehmen. Aber … es gab einige, die glaubten, das Deck sei dann zu voll gestellt. Und so … wurde ich überstimmt“, sagte er.
„Ohne Frage eine … Vergeudung von Platz auf einem unsinkbaren Schiff“, bemerkte Cal spitz und stieß mit dem Spazierstock geradezu verachtungsvoll gegen das Rettungsboot, vor dem Andrews stand, und ging dann Arm in Arm mit seiner künftigen Schwiegermutter weiter, die zu seiner Bemerkung zustimmend lächelte.
„Schlafen Sie beruhigt, kleine Rose. Ich hab’ Ihnen ein gutes Schiff gebaut. Stark und solide. Sie ist das einzige Rettungsboot, das nötig ist“, sagte Andrews lächelnd. „Gehen wir zum Heck. Nachher besichtigen wir noch den Maschinenraum“, rief er den schon vorausgegangenen Mitgliedern der Besichtigungstour hinterher.
Rose blieb etwas zurück. Sie konnte nicht recht verstehen, weshalb es auf einem Schiff wie diesem – unsinkbar oder nicht – nur für die Hälfte aller an Bord befindlichen Menschen Rettungsboote gab. Andrews’ Erklärung hatte sie keinesfalls beruhigt, auch wenn er meinte, ein solides Schiff geschaffen zu haben.
Der Mann, der bisher schweigend an dem von Cal so verachtungsvoll behandelten Boot Nummer 7 gestanden hatte, drehte sich hinter Rose um und fasste sie am Arm. Erschrocken wirbelte sie herum und war völlig überrascht, dass es Jack Dawson war.
„Kommen Sie!“, raunte er, winkte ihr hektisch und zog sie in die Tür des Fitnessraums, der jetzt leer war. Drinnen hatte sie ihre fünf Sinne endlich beisammen.
„Jack! Das ist einfach unmöglich! Wir dürfen uns nicht mehr sehen!“, protestierte sie. Er kam ihr näher.
„Ich muss mit Ihnen reden“, sagte er eindringlich. Rose wich zurück bis zur Fensterbank.
„Nein, Jack! Nein!“, wehrte sie erneut ab. „Jack … ich bin verlobt. Ich werde Cal heiraten. Ich liebe Cal“, behauptete sie – und wusste im gleichen Moment, dass es eine handfeste Lüge war. Er seufzte leise.
„Rose … Sie sind nicht gerade einfach. Ehrlich gesagt, sind Sie sogar ein kleines, verwöhntes Mädchen. Aber hinter dieser Fassade steckt das umwerfendste, hinreißendste, wundervollste Mädchen … Frau … die mir jemals begegnet ist. Und …“
Sie nutzte einen kurzen Moment, den er nicht direkt vor ihr stand und erhob sich, um den Fitnessraum zu verlassen.
„Jack, ich …“
Augenblicklich war er wieder zur Stelle und trat ihr in den Weg.
„Nein, nein … Lassen Sie mich versuchen, das in Worte zu fassen“, bremste er sie. Sie setzte sich wieder auf die Fensterbank.
„Ich … ich bin kein Idiot. Ich weiß, wie es auf der Welt zugeht. Ich hab’ läppische zehn Dollar in meiner Tasche und nichts, was ich Ihnen bieten könnte – und das weiß ich auch. Darüber bin ich mir im Klaren“, fuhr er mit einiger Leidenschaft und ausholender Geste fort. „Aber jetzt gehen Sie mich was an. Wenn Sie springen, dann spring’ ich auch – wissen Sie noch? Ich kann nicht einfach gehen, ohne zu wissen, dass es Ihnen gut geht. Das ist alles, was ich will.“
„Es geht mir gut. Es geht mir gut … wirklich“, sagte sie, auch wenn es nicht den Tatsachen entsprach. Jack durchschaute diesen Umstand.
„Wirklich?“, fragte er. „Ich glaube nicht. Merken Sie das nicht? Die halten Sie gefangen, Rose!“, stellte er mit richtig wütender Geste in Richtung Heck fest. „Und Sie werden eingehen, wenn Sie da nicht ausbrechen … Vielleicht nicht sofort, weil Sie stark sind. Aber … früher oder später wird das Feuer, das ich so an Ihnen liebe, Rose … dieses Feuer wird irgendwann verlöschen.“
Er streichelte liebevoll ihre Wange. Rose nahm seine Hand, ihre Augen schwammen in Tränen. Sah er ihr Dilemma nicht? Sie konnte nicht so einfach ausbrechen …
„Es ist nicht Ihre Aufgabe, mich zu retten, Jack“, erwiderte sie mit versagender Stimme.
„Da haben Sie Recht“, räumte er ein. „Das können nur Sie allein.“
Er konnte ihr nur die Tür aufmachen, hindurchgehen musste sie schon selbst … Rose wandte sich von der Fensterbank ab.
„Ich muss jetzt gehen. Lassen Sie mich in Ruhe!“, versetzte sie und ließ ihn im Fitnessraum allein. Er sah ihr nach, tief getroffen von ihrer so offensichtlichen Ablehnung.
Der Tag schritt fort. Zum Tee trafen sich die Damen DeWitt Bukater mit der Gräfin von Rothes und Lady Lucile Duff Gordon im Salon des D-Decks. Während sich Ruth mit den anderen Damen angeregt unterhielt, saß Rose teilnahmslos da.
„Ruth, erzählen Sie Lucile, was Sie für ein Theater mit der Druckerei hatten“, bat die Gräfin. Ruth hielt ihre Teetasse mit geziert ausgestrecktem kleinem Finger in der rechten Hand und sagte:
„Die Einladungen mussten natürlich zweimal nachgebessert werden!“
„Du liebe Güte!“, entfuhr es Lady Duff Gordon.
„Und die scheußlichen Kleider für die Brautjungfern! Ich muss Ihnen erzählen, was das für eine Odyssee war! Rose hatte beschlossen, dass sie Lavendel tragen will. Ich kann diese Farbe nicht ausstehen. Sie hat es nur gemacht, um mich zu ärgern“, fuhr Ruth fort.
„Wenn Wenn Sie sich doch nur schon eher an mich gewandt hätten!“, entfuhr es Lady Duff Gordon „Lucy hat ein paar meiner Entwürfe in der La Mode Illustré gesehen. Sie waren für die Aussteuer der jüngsten Tochter der Herzogin von Marlborough bestimmt. Sie waren recht ansprechend. Aber Sie werden mir sicher Recht geben, meine Liebe, dass wir gemeinsam eine Art Phönix aus der Asche erschaffen haben.“
Rose schaltete jetzt endgültig aus dem Gespräch ab und sah sich im Salon um. Ihr Blick fiel auf eine elegant gekleidete Dame mit ihrer ebenso aufwändig gekleideten Tochter an einem der Nachbartische, die für sich und ihr Kind außer Tee auch Kuchen bestellt hatte. Die Kleine saß zusammengesunken in dem für sie viel zu großen Sessel. Ihre Mutter beugte sich zu ihr herüber, fasste ihr an den Rücken und machte ihr damit deutlich, dass sie gerade sitzen sollte. Den gesellschaftlichen Regeln der britischen Upper Class und auch der amerikanischen Geldaristokratie entsprach es, kerzengerade zu sitzen und die Stuhl- oder Sessellehne niemals mit dem Rücken zu berühren. Die Kleine richtete sich auf, bis sie steif wie eine Puppe dasaß, dann nahm sie ihre Serviette in die behandschuhten Händchen, faltete sie mit gezierter Handhaltung auseinander und legte sie sich derartig steif auf den Schoß, dass es Rose ganz anders wurde. Schlagartig wurde ihr klar, dass Jack Recht hatte: Hier würde man sie weiterhin genauso verbiegen wie dieses kleine Mädchen gerade verbogen wurde. Sie musste hier raus – sofort.
Jack Dawson hing zusammengesunken an der Bugreling. Eben gerade war die Sonne hinter dem Horizont verschwunden, der Himmel färbte sich langsam rot. Er bemerkte es kaum. Enttäuschung und tief sitzender Schmerz waren ihm ins Gesicht geschrieben wie in ein offenes Buch. Er hatte sich geirrt. Sie war eben doch ein verwöhntes Mädchen, das sich aus den Fesseln, die ihr die Gesellschaft angelegt hatte, nicht freiwillig befreien würde. Vielleicht war es auch längst zu spät dazu … Aber sie war ein Mädchen, das er nie – niemals – vergessen konnte. Niemals zuvor hatte ihn eine Frau so tief berührt. Dabei hatten sie sich nicht mal geküsst, geschweige denn, dass mehr geschehen war. Er hatte sich verliebt, erkannte er, richtig verliebt. Dass sie so offensichtlich wider ihren eigenen Wunsch diesen … Pinguin … heiraten wollte, machte den Schmerz in seinem Inneren nur umso schlimmer. Es tat weh, dass sie offenen Auges in ihr gefühlsmäßiges Verderben rannte – und ganz genau wusste, dass es sie zerstören würde. Nein, das hatte sie nicht verdient. Sie verdiente, geliebt zu werden – und er liebte sie.
„Hallo, Jack“, hörte er eine wohlbekannte Stimme hinter sich. Das konnte doch nicht wahr sein … Er drehte sich um und stellte fest, dass es keine akustische Halluzination war, die ihm ihre Nähe vorgegaukelt hatte. Sein Herz tat einen Sprung und zauberte ein Lächeln auf sein Gesicht.
„Ich … hab’ meine Meinung geändert“, sagte sie mit einem verlegenen Lächeln und einem leichten Schulterzucken. Sein Lächeln verstärkte sich, er ging langsam auf sie zu.
„Sie sagten, hier oben würde ich Sie …“
Er legte den Zeigefinger an die Lippen.
„Schhhh“, bedeutete er ihr zu Schweigen. Nein, sie sollte sich nicht entschuldigen müssen, es war unnötig. Er streckte die Hand nach ihr aus.
„Geben Sie mir Ihre Hand“, bat er leise. Sie tat es, ohne zu ahnen, was er jetzt vorhatte.
„Jetzt schließen Sie Ihre Augen“, fuhr er fort. Sie sah ihn verstört an. Wollte er sie etwa küssen?
„Na los“, bekräftigte er, als sie nicht tat, worum er sie bat. Sie beschloss, ihm zu vertrauen und schloss die Augen. Er trat hinter sie, schob sie ganz vorsichtig in Richtung Reling. Es fühlte sich unglaublich gut an, als er ihre linke Hand in die seine nahm. Seine Hände waren sanft und trotz des kühlen Windes warm.
„Steigen Sie hier rauf. Halten Sie sich an der Reling fest“, sagte er leise. Seine Stimme klang so warm in ihren Ohren, dass sie schon glaubte, zu schweben.
„Die Augen bleiben zu! Nicht aufmachen!“, erinnerte er sie sanft an seine Regel. Sie musste lächeln.
„Nein, mach’ ich nicht“, versprach sie. Nettes Spiel. Was hatte er nur vor?
„Jetzt steigen Sie oben auf die Reling. Schön festhalten. Schön festhalten“, fuhr er fort und half ihr auf die unteren Stangen der Bugreling. „Und nicht die Augen aufmachen. Vertrauen Sie mir.“
„Ich vertraue Ihnen“, erwiderte sie und spürte in diesem Moment eine Geborgenheit, die sie wohl noch nie empfunden hatte. Sie stand auf zwei dünnen Metallrohren, hinter sich spürte sie Jacks unmittelbare Nähe. Seine warmen Hände nahmen die ihren und lösten sie vorsichtig von der Reling. Langsam zog er ihre Arme zur Seite, bis sie ganz ausgestreckt waren. Ihr Schal, den sie um Arme und Rücken gelegt hatte, flatterte an den Armen wie die Schwungfedern ausgebreiteter Flügel. Der Druck des Fahrtwindes ließ sie die Relingstangen schon fast nicht mehr spüren. Er ließ ihre Hände los, seine Hände legten sich sachte auf ihre Taille. Himmel, was für eine unglaubliche Berührung! In diesem Augenblick spürte sie nur noch Jacks Künstlerhände, die so unendlich sanft ihren Leib berührten und dennoch verlässliche Kraft verrieten.
„In Ordnung“, flüsterte er. „Jetzt öffnen Sie die Augen.“
Sie tat es. Vor sich sah sie nichts als den weiten Ozean, sie spürte den Luftdruck unter ihren Armen, das Flattern ihres Schals. Sie schwebte, sie flog – ja, genau das!
„Ich fliege! Jack!“, jubelte sie.
Im flammenden Abendrot standen zwei im Vergleich zu dem gewaltigen Bug der Titanic winzig erscheinende Menschen wie Galionsfiguren an der Spitze des Riesenschiffes und schienen gleichzeitig ebenso fest mit dem Schiff verwachsen wie federleicht davon abgehoben.
Jack ließ ihre Taille los, breitete ebenfalls die Arme aus und nahm ihre Hände, die sich unwillkürlich ineinander verschränkten wie Körper in ebenso zärtlichem wie leidenschaftlichem Liebesspiel.
„Come, Josephine, in my flying machine, going up she goes, up she goes“, sang er leise direkt neben ihrem Ohr. Rose war völlig hingerissen von dieser geradezu irreal erscheinenden Romantik in knalligem Abendrot, die sie auf jedem gemalten Bild als blanken Kitsch empfunden hätte. Nein, das hier war etwas unglaublich Schönes; etwas, das Cal ihr in hundert Jahren nicht bieten würde. Sie hätte sich jetzt nicht mehr gewundert, wenn der Himmel plötzlich von einem grünen Blitz überstrahlt worden wäre, der in alten Seefahrerlegenden die Rückkehr einer Seele aus dem Reich der Toten anzeigte … Ihrer eigenen in diesem Fall … Sie lebte wieder.
Er nahm ihre Hände aus der Flugposition zurück und führte sie an ihren Leib. Rose drehte den Kopf zu ihm. Fast gleichzeitig fanden sich ihre Lippen zu einem langen, unendlich zärtlichen Kuss, der jeden Zweifel zum Schweigen brachte. Dieser Kuss sagte mehr als jedes Wort jetzt hätte ausdrücken können …
Kapitel 15
Das Porträt
Die altgewordene Rose kehrte mental wieder in den Kontrollraum der Keldysh zurück, ihre Zuhörer ebenfalls – aber nur, weil das Diktiergerät abschaltete. Das Geräusch war leise, eigentlich kaum wahrnehmbar, aber es genügte doch, um den Zauber der Erzählung der alten Dame zu brechen und sie allesamt wieder in die Gegenwart zurückzuholen.
Der Bug auf dem Monitor wurde wieder das, was er seit vierundachtzig Jahren war: Ein rostiges Wrackteil auf dem tiefen Meeresgrund, Spielplatz für Meerjungfrauen, Kalmare und Davy Jones persönlich …
Rose wandte sich den Zuhörern zu, während Brock die Kassette tauschte.
„Das war das letzte Mal, dass die Titanic das Tageslicht sah“, sagte sie. Lovett setzte sich wieder zurecht, nachdem er das Diktiergerät wieder eingeschaltet hatte.
„Der Abend vor der Kollision“, sagte er leise. „Es sind noch sechs Stunden.“
„Unglaublich!“, grollte Bodine und schob seinen massigen Körper nach vorn. „Dieser Smith steht einfach da, hat ’ne Eisbergwarnung in seiner Scheißhand …“
Er unterbrach sich, als ihm die sprachliche Entgleisung bewusst wurde.
„Entschuldigen Sie bitte“, bat er um Nachsicht. „… in seiner Hand … und er ordnet eine noch höhere Geschwindigkeit an!“
Lewis konnte nicht begreifen, dass ein so erfahrener Captain wie E. J. Smith derart leichtfertig einen solchen Blödsinn veranstaltete, für den jedem jüngeren Schiffsführer wohl die Kolbenringe – die Litzenstreifen am Ärmel – abgerissen worden wären. Lovett hatte damit kein so großes Problem.
„Die sechsundzwanzig Jahre Erfahrung haben seinen Blick getrübt“, warf er ein. Betriebsblindheit ist eine Berufskrankheit der besonders Erfahrenen … Bodine würde das irgendwann auch merken.
„Er dachte, dass man alles, was groß genug war, das Schiff zu versenken, rechtzeitig sehen würde“, setzte Brock hinzu. „Aber für die Größe des Schiffes war das Ruder viel zu klein. Damit konnte man keine Kurve nehmen. Sein ganzes Wissen war nichts wert …“
Rose hörte nicht hin. Der Steckkamm mit dem Jade-Schmetterling in ihrer Hand führte sie geradewegs wieder zurück in die Vergangenheit. Sie sah auf den Monitor, der den Kamin der Suite B-52 zeigte. Auf dem Monitor war es ein bläuliches Bild, das die Kälte der Tiefsee eindrucksvoll dokumentierte, doch in Roses Erinnerung war die Verkleidung wieder aus rotbraunem Holz, abgesetzt mit barocken Schnitzereien, die mit Blattgold belegt waren. Ihr Geist tauchte wieder ab in die zermalmende Tiefe von Davy Jones’ Locker …
***
… und zum Abend des 14. April1912.
Ein Feuer brannte im Kamin, die Griffe des Kamingeschirrs daneben glänzten neu in blankem Messing. Auf dem Sims standen zwei Porzellanvasen, verziert mit verspielten Nippesfiguren und barock geschwungenem Goldrand, darin schöne Blumenarrangements aus blassrosa und roten Rosen und dunkelgelben Gladiolen. Die Uhr, die in der Mitte vor dem Spiegel stand, zeigte kurz vor halb neun am Abend.
Im Spiegel über dem Kamin wurde die Tür zum Korridor reflektiert, die von außen geöffnet wurde. Heiter lachend schloss Rose auf und trat mit Jack in die Suite ein.
„Glaub’ mir: Es ist angebracht. Keine Angst“, beruhigte sie ihn, dem in diesem Teil der Titanic nicht recht wohl in seiner Haut war, nachdem man ihn am Morgen recht ruppig darauf hingewiesen hatte, wo sein Platz auf diesem Schiff war.
„Das hier ist das Wohnzimmer“, erklärte sie, als Jack eintrat und mit ungläubigem Staunen zum Kamin durchging. War das wirklich das gleiche Schiff, auf dem er auch fuhr oder hatte er auf dem Weg vom Bug zum B-Deck irgendwie die Dimension gewechselt und war im Märchenschloss gelandet? Völlig entrückt betrachtete er eine üppige Ausstattung, die er bestenfalls in seinen Träumen gesehen hatte …
„Ist das Licht ausreichend?“, fragte Rose mit leichter Besorgnis. Die Lampen gaben warmes Licht, aber sie waren eigentlich nicht als Beleuchtung für ein Künstleratelier gedacht …
Jack kam wie aus weiter Ferne zurück. Cinderellas Ausflug ins Schloss des Prinzen war ja nichts dagegen, wenn das hier real war!
„Was?“, fragte er.
„Künstler brauchen doch gutes Licht“, präzisierte sie ihre Frage. Er kam wieder in der Gegenwart des Jahres 1912 an und gewann Boden unter den Füßen, strich mit einem Finger über den Kaminsims.
„So ist es. Isch bin es nischt gewohnt, unter solsch ‘orriblen Bädingungän su arbaiten …“, erwiderte er mit schwerem französischem Akzent, der Rose zum Lachen reizte. Dann wurde sein Blick wie magisch von einem Bild angezogen.
„Ein Monet!“, entfuhr es ihm. Er stürzte zu dem an die Zimmerwand gelehnten, ungerahmten Bild des französischen Meistermalers.
„Kennst du seine Bilder?“, fragte sie.
„Selbstverständlich“, sagte er und kniete vor dem Bild nieder. Es zeigte eine Wasserfläche, auf der Seerosen in unterschiedlichen, sehr realistischen Blühstadien schwammen, im Wasser spiegelten sich graue Wolken und blaue Himmelsfetzen. Das Bild gehörte zu den berühmten Seerosenbildern des Meisters, die er in seinem Haus in Giverny gemalt hatte, wo sich tatsächlich ein solcher Seerosenteich befand. Claude Monet hatte immer wieder Seerosenmotive gemalt; eine ganze Serie war entstanden, die allerdings nicht die Zufriedenheit dessen gefunden hatte, der sie geschaffen hatte.
„Sieh doch nur mal, wie er die Farben einsetzt!“, schwärmte Jack. „Ist das nicht großartig? Ich habe ihn einmal gesehen – durch ein Loch im Gartenzaun in Giverny.“
Jack Dawson hatte sich den amerikanischen Künstlern angeschlossen, die nach Giverny gepilgert waren, um dort zu malen, wo ihr großes Vorbild Monet seine Kunstwerke schuf. Der Meister hatte engen Kontakt abgelehnt, doch die kunstbeflissenen Amerikaner hatte es offensichtlich nicht gehindert ab und zu durch den Zaun zu spähen …
„Ja, das ist außergewöhnlich“, stimmte Rose Jacks Einschätzung zu. Es waren knappe Pinselstriche, aus denen die einzelnen Elemente des Bildes bestanden, die in gewisser Entfernung aber im Auge des Betrachters unzweifelhaft zu Seerosen, Blättern, gespiegeltem Himmel und Wolken wurden. Impressionistische Bilder wie dieses wurden eben erst im Gehirn des Betrachters zu dem zusammengebaut, was er darin sah. Eine Kunst, die buchstäblich Eindruck machte, schließlich bedeutete Impression genau das …
Rose ging ins Ankleidezimmer und öffnete den Safe, während Jack sich endlich von dem Monet losreißen konnte.
„Cal muss dieses grässliche Ding immer überall mit hinschleppen“, kommentierte sie die Anwesenheit des grünen Sicherheitsschranks aus purem Stahl. Jack ging vorsichtig weiter, peilte in jede der vielen Türen, um sicher zu sein, nicht plötzlich auf die ungebetene Anwesenheit des eigentlichen Mieters dieser Suite zu stoßen. Er kam sich vor wie ein Einbrecher …
„Müsste der nicht jeden Augenblick hier auftauchen?“, fragte er besorgt.
„Nicht, solange noch genug Brandy und Zigarren da sind“, beruhigte sie Jack und kam zurück ins Wohnzimmer, in den Händen das Collier, das Cal ihr nach ihrem Nervenzusammenbruch geschenkt hatte. Die kostbare Kette entlockte dem jungen Mann einen anerkennenden Pfiff.
„Das ist sehr schön“, sagte er, als er sie vorsichtig aus ihrer Hand nahm und den großen herzförmigen Stein näher in Augenschein nahm. „Was ist das? Ein Saphir?“, erkundigte er sich. So einen Klunker hatte er seinen Lebtag noch nie zu Gesicht bekommen – nicht mal bei Madame Bijoux –, geschweige denn in der Hand gehalten.
„Ein Diamant“, sagte Rose leise. „Ein äußerst seltener Diamant, genannt das Herz des Ozeans.“
Wieder blieb Jacks Blick an dem Stück hängen, das jenseits seiner Vorstellungskraft in Sachen Wohlstand war.
„Jack, ich möchte, dass du mich so zeichnest wie die Mädchen in Frankreich … wenn ich das trage“, sagte sie. Er nickte abwesend, völlig gefesselt von der Schönheit des Edelsteins.
„In Ordnung“, sagte er und untersuchte intensiv das unglaubliche Blau des Steins.
„Wenn ich nur das trage …“, hauchte Rose in sein Ohr. Jack wandte sich ihr zu, glaubte, nicht richtig gehört zu haben.
Doch Rose meinte, was sie sagte. Sie verschwand in ihrem Schlafzimmer, um sich umzuziehen. Jack betätigte sich in der Zwischenzeit als Möbelpacker, stellte die Couch im Wohnzimmer so hin, dass das Licht die Sitzfläche für ihn optimal beleuchtete, drapierte Kissen so, dass sein Modell zur besten Geltung kam. Dann setzte er sich in den Sessel am Kamin, der Couch gegenüber und packte sein Zeichenwerkzeug aus. Er entrollte das Bündel, in dem Stifte, Kohle und ein Messer wie chirurgische Instrumente steckten – und genauso sorgsam behandelte er sein Werkzeug auch. Mit dem Messer spitzte er den Kohlestift an, um die beste Dimension der Spitze für die Zeichnung zu haben.
Inzwischen entledigte Rose sich ihres Kleides**, löste den Hornkamm mit dem Jade-Schmetterling, schüttelte ihr Haar aus, dass es lose über ihre Schultern fiel und warf stattdessen einen hauchdünnen Seidenkimono über, der mit heruntergelassenen Armen wie ein Kokon wirkte, bei ausgebreiteten Armen aber die Flügel eines Schmetterlings repräsentierte. Er bestand aus fast durchsichtigem schwarzem Seidenchiffon, der an den Ärmeln mit Arabesken aus goldfarbenen Pailletten und ebensolchen Perlen bestickt war. Die Arabesken waren so groß, dass sie von der Schulter bis zum Ärmelsaum reichten. Mit zusammengefalteten „Flügeln“ war deshalb praktisch der ganze Arm in goldene Stickereien gehüllt. Es war ein Kleidungsstück, das auch zu einer orientalischen Prinzessin gepasst hätte. Mit kräftigen, etwa handbreiten Seidenstreifen, die am Ansatz schwarz waren und zum losen Ende hin wie eine Art dunkler Regenbogen über Violett und Rot in flammendes Orange übergingen und in schwarzen Quasten endeten, konnte der Seidenmantel verschlossen werden.
Als sie damit bekleidet ins Wohnzimmer der Suite zurückkehrte, hielt sie den Kimono über der Brust mit der linken Hand zu, darüber glitzerten die weißen Diamanten der Kette und der Umrandung des blauen Herzdiamanten im warmen Licht der Lampen. In der rechten Hand schwang sie die rechte Hälfte des Gürtels verführerisch wie eine der Varietétänzerinnen in Paris und trat mit koketter Bewegung auf Jack zu, dem schon diese Erscheinung die Sprache verschlug.
„Das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist noch ein Bild, auf dem ich aussehe wie eine Porzellanpuppe“, sagte sie und gab ihm eine 10-Cent-Münze. „Als zahlende Kundin … kann ich wohl erwarten, das zu bekommen, was ich will“, setzte sie hinzu und öffnete den Kimono, um sich Jack so zu präsentieren, wie Gott sie geschaffen hatte – von dem Diamantcollier abgesehen …
Der junge Mann schluckte heftig und konnte kaum glauben, was er an makelloser Schönheit zu sehen bekam. Der Kimono sank zu Boden. Verliebt, wie Jack war, war ihre strahlende Nacktheit geeignet, ihn auf gänzlich andere Gedanken kommen zu lassen, als sie jetzt zu zeichnen. Ihr Anblick raubte ihm schlicht den Atem. Er brauchte einige Sekunden, um wieder Luft zu bekommen und seine Gedanken auf die bestellte Zeichnung zu konzentrieren.
„Geh … äh, zum Bett …“, stammelte er wie unter Schock. „Zur Couch …“, berichtigte er sich und hatte das Gefühl, dass er gerade die Farbe reifer Tomaten annahm, so sehr schämte er sich für seine verknotete Zunge und seine Gedanken an das, was er jetzt am liebsten mit ihr machen würde. Sie ließ sich katzengleich nieder, er setzte sich im Sessel zurecht, um ordentlich zeichnen zu können.
„Gut so … leg dich hin“, sagt er und dirigierte sie auf die Couch. Rose legte sich hin, wandte sich ihm zu, probierte möglichst bequeme, aber auch für Jack als Zeichner passable Lagen aus – den linken Arm über dem Kopf, auf der Couchlehne …
„Sag mir, wenn ich richtig liege“, sagte sie. Er wies auf ihren linken Arm.
„Den Arm genau dahin, wo er eben war“, sagte er. Sie nahm ihn wieder über den Kopf. „Genau so …“, bestätigte er. „Nimm den andern Arm nach oben, leg deine Hand neben dein Gesicht. So ist gut. So, und jetzt … das Gesicht runter. Die Augen zu mir. Sieh mich an. Und versuch, dich nicht zu bewegen.“
Er atmete nochmals tief durch, dann gelang es ihm endlich, sich auf die Striche mit dem Kohlestift zu konzentrieren und sie so genau wie möglich abzubilden.
Er begann mit der Kontur des linken Armes, skizzierte dann die Finger der linken Hand.
„Och, so ernst …!“, spottete sie leise, als sie seine vor Konzentration geradezu verkniffenen Gesichtszüge bemerkte. Er musste lächeln, zeichnete ihren Kopf leicht vor.
„Ich glaube, Sie werden rot, großer Künstler“, neckte sie ihn weiter. Er zeichnete ihre Augen, die Augenbrauen, Nase und Mund vor, um die Konturen dann zu verstärken. Immer wieder sah er zu ihr hinüber. Über dem Rand der Skizzenmappe waren für Rose dann nur seine Augen zu sehen. Blaugrüne Augen, die sie musterten, als wollten sie ihre Seele finden. Es war ein Anblick, den sie nie vergessen würde.
Das Gesicht auf dem Papier nahm weitere Form an, Jack skizzierte Kette und Diamanten vor, füllte die Kontur mit geschicktem Schattenwurf.
„Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Monsieur Monet rot werden würde“, fuhr sie fort, um wieder dieses sanfte Lächeln hervorzuzaubern, das sie so faszinierte.
„Das liegt daran, dass er Landschaften malt“, entgegnete er. „Entspann dein Gesicht“, mahnte er sanft.
„Entschuldige …“, erwiderte sie und gab sich alle Mühe, nicht nur den Körper, sondern auch das Gesicht ruhig zu halten.
Die Zeichnung wurde immer vollständiger, er verwischte die scharfen Striche des Kohlestifts zu weichen Schattierungen. Die Konturen des Busens behandelte er mit besonderer Sanftheit, ganz so, als berühre er zärtlich das Original dort drüben auf der Couch.
***
Roses detaillierte Erzählung von der Entstehung des Porträts, das sie alle in diesem Raum zusammengebracht hatte, ließ ihre Zuhörer andächtig und berührt schweigen. Die alte Dame kam wieder ins Jahr 1996 zurück. Ein schelmisches Lächeln umspielte ihre Mundwinkel. Das junge Gemüse auf Stühlen und Tischen hatte sie richtig im Griff. Sie lachte leise.
„Das war wohl der erotischste Moment in meinem Leben – jedenfalls bis dahin“, sagte sie.
„Und was passierte dann?“, fragte Lewis mit nicht zu überhörender Aufregung.
„Sie meinen, ob wir … es … getan haben?“, las sie Bodines Gedanken. Aber nicht nur Lewis kicherte ertappt, alle anderen auch.
„Es tut mir Leid, Sie enttäuschen zu müssen, Mr. Bodine. Jack war äußerst professionell“, gab sie die Antwort gleich dazu.
***
Das Porträt war fertig, Jack zeigte es Rose, nachdem sie sich den Kimono wieder übergezogen hatte. Fasziniert starrte sie auf die Zeichnung, die sie perfekt abbildete. Doch nicht nur das. Jack hatte geradezu ihre Seele gesucht, durchschaut und auf das Papier bekommen. Die Augen der Zeichnung strahlten ihren ganzen Lebenshunger und ihre Energie aus, die Jack – gefördert durch das weiche Licht und die wohlige Wärme des Kamins – bei ihr gesehen hatte.
„Datiere es, Jack. Ich möchte immer an diesen Abend denken“, bat sie. Er tat es und notierte April 14 1912 in einem für die Zeichnung nicht genutzten Fleck am unteren Rand des Blattes und setzte seine Initialen JD dazu.
Er blies die letzten überschüssigen Kohlereste fort, gab ihr die fertige und datierte Zeichnung samt dem ledergebundenen Skizzenbuch.
„Danke sehr“, sagte sie und küsste ihn, kaum weniger intensiv als kurz nach Sonnenuntergang am Bug.
Rose schrieb eine Nachricht auf dem Briefpapier mit dem Kopf der Reederei, das in den Kabinen der Ersten Klasse zur Ausstattung gehörte.
„Was machst du da?“ fragte er interessiert. Sie ging nicht darauf ein, gab ihm vielmehr die Kassette, in der das Diamantcollier war.
„Würdest du das für mich wieder in den Safe legen?“, bat sie. Er brummte zustimmend und brachte die Kassette ins Ankleidezimmer zurück, wo der offene Safe war. Er stellte das Kästchen an der Seite hinein und bemerkte dann, dass im Inneren des Stahlschranks vier Geldbündel aus großen Scheinen lagen. Das Bargeld entlockte Jack einen ungläubigen Pfiff …
Kapitel 16
Katz und Maus
Im Rauchsalon saß Caledon Hockley mit Colonel Archibald Gracie und Lord Duff Gordon an einem der Tische, als Lovejoy hereinkam und zu Hockley ging. Cal erhob sich.
„Würden Sie mich entschuldigen?“, bat er seine Gesprächspartner um Nachsicht für die Unterbrechung.
„Selbstverständlich“, entließ Gracie ihn. Er zog sich mit Lovejoy aus der Hörweite der beiden anderen an die dunkel getäfelte Wand zurück, die mit einem Rankenmuster aus cremefarbenen Intarsien geschmückt war. In dem Mosaikfenster daneben wiederholte sich das Muster der Intarsienarbeiten bis auf einen runden Ausschnitt, der den Blick aus einem Bullauge auf ein Schiff imitierte.
„Keiner der Stewards hat sie gesehen“, sagte Lovejoy, als er sicher war, dass niemand das Gespräch verfolgen würde.
„Das ist absurd!“, ereiferte sich Hockley. „Das hier ist ein Schiff! Es gibt nicht sehr viele Orte, wo sie sein kann!“ Mit einem gereizten Seufzen setzte er hinzu: „Lovejoy: Finden Sie sie!“
Die Titanic glitt durch den spiegelglatten Atlantik, auf dem das Licht der unzähligen Sterne so perfekt reflektiert wurde, dass der Himmel nicht mehr vom Horizont zu unterscheiden war.
Auf der Brücke war es dunkel. Der Rudergänger stand im hinteren Teil der Brücke, der Fünfte Offizier Lowe schaltete das Licht im Kompass ein, um nachzuschauen, ob der Kurs noch stimmte. Der Zweite Offizier Lightoller kam von der Backbordseite in das vordere Steuerhaus und gesellte sich zu Captain Smith, der zwischen den beiden Maschinentelegrafen vor dem unbesetzten Steuerrad am Fenster stand. Smith bemerkte die Anwesenheit eines weiteren Mannes.
„Klare Sicht“, sagte er.
„Ja“, bestätigte Lightoller. „Ich kann mich nicht erinnern, je eine so ruhige See gesehen zu haben.“
„Wie ein Dorfteich“, stimmte Smith seinem Zweiten Offizier zu. „Es weht kein Lüftchen.“
„Es wird schwierig sein, Eisberge zu erkennen, wenn sich keine Wellen an ihnen brechen“, warnte Lightoller. Smith brummte zustimmend und rührte in seiner Teetasse, drückte die darin befindliche Zitronenscheibe mit dem Löffel aus.
„Ich ziehe mich zurück“, sagte er. „Halten Sie Kurs und Geschwindigkeit, Mr. Lightoller!“, wies er seinen Zweiten Offizier an, was bei Lightoller das Gefühl hinterließ, seine Warnung sei am Captain schlichtweg abgeprallt.
„Ja, Sir!“, bestätigte er mit unterdrücktem Seufzen und ungutem Gefühl in der Magengrube die Anweisung.
„Und wecken Sie mich selbstverständlich, falls irgendetwas auch nur den leisesten Anlass zum Zweifeln gibt“, setzte der Captain hinzu und verließ die Brücke, einen nun doch erleichterten Zweiten Offizier zurücklassend.
Ein Deck tiefer stand Jack am Fenster des zur Suite gehörenden privaten Promenadendecks. Er hatte es heruntergezogen und ließ sich die kalte Nachtluft um die Nase wehen, während Rose sich wieder anzog. Er hatte die Hoffnung, dass die Kälte hatte die schon fast nicht mehr zu beherrschende Erregung vertreiben würde, die der Anblick von Roses unbekleidetem Körper in ihm ausgelöst hatte. Jetzt allerdings wurde die eisige Kälte der nordatlantischen Nachtluft langsam schmerzhaft; Jack froren fast die Finger ein, obwohl er sich den am Nachmittag unerlaubt geborgten Mantel übergezogen hatte. Er zog sich vom Fenster zurück, schüttelte sich fröstelnd und hauchte seine froststarren Finger an, damit sie langsam wieder auftauten.
Als er in das Wohnzimmer trat, kam Rose aus dem Ankleidezimmer.
„Es wird kalt“, sagte Jack und sah sie an. Statt des blauen Samtkostüms trug sie jetzt ein leichtes, weißes, ärmelloses Chiffonkleid, das über dem Busenansatz mit zarter Spitze besetzt war. Über das Kleid hatte sie einen zarten, hellgrauen, bodenlangen, vorn offenen Kaftan aus fast durchsichtigem Chiffon mit kurzen Ärmeln gezogen, der nach unten fließend in ein zartes Lila überging. Unter dem Busen hielt ein zartrosa Gürtel den Kaftan an Ort und Stelle. Es war eine weich fließende Robe, die sie noch engelhafter machte, als sie nach Jacks Meinung ohnehin schon war. Seine Absicht, sich in der aprilfrischen Nachtluft abzukühlen war von diesem zauberhaften Anblick prompt zunichte gemacht. Erneut wallte es in ihm auf. Er beglückwünschte sich, im Moment noch durchgefroren zu sein. Wäre ihm jetzt so warm gewesen wie vorhin, als er sie gezeichnet hatte, hätte er ob dieses Anblicks für nichts mehr garantieren können …
„Du siehst hübsch aus“, bemerkte er und stellte fest, dass diese Bemerkung eine grobe Untertreibung war. So, wie sie jetzt vor ihm stand, machte sie Aphrodite, der griechischen Göttin der Schönheit, ernsthafte Konkurrenz. Doch bevor er sich ihr gegenüber korrigieren konnte, klopfte es an der Tür.
„Miss Rose?“, drang eine männliche Stimme herein – unverkennbar Spicer Lovejoy, wie Rose augenblicklich klar wurde. Sie reagierte sofort, griff Jacks Hand und zog ihn durch Cals Schlafzimmer, von dem das Ankleidezimmer abging, durch ihr eigenes Schlafzimmer zum zweiten Ausgang der Suite. In Cals Schlafzimmer stockte er.
„Meine Zeichnungen!“, entfuhr es ihm, er wollte wieder zurück, aber Rose zog ihn unnachgiebig weiter.
„Komm, Jack!“, feuerte sie ihn an.
Lovejoy betrat das Wohnzimmer der Doppelsuite und sah sich suchend um. Er wollte schon nach der Verlobten seines Arbeitgebers rufen, als das Geräusch einer klappenden Tür ihn aufmerksam machte. Lovejoy griff in sein Jackett nach der Schusswaffe, die er in einem Schulterhalfter trug, zog die Waffe aber noch nicht, sondern folgte zunächst dem Geräusch, das ihn an einen Einbrecher glauben ließ.
Rose und Jack spazierten durch den Gang in Richtung des großen Treppenhauses, als sie ihrerseits durch ein Türgeräusch alarmiert wurden. Sie sahen sich um und bemerkten Lovejoy, der aus der Tür spähte. Er sah sie und folgte ihnen mit eiligen Schritten. Rose und Jack beschleunigten mit einem Grinsen im Gesicht und rannten kichernd den Gang weiter, an der Treppe vorbei zu den Fahrstühlen.
Aus einem der Aufzüge trat ein elegant gekleidetes Pärchen, von einem Steward mit einer Verbeugung begrüßt. Rose schaltete zuerst.
„Warten Sie!“, rief sie im Rennen, um die Abfahrt des von einem weiteren Steward bedienten Fahrstuhls zu verhindern. „Warten Sie! Warten Sie!“
„Moment!“, rief nun auch Jack. „Moment! Moment!“
Sie bekamen gerade noch die Kurve, rannten den außen am Aufzug stehenden Steward und die eben ausgestiegenen Passagiere beinahe um. Lovejoy hetzte hinter ihnen her.
„Fahren Sie runter! Schnell!“, wies Rose den Fahrstuhlführer an. „Schnell! Schnell!“
„Runter!“, kommandierte Jack atemlos. „Runter! Runter! Los!“
Noch verwirrt über die rasch wechselnden Anweisungen der Passagiere, drückte der Steward den Knopf zur Abwärtsfahrt. Sein Kollege schloss gerade noch die Tür, bevor Lovejoy heran war. Der Fahrstuhl fuhr nach unten, Lovejoy krachte in die geschlossene Gittertür und sah die Verlobte seines Arbeitgebers mit dem Zwischendeckpassagier abwärts fahren. Wenn sein Blick hätte töten können, wäre mindestens Jack todwund zu Boden gegangen …
Rose und Jack kicherten hämisch, Rose zeigte dem älteren Kammerdiener höchst undamenhaft mit der rechten Hand den Stinkefinger, was Jack fast zu lautem Gelächter amüsierte.
„Tschühüß“, kicherte sie, winkte spöttisch und mit keckem Blick, während der Kammerdiener aus ihrem Blickfeld verschwand.
Doch so einfach ließ Spicer Lovejoy sich nicht abhängen. Er eilte mit ebenso grimmiger wie versteinerter Miene zur Treppe und rannte die Stufen so schnell hinunter, wie es ihm in seinem etwas fortgeschrittenen Alter – er mochte Mitte fünfzig sein – möglich war. In jedem Deck sah er nach dem hinteren Aufzug, mit dem die Flüchtigen gefahren waren.
Jack und Rose erreichten lachend das E-Deck. Jack stolperte hinaus und riss beinahe einen Steward um, der gerade am Aufzug vorbeikam.
„Tschuldigung!“, rief Jack und konnte sich vor Lachen kaum auf den Beinen halten. Die Stewards, die die beiden verstört ansahen, mochten denken, dass sie deutlich mehr als einmal zu viel die Luft aus dem Bierglas oder dem Cognacschwenker gelassen hatten. Lachend rannten sie weiter zur nächsten Treppe und verschwanden in Richtung F-Deck.
Sie waren kaum nach unten fort, als Lovejoy im E-Deck an den Aufzügen erschien. Ein knapper Blick zur Seite überzeugte ihn, dass die Flüchtenden bis hierher gefahren waren. Er sah sich um, um den weiteren vermutlichen Weg zu entdecken.
Jack stolperte die Treppe hinab, wäre beinahe hingefallen und konnte sich gerade noch an einem voll beladenen Servierwagen festhalten, den ein Steward gerade aus der Küche in den Gang schob. Beim Umdrehen räumte Jack den Wagen halb ab, brachte die oberste Cloche** zum Absturz.
„Tschuldigung, Kumpel!“, japste er und rannte hinter der lachenden Rose her, die durch eine Doppelschwingtür fegte, in der in Augenhöhe zwei runde Fenster angebracht waren. In dem Gang dahinter hielt sie keuchend an, Jack sprang ebenfalls durch die Tür und hielt sich ebenfalls japsend an der stählernen Ecke fest.
„Für ’n Kammerdiener ‘n ziemlich zäher Bursche. Kommt mir eher vor wie ’n Polizist“, hechelte er.
„War er früher auch mal“, bestätigte Rose lachend und keuchend. „Cals Vater hat ihn engagiert, um Cal vor Schwierigkeiten zu bewahren … um sicherzustellen, dass er immer wieder samt Geld und Gut in sein Hotel kommt, nachdem er einige Male in den weniger passablen Ecken der Stadt Ärger hatte.“
„So, wie wir jetzt, was?“, lachte Jack
Einen Moment wähnten sie sich in vorläufiger Sicherheit, aber dann tauchte Spürhund Lovejoy vor den Bullaugen der Schwingtür auf. Der Lärm von Jacks Kollision mit dem Servierwagen hatte ihn wieder auf die Spur gebracht. Er sah sich um, bemerkte die Schwingtür und stürzte darauf zu.
„Scheiße!“, entfuhr es Jack drastisch.
„Lauf!“, rief Rose. Sie rannten weiter bis zur nächsten Ecke, wo ein Mann aus seiner Kajüte kam, um auf dem Gang zu rauchen. Jack rannte ihn fast um.
„Tschuldigung!“, schrie er im Weiterrennen. Sie flitzten nach links um die Ecke, nur um festzustellen, dass sie in eine Sackgasse geraten waren. Hinter ihnen dröhnten schon Lovejoys eilige Schritte. In letzter Sekunde bemerkte Jack eine Tür, die von der Ecke aus gesehen gleich links in der Sackgasse war.
„Hier lang!“, rief er, war mit einem Satz an der Tür und öffnete sie. Rose und er schlüpften hinein, Jack schloss die Tür und drehte den Türknopf zu, womit die Tür von innen verschlossen war. Lovejoy, der ihnen nachgesetzt war, krachte gegen die geschlossene Tür und kam auf diesem Weg zunächst nicht weiter.
In dem Raum, in dem sie gelandet waren, herrschte ein Höllenlärm. Rose hielt sich die Ohren zu.
„Und was jetzt?“, brüllte sie. Jack hielt sich ebenfalls die Ohren zu und verstand sie nicht.
„Was?“, brüllte er und sah sich um. Der Raum hatte nur die Tür, vor der Lovejoy vermutlich wie ein Wachhund darauf wartete, dass sie wieder herauskamen. Fast im selben Moment bemerkte Jack aber ein Loch im Boden, das an einer Seite von der Schottwand begrenzt wurde, zwei Seiten waren mit einem Geländer gesichert. Es war ein schmaler Niedergang, aus dem es rötlich in das höhere Deck leuchtete. Dampf und Kohlestaub wallten aus dem Loch nach oben; es wirkte wie der Eingang zur Hölle.
Jack peilte hinunter. Unter ihnen war offenbar einer der Kesselräume der Titanic. Ohne lange zu überlegen, stieg Jack die Leiter hinunter, Rose folgte ihm. Er fing sie am Ende der Leiter auf. Ja, es war einer der Kesselräume, der Kesselraum Nummer 6.
„Legt euch mal ‘n bisschen ins Zeug!“, rief einer der Männer in ihrer Nähe.
„Mehr Kohle für Nummer eins, Kumpel!“, brüllte ein anderer.
Für einige Momente standen die jungen Leute und sahen sich staunend um. Der Kesselraum wirkte wie eine höllische Kathedrale, ebenso hoch, aber von den Feuern der gewaltigen Kessel gespenstisch rot beleuchtet – und auch so heiß wie die Hölle. Die Männer hier unten waren schwarz vom Kohlenstaub, sie trugen zu normalen Hosen nur Unterhemden, die nass vom Schweiß waren.
„Moment mal! Was wollt ihr beide denn hier unten?“, fuhr der Chefheizer Barret sie an. „Ihr habt hier nichts verloren! Das ist gefährlich hier!“, brüllte er.
Jack nahm Rose an der Hand, nachdem er sich kurz orientiert hatte und hetzte mit ihr weiter nach vorn. Sie sprinteten durch den Kesselraum, wobei es ihnen wie durch ein Wunder gelang, weder einen der Heizer umzurennen, noch über eine Schaufel zu stolpern oder auf dem Kohlenstaub auszurutschen. Die Heizer sahen sie an, als wären sie Elfen, die sich in ein Bergwerk der Zwerge verirrt hatten.
„Weitermachen!“, rief Jack ihnen fröhlich zu. „Kümmert euch nicht um uns! Ihr leistet prima Arbeit! Macht weiter so!“
Während Jack und Rose auf der Flucht von Lovejoy eher zufällig die Tiefen der Titanic erforschten, saß Caledon Hockley immer noch bei Colonel Gracie und Lord Duff Gordon im Rauchsalon, wo sie inzwischen ein Kartenspiel aufgenommen hatten. Dennoch war Gracie eher zu weiterer Unterhaltung geneigt, als sich um seine Karten zu kümmern.
„Wir fahren höllisch schnell, das kann ich Ihnen sagen. Ich wette fünfzig Dollar, dass wir es bis Dienstagabend nach New York rein schaffen werden“, orakelte er. Cal hörte ihm nicht zu, zog seine goldene Uhr aus der Tasche und starrte finster auf das Ziffernblatt.
Tief unten im Schiff öffnete Jack Dawson die nächste Tür und sah staunend in den dahinter liegenden Laderaum. Kisten über Kisten waren übermannshoch gestapelt, die Stapel mit Netzen gesichert, damit sie nicht auseinanderfielen, wenn das Schiff in schwere See geriet und dann stark rollte oder stampfte. Nach der Hitze der Kesselräume, die sie durchrannt hatten, war es hier regelrecht kalt. Die Laderäume waren unbeheizt. Hier herrschte praktisch die gleiche Temperatur wie oben an Deck, ausgenommen ein eher schmaler Streifen, der nah an den Kesselräumen lag und von dort noch etwas Wärme erhielt. Jack zuckte über die Kühle zusammen, obwohl er noch einen Mantel trug, aber Rose, deren Kleid nur dünn und obendrein kurzärmelig war, fröstelte richtig. Jack zog sie sanft vorwärts, sah durch eine Lücke in den Kistenstapeln ein Automobil.
„Ah … Sieh mal, was wir hier haben“, sagte er und beschleunigte seinen Schritt, Rose an der Hand hinter sich herziehend. Sie gingen zu dem Fahrzeug hin. Es war der ebenso nagelneue wie wunderschöne dunkelrote Renault Tournee von William Carter mit dem Liechtensteiner Kennzeichen, auf der Transportpalette angelascht, auf der er in Southampton an Bord gehievt worden war. Das warme Burgunderrot der Karosserie wurde von den in Messing gefassten Scheinwerfern, den aus poliertem Messing bestehenden breiten Zierleisten der Motorhaube und den strahlend weißen Gummireifen auf massiven, dunkelrot lackierten Felgen noch unterstrichen. Die stählernen Felgen sahen immer noch so aus wie die hölzernen Wagenräder des vergangenen Jahrhunderts. Zusammen mit dem schwarzen, geschlossenen Oberteil der Karosserie mit den großen Fenstern und dem offenen, lediglich überdachten Fahrersitz wirkte das Automobil immer noch wie eine Pferdekutsche – wie eine königliche Pferdekutsche.
Während Jack noch bewundernd die Einzelheiten im Cockpit bewunderte, stellte Rose sich neben die Tür und räusperte sich gespielt vernehmlich, als wollte eine königliche Prinzessin ihren Diener auf seine Pflichten hinweisen. Jack kam aus dem Fahrerteil hoch, verstand und ging grinsend um Rose herum, öffnete ihr mit ebenso gespielt diensteifrigem Räuspern die Tür, reichte ihr wie ein professioneller Chauffeur die Hand, um ihr in den Fond des Wagens zu helfen. Rose nahm seine Hand mit der Geste einer Königin, raffte den Rock und stieg ein, ließ sich mit einem gespielt hoheitsvollem Lächeln in den plüschbezogenen Rücksitz sinken. Ihr Blick fiel auf eine Kristallvase, die oben in der rechten hinteren Ecke der Karosserie angebracht war. Zwei rote Rosen steckten in der Vase und hatten das darin befindliche Wasser schon zur Hälfte aufgesogen.
Jack schloss die Tür und schwang sich hinter das Steuer auf den Fahrersitz. Mit hochgereckter Nase setzte er sich zurecht. Rose stand wieder auf und zog das Frontfenster des Fonds herunter.
„Wohin, Miss?“, fragte er im typischen Tonfall eines Chauffeurs. Rose beugte sich zum ihm heraus.
„Zu den Sternen“, flüsterte sie, packte ihn an den Armen und zog ihn vom Fahrersitz einfach in den Fond. Er plumpste direkt neben ihr in die Polster. Er saß kaum, als Rose ihn am Mantel packte und zu sich zog. Er legte ihr den linken Arm um die Schulter und zog sie ebenfalls zu sich, nahm ihre Hand. Ebenso unbewusst wie kurz nach Sonnenuntergang am Bug verschränkten sich ihre Hände, ihre Blicke versanken ineinander.
„Hast du Angst?“, fragte er nach einer Weile beredten Schweigens.
„Nein“, flüsterte sie und legte den Kopf an seine Schulter. Sie zog seine rechte Hand zu sich und küsste zärtlich die Kuppen seiner ebenso geschickten wie sanften und doch von harter Arbeit geprägten Künstlerfinger. Die sachte Berührung ihrer weichen, warmen Lippen ließ ihn seufzen. Wusste sie eigentlich, was sie da tat?
Sie wusste es; sie wusste es ganz genau.
„Berühre mich, Jack“, bat sie leise. Er sah sie noch ein wenig ungläubig an, glaubte erst, diese Worte nur zu träumen, doch sie führte seine Hand an ihre Brust. Diese weiblichste aller Rundungen an ihrem schlanken Körper hob sich der sanften Last entgegen und beseitigte jeglichen Zweifel bei Jack, dass er diese Einladung zu gemeinsamer Wonne nicht geträumt hatte. Nur wenige Stunden zuvor hatte er sein wachsendes Begehren nur knapp zügeln können. Dass es ihr nicht anders ging, bewies sie ihm jetzt mehr als nur überzeugend. Sie wollte ihn, er wollte sie – und sie nutzten das gegenseitige Einverständnis. Ein langer, unglaublich zärtlicher Kuss eröffnete eine körperliche Begegnung von ungeahnter Leidenschaft und Wonne, eröffnete Momente, die sie bis an ihr Lebensende nie vergessen sollten. Die Kälte des Laderaums war vergessen, als die Leidenschaft zweier junger Menschen das Wageninnere erhitzte.
Kapitel 17
Eisberg voraus!
Einige Decks über den Laderäumen arbeiteten die Funker Jack Phillips und Harold Bride im Funkraum wie besessen an den zahlreichen Funksprüchen, die ihnen die Reichen unter den Passagieren aufgaben. Die Luxuseinrichtung der Funkstation von Marconi wurde von den Wohlhabenden weidlichst genutzt – mit unglaublich unwichtigen und dummen Funksprüchen, die die Funker immer wieder zu spöttischen Bemerkungen reizten, sofern sie allein in der Funkkabine waren.
„Guck dir den hier an: Will, dass sein privater Zug ihn abholt. Lackaffe!“, bemerkte Bride bissig und klatschte das Telegrammformular mit der flachen Hand auf den Tisch. „Wir werden die ganze verdammte Nacht in dem Loch hier zubringen.“
Während er noch fluchte, fing Phillips eine eingehende Morsenachricht von dem in der Nähe befindlichen Frachter Californian auf, die seine abgehende Nachricht blockierte.
„Jesus! Was ist das für ein Idiot auf der Californian!“
Die Schiffe waren einander so nah, dass die Morsesignale ohrenbetäubend laut waren. Immer noch fluchend funkte Phillips einen saftigen Rüffel zurück.
Auf der Californian riss der dortige Funker Cyril Evans sich die Kopfhörer von den Ohren, als die Antwort von der Titanic ihn beinahe ertauben ließ. Er entschlüsselte den Funkspruch für den Dritten Offizier Groves der Californian:
„Dämlicher Bastard! Ich versuche, ihn vor Eis zu warnen und er sagt: Bleib aus der Leitung und halt die Klappe! Ich spreche gerade mit Cape Race!“
„Und? Was funkt er jetzt?“, fragte Groves.
„Keine Seekrankheit. Pokergeschäft gut. Al“, übersetzte Evans die Morsezeichen, die in seinen Ohren piepten. „Okay, das war’s für mich. Ich schalte jetzt ab“, sagte er und machte sein Funkgerät aus. Er verließ mit Groves die Funkkabine und trat an Deck. Der Blick der beiden Seeleute ging zu dem, was Evans zu seiner Funkwarnung veranlasst hatte: Die Californian hatte kaum fünfzig Yards vor dem Rand eines Packeisfeldes gestoppt. Packeis und Eisberge so weit das Auge in der Dunkelheit reichte …
Noch etwas weiter über dem Laderaum, sogar noch über dem höchsten Deck, befand sich das Krähennest, der Ausguck am Fockmast* der Titanic. Hier war die Kälte im eisigen Fahrtwind noch beißender als sonst wo auf dem Luxusliner. In diesem Mastkorb standen zähneklappernd die Matrosen Frederick Fleet und Reginald Lee. Beide hatten die Arme um sich geschlungen und schlugen in dem beengten Raum des Ausgucks immer wieder mit den Armen an den Körper, um sich warmzuhalten
„Verdammt, ist das kalt!“, fluchte Lee. Er hatte das Gefühl, dass man sein Zähneklappern bis unten auf das Deck hören konnte.
„Glaub’ mir: Ich kann Eis riechen, wenn ich nahe genug dran bin“, presste Fleet ebenso zitternd und klappernd hervor. Lee verzog zweifelnd das Gesicht.
„Blödsinn!“, wehrte er die prahlerische Behauptung ab.
„Ich kann das wirklich!“, beharrte Fleet.
Auf der Brücke kam der Erste Offizier Murdoch auf das Freideck. Die Kälte ließ ihn den Mantelkragen hochschlagen.
„Haben Sie die Ferngläser für das Krähennest noch gefunden?“, fragte er. Lightoller, der Zweite Offizier, schüttelte den Kopf.
„Die hab’ ich das letzte Mal in Southampton gesehen“, erwiderte er. „Also, ich mach’ dann mal meine Runde. Bis dann.“
Tief unten im Laderaum 2 wollte Rose sich ganz für Jack öffnen und den rechten Arm aus seinem Weg nehmen. In der Enge des Renault Tournee traf ihre Hand auf das in der hitzigen Leidenschaft und der Kälte des übrigen Laderaums völlig beschlagene Heckfenster, blieb einen Moment wie im Krampf daran hängen und rutschte dann herunter. Zurück blieb Roses Handabdruck und die Schleifspur in Richtung Rückbank.
Keuchend kamen die jungen Leute zur Ruhe. Mit dem Verglühen der Leidenschaft machte sich die Kälte rasch wieder bemerkbar, obwohl sie Jacks geborgten Mantel als Decke über sich gebreitet hatten. Jack japste so erschöpft, dass Rose sich ernsthafte Sorgen um ihren ebenso leidenschaftlichen wie zärtlichen Liebhaber machte.
„Du zitterst ja“, bemerkte sie und legte ihre Hand an sein Gesicht, ganz so, als wollte sie prüfen, ob er real oder doch nur eine Vision war. Er lächelte matt.
„Keine Angst. Mir geht’s gut“, erwiderte er. Sein schwerer Atem strafte seine Worte Lügen, aber sein zärtliches Lächeln zeugte davon, dass er die aufkommende Schwäche niederkämpfen wollte. Es war viel zu schön, Rose zu lieben, ihr alles zu schenken, was er zu geben vermochte, ihr aus freiem Willen und tiefstem Herzen gemachtes Geschenk anzunehmen, als dass er diese Momente geheimer Zweisamkeit mit Rose schon hergeben wollte. Sie zog ihn an sich, um ihre Wärme mit ihm zu teilen. Sie küssten sich zärtlich. Jack gab Roses sanftem Zug nach, bettete seinen Kopf auf ihrer Brust und schloss die Augen.
„Ich kann deinen Herzschlag hören“, flüsterte er in liebesseliger Ermattung.
Lovejoy hatte eingesehen, dass er allein nicht weiterkam und hatte zwei Stewards auf die Jagd nach Rose und Jack geschickt. Im Kesselraum 6 brachte Chefheizer Barrett sie auf die Spur der Flüchtigen:
„Sie sind da lang gelaufen“, brüllte er gegen den Lärm der Kessel an und wies zum Laderaum 2.
„Alles klar!“, bestätigte einer der Stewards. Die Männer, mit großen Handlampen bewaffnet, pirschten weiter, in jede Ecke leuchtend, um die Leute zu finden, die Lovejoy ihnen bezeichnet hatte.
Weit oben, im B-Deck, war inzwischen Caledon Hockley in seine Suite zurückgekehrt. Niemand war außer ihm und Lovejoy anwesend. Er ging zum Safe und öffnete ihn.
„Fehlt irgendetwas?“, fragte Lovejoy. Die Tür schwang auf. Hockley erkannte nicht, dass etwas fehlte. Im Gegenteil: Es war ein Teil mehr drin als zuvor: Eine Ledermappe, deren Herkunft ihm unbekannt war – und eine Notiz von Rose. Er las sie, zog die Stirn kraus und nahm die Mappe heraus, schlug sie auf und sah die Aktskizze seiner Verlobten, die nichts weiter am Körper hatte als das Diamantcollier. Eine Welle kalter Wut übermannte ihn. Er las die Nachricht nochmals, als konnte er nicht glauben, was er eben gesehen hatte.
„Jetzt kannst du uns beide in deinem Safe wegschließen. Rose“, las Cal die Notiz laut vor. Alles krampfte sich in ihm zusammen. Nichts bewies dies deutlicher als den Umstand, dass er die Nachricht in ohnmächtiger Wut zerknüllte und die Zeichnung mit beiden Händen packte, wie um sie zu zerreißen. Im letzten Moment beherrschte er sich. Nein, es gab noch eine andere Möglichkeit.
„Ich hab’ eine andere Idee“, sagte er. Sie war seiner Ansicht nach auch geeignet, Rose wieder zurückzugewinnen …
Unten im Laderaum kamen die Stewards auf der Jagd zu Carters Renault. Die Scheiben waren komplett beschlagen – bis auf einen Handabdruck in der Heckscheibe, der nach unten verwischt war. Der erste Steward bemerkte den überdeutlichen Hinweis, winkte seinem Kollegen und schnippte mit den Fingern, als der nicht sofort reagierte. Auf das Fingerschnippen sah der andere zum Wagen. Der Erste bedeute ihm schweigend, jetzt überraschend zuzuschlagen. Er ging um den Wagen herum, riss von der rechten Seite die Fondtür auf.
„Haben wir euch!“, grollte er. Er leuchtete auf den Rücksitz. Der Sitz war leer.
William Murdoch, der Erste Offizier, stand auf dem Außenbereich der Brücke und hielt Ausschau nach vorne, als auf dem Welldeck* Gelächter laut wurde. Die Tür zu den vorderen Frachträumen war offen, zwei junge Leute stolperten fröhlich lachend heraus. Es waren Rose DeWitt Bukater und Jack Dawson. Lächelnd wandte Murdoch sich ab, als die beiden an der mit Persenning* abgedeckten vorderen Ladeluke ankamen.
Beide konnten sich vor Lachen kaum noch halten.
„Hast du … die Gesichter von diesen Typen gesehen?“, kicherte Jack und meinte die beiden Stewards, die ihnen bis in den Frachtraum gefolgt waren. „Hast du das gesehen?“
Es dauerte einen Moment, bis sie sich einigermaßen beruhigt hatten. Rose ließ ihre Augen nicht von Jack, streichelte sanft über sein Gesicht. Er hatte ihr neues Selbstvertrauen gegeben, sie aus dem seidenen Kokon befreit, der sie nun endgültig als Gefängnis wahrgenommen hatte.
„Wenn das Schiff anlegt … werd’ ich mit dir von Bord gehen“, sagte sie schließlich.
„Das ist verrückt!“, widersprach Jack verblüfft, aber breit lächelnd.
„Ich weiß, das ist völlig verrückt“, räumte sie ein. „Deswegen will ich es ja auch.“
Sie küssten sich in wortlosem Einverständnis und mit derselben Leidenschaft, mit der sie sich auf dem Rücksitz des Renault geliebt hatten.
Das leise Gespräch entging den beiden Matrosen im Krähennest nicht. Frederick Fleet peilte mit breitem Grinsen hinunter.
„Oh, ja! Hey, sieh dir das an! Sieh dir das mal an!“, sagte er mit einem geradezu seligen Ausdruck im Gesicht. Reginald Lee lehnte sich auf die Steuerbordseite des Krähennestes hinüber, um an Fleets Seite hinuntersehen zu können.
„Denen ist ein bisschen wärmer als uns“, bemerkte er mit ebenso breitem Grinsen wie sein Kollege. Fleet sah sich um und bemerkte seinen Kameraden in gar zu kurzer Entfernung.
„Also, wenn das die einzige Möglichkeit ist, damit uns hier oben auch ein bisschen wärmer wird, dann verzichte ich lieber drauf“, versetzte er und schob Lee von sich weg. Beide peilten wieder nach vorn. Fleet bemerkte eine rasch näherkommende, undefinierbare Masse, als er seinen Blick wieder fokussiert hatte. Das war doch nicht etwa …? Ihm entgleisten geradezu die Gesichtszüge, als ihm klar wurde, was das da draußen war: ein Eisberg! Kaum fünfhundert Yards entfernt! Jegliche Farbe wich ihm aus dem Gesicht.
„Verfluchter Mist!“, entfuhr es ihm. Er griff zur Glocke, läutete dreimal und nahm dann das Telefon ab, das das Krähennest mit der Brücke verband. Das Klingeln des Fernsprechers hörte er bis in den Ausguck. Warum, verdammt nochmal, nahm da keiner ab?
Murdoch, der gerade nach hinten gesehen hatte, drehte sich beim Glockenton um und versuchte in der schwarzen Finsternis vor dem Bug etwas zu erkennen.
„Nehmt endlich ab, ihr Bastarde!“, grollte Fleet, während wertvolle Sekunden verstrichen.
Der Sechste Offizier Moody kam ohne sonderliche Eile mit einer Tasse Tee um die Ecke und klappte den Hörer hoch, schaltete die Sprechmuschel frei.
„Ist da jemand???“, dröhnte Fleets wütende Stimme aus dem Hörer.
„Ja“, bestätigte Moody. „Was sehen Sie?“
„Eisberg direkt voraus!!!“, brüllte Fleet ins Telefon.
„Danke sehr“, nahm Moody die Meldung entgegen und eilte, die Tasse noch in der Hand, zum Steuerbordaußenbereich der Brücke. Murdoch, der den Alarmruf draußen aus dem Krähennest gehört hatte, kam ihm schon entgegengerannt.
„Eisberg direkt voraus!“, meldete Moody.
„Hart Steuerbord!“, brüllte Murdoch, Moody wiederholte den Befehl. Der Rudergänger Hitchins drehte mit aller Macht das Steuerrad nach links, womit die seitenverkehrte Ruderstellung ausgelöst wurde. Murdoch sprang in die Brücke, riss beide Maschinentelegrafen auf STOP, dann auf VOLL ZURÜCK.
„Schneller! Schneller! Scharfdreh!“, befahl er dabei.
Im Maschinenraum rührte der Leitende Ingenieur Bell gerade in seiner Suppe, die er zum Aufwärmen auf eine der heißen Dampfleitungen gestellt hatte, als der Maschinentelegraf klingelte. Zu seinem blanken Entsetzen sahen Bell und seine weiteren Ingenieure, dass der Telegraf über STOP hinausging und erst bei VOLL ZURÜCK stehenblieb. Er sprang auf.
„Volle Kraft zurück!“, brüllte er.
Auf der Brücke hatte Hitchins das Steuerrad bis zum Anschlag auf Steuerbord gedreht.
„Ruder ist hart Steuerbord!“, meldete er.
„Ruder ist hart Steuerbord, Sir!“, gab Moody die Meldung an Murdoch weiter, der inzwischen wieder auf den Außenbereich der Brücke zurückgegangen war.
Im Maschinenraum rannten die Maschinisten und Heizer anscheinend wild durcheinander, tatsächlich fegte jeder auf seinen Posten.
„Los, Leute! Beeilt euch!“, feuerte einer der nachrangigen Ingenieure die Männer an. „Schneller! Schneller! Schneller!“
„Maschinen stopp!“, brüllte Bell. „Runter mit dem Dampf! Runter damit!“
Ingenieure und Schmierer hetzten an die Ventile und drehten sie eilig zu.
Im Kesselraum 6 scheuchte Chefheizer Barrett, der gerade mit dem Zweiten Ingenieur James Hesketh gesprochen hatte, seine Männer an die Öfen.
„Zu das Ding! Wird’s bald? Beeilung!“, brüllte er. Die Männer warfen die Kesselluken zu, zogen an Dampfregulatoren. Die Anzeigen der Manometer sanken kontinuierlich. Das rote Alarmlicht zeigte an, dass es sich um ein Notaus handelte. In der Maschinenhalle stampften die gewaltigen Pleuel der Antriebswellen allmählich langsamer. Chefingenieur Bell behielt in dem scheinbaren Chaos den Überblick.
„Wartet!“, rief er. Ein Umsteuern auf VOLL ZURÜCK war erst möglich, wenn die Maschinen standen. „Wartet!“
Die Geschwindigkeit der Pleuelbewegungen nahm weiter ab, gleichzeitig drehten die Schrauben langsamer, kamen schließlich zum Stillstand.
„Gut so … und … umsteuern!“, befahl er. Die Maschinisten legten die entsprechenden Hebel um, die Maschine kehrte die Bewegung um, wurde wieder schneller, die Schrauben wechselten die Drehrichtung, drehten nun rückwärts.
„Maschinen gehen rückwärts!“, meldete einer der Maschinisten an Bell.
Oben im Krähennest war von einem Wendemanöver noch nichts zu erkennen.
„Wieso drehen die denn nicht?“, fragte Fleet ebenso verzweifelt wie wütend, in der Annahme, dass sich unter ihm überhaupt nichts tat.
Murdoch ging es kaum besser. Nichts wies darauf hin, dass seine Befehle irgendwo angekommen waren.
„Ist Ruder hart Steuerbord?“, fragte er zweifelnd den Rudergänger.
„Jawohl, Sir, Steuerbord liegt an!“, bestätigte der Rudergänger die Ausführung des Befehls.
‚Verdammt, warum tut sich nichts?‘, durchzuckte es Murdoch. „Komm schon! Komm schon! Komm schon!“, flüsterte er, an das Schiff gewandt. „Dreh! Komm! Komm! Komm!“
„Los, Leute! Bewegung!“, brüllte Chefingenieur Bell tief unter der Brücke.
Ganz langsam begann der Bug sich nach links zu drehen, der Eisberg, nun klar erkennbar, wanderte allmählich nach rechts aus, kam aber weiter näher.
„Ja!!“, entfuhr es Murdoch mit vorsichtiger Erleichterung.
Ein Ausguck vorn am Bug sprang von der Reling herunter auf die Back, um einer überhängenden Eisspitze auszuweichen.
„Wir kollidieren!“, schrie er. Im selben Moment krachte die Titanic mit der Steuerbordseite unter Wasser in das massive Eis des Eisberges. Für die Jahreszeit und diese Entfernung vom Nordpol war der Eisberg schon oberhalb des Wassers ungewöhnlich groß – doch Eisberge haben die fatale Eigenschaft, nur zu einem Achtel aus dem Wasser zu ragen. Sieben Achtel sind unter der Oberfläche und ragen meist weit über die oberhalb sichtbaren Umrisse hinaus …
Die scharfkantigen Vorsprünge unterhalb der Wasserlinie den unter der Oberfläche rissen kleine Löcher in die Außenhaut, ließen die Stahlplatten verbiegen. An den Biegekanten brachen die Nieten weg. Das überlastete Metall kreischte, mächtige Eisklumpen brachen ab und rumpelten ins Wasser.
Das ganze Schiff vibrierte, als die Kollision ihren Lauf nahm. Der entsetzte Murdoch spürte es unter seinen behandschuhten Fingern in der Reling, der Rudergänger im Steuerrad, Jack und Rose mitten im Kuss unter ihren Füßen. Im G-Deck wurde Fabrizio davon aus dem Schlaf gerissen.
„Meine Güte!“, entfuhr es Fleet, als das ganze Krähennest erzitterte.
Es waren zwar nur sechs im Vergleich zur Länge des Schiffes relativ kleine Löcher, die die Kollision verursachte, doch sie waren fatal verteilt … Das Wasser brach zuerst in die vorderen Frachträume ein, die wie von einem riesigen Messer aufgeschlitzt wurden.
Weit oben im B-Deck befand sich die Kajüte, die Thomas Andrews bewohnte. Er hatte eine Blaupause des Schiffes vor sich, ein Glas Wein neben sich und brütete über möglichen Verbesserungen, als der Wein im Glas konzentrische Wellen warf, der Tisch und der Kristalllüster zu zittern begannen.
Im Rauchsalon der Ersten Klasse wunderte sich Archibald Gracie über das Vibrieren seines Getränks, im Palmengarten-Restaurant war die Kollision bislang völlig unbemerkt geblieben. Dort saß Molly Brown bei einem Drink, der ihr eindeutig zu warm geworden war. Sie hob das Glas und stoppte einen vorbeikommenden Steward:
„Hey, kann ich hier ‘n bisschen Eis bekommen?“
Hinter ihr zog lautlos der Eisberg am Fenster vorbei, der genügend Eis enthielt, um dieses Schiff komplett mit Eis zu füllen. Doch Molly bekam es nicht mit.
„Großer Gott!“, keuchte Fleet draußen im Krähennest.
„Ruder hart Backbord!“, brüllte Murdoch in das Steuerhaus. Moody wiederholte als nachgeordneter Offizier den Befehl an den Rudergänger, der eilig das Steuerrad nach rechts riss.
Der Frachtraum 2 erlitt einen Riss. Die beiden Stewards, die hier immer noch nach Rose und Jack fahndeten, wurden von dem eisigen Meerwasser regelrecht weggespült.
Der Eisberg kam jetzt auch für Rose und Jack in Sicht, die sich auf dem Welldeck aufhielten und sprachlos auf die ungeheure Eismasse sahen, die noch die Brückenhöhe deutlich überragte. Abbrechendes Eis verteilte sich auf dem Welldeck, als ob ein Riese mit einem gewaltigen Hammer Eiswürfel von einem Gletscher abschlug.
„Komm weg!“, schrie Jack und schob Rose hinter sich. Beide starrten weiterhin auf das ungeheure Naturgebilde und wollten ihren Augen nicht trauen.
Die scharfkantige Eismasse unter der Wasserlinie erreichte den Kesselraum 6, der direkt an die vorderen Frachträume angrenzte. Die Bordwand platzte fast auf der ganzen Länge des Kesselraums auf, Wasser schoss hinein.
„Hilfe!“, brüllte hier jemand.
„Helft mir!“, schrie ein anderer dort.
Und dann war nur noch ein einziges Durcheinander von Schreien im Kesselraum 6 zu hören. Dennoch bemühten sich die Männer trotz des zunehmenden Chaos noch die Kesselklappen zu schließen, damit hier nicht Wasser eindrang und es zur Kesselexplosion kam, die das Schiff zerrissen hätte.
Oben sahen Offiziere, Matrosen im Ausguck und wenige Passagiere auf dem Welldeck fassungslos dem in der Dunkelheit wieder verschwindenden Eisberg nach. Murdoch hatte endlich wieder seine fünf Sinne beisammen und stürzte ins Steuerhaus, wo er die an der Rückwand des Steuerstandes befindliche Anlage zur Steuerung der wasserdichten Schotten und den dazugehörigen Alarm aktivierte. Die Schotten im untersten Deck begannen, sich zu schließen, der Alarm schallte durch die Kesselräume und benachbarten Frachträume, die mit diesen Schotten gesichert werden konnten.
Frederick Barrett bemerkte es zuerst.
„Kommt schon! Raus hier! Macht, dass ihr hier rauskommt! Sie schließen die Schotten! Los, raus hier!“, brüllte er. Seine Männer schrien wüst durcheinander, strebten teils watend, teils schwimmend den Schotten zu, um noch rechtzeitig auf die andere Seite zu kommen.
„Los, raus hier! Schneller, schneller! Los, beeilt euch! Kommt schon! Na, los!“, trieb Barrett seine Männer an und warf sich erst in das sich schließende Schott, als die sich schließende Tür schon die Wasseroberfläche erreicht hatte. Zwei seiner Männer kamen für dieses Schott zu spät und schlüpften gerade noch auf der anderen Seite des Raums durch, bevor auch dieses Schott endgültig schloss.
Oben auf der Brücke leuchtete an der Anzeigetafel der Schottsteuerung eine Lampe nach der anderen auf und zeigte so an, dass das jeweilige Schott geschlossen war. Schließlich leuchteten alle zwölf Kontrolllampen. Murdoch wandte sich mit vorsichtigem Aufatmen ab. Wenigstens das hatte geklappt!
„Oh, mein Gott! Das war haarscharf, oder?“, keuchte Frederick Fleet draußen im Krähennest.
„Und du willst Eis riechen können! Meine Güte!“, fuhr Lee ihn an.
Nun bemerkten auch die flanierenden Passagiere auf dem Promenadendeck, dass sehr dicht an der Titanic ein Eisberg vorbeitrieb.
„Was war das?“, fragte einer von ihnen.
„Anscheinend ’n Eisberg“, antwortete ein anderer. Sie, Jack und Rose hingen halb über der Reling des Welldecks und sahen immer noch dem Eisberg nach.
„Tragen Sie in das Logbuch die genaue Uhrzeit ein“, wies der Erste Offizier seinen Untergebenen Moody an. Trotz der eisigen Kälte schwitzte er wie im Hochsommer.
Mit offenem Kragen, gelockerter Krawatte, ohne Mütze und Mantel kam Captain Edward Smith auf die Brücke.
„Was war das, Mr. Murdoch?“, fragte er, leicht verwirrt.
„Ein Eisberg, Sir. Wir haben das Ruder hart Steuerbord gelegt und die Maschinen volle Kraft zurückfahren lassen, aber es war zu dicht“, erklärte Murdoch. „Ich wollte Backbord vorbei, aber wir kollidierten und …“
„Schließen Sie die Schotten!“, unterbrach der Captain den Ersten Offizier.
„Die Schotten sind dicht, Sir!“, erwiderte Murdoch.
„Alle Maschinen stopp!“, kommandierte Smith.
„Aye, Sir!“, bestätigte Moody. Smith eilte auf die Brückennock*, sah nach offensichtlichen Schäden oberhalb der Wasserlinie, konnte aber einstweilen keine entdecken.
„Suchen Sie den Schiffzimmermann!“, wies der Captain seinen Ersten Offizier an. „Er soll alles überprüfen!“
„Jawohl, Sir!“, bestätigte Murdoch.
Fortsetzung folgt
Glossar
Dieser Roman zum Film enthält diverse Ausdrücke, die vermutlich nicht jedem bekannt sind. Hier sind sie erklärt.
Sofern Ausdrücke im Glossar an anderer Stelle ebenfalls vorkommen, sind diese als Querverweis unterstrichen
* Seemännische Fachausdrücke
abfieren: Siehe fieren
achtern: hinten
Heck: hinterster Teil des Schiffes
Backbord: nautisch links, linke Schiffsseite
Backdeck: (kurz auch Back genannt) Vorderstes Deck, direkt hinter dem Bug
Blanker Hans: Spitzname für das Meer als solches, hauptsächlich an der stets sturmflutgefährdeten deutschen Nordseeküste gebraucht.
Block: Gehäuse mit mehreren Rollen zum Umlenken von Tauen
Blue Ensign: Dienstflagge Großbritanniens. Der Flaggengrund ist blau, in der Oberecke (das obere Viertel der Flagge, das sich am Mast befindet) befindet sich der Union Jack, die britische Nationalflagge.
Brücke: Der erhöhte Steuerstand auf einem Schiff – meist ist befindet er sich auf dem obersten Deck – wird auch als Brücke bezeichnet.
Brückennock: Über die Außenhaut eines Schiffes hinausragender, meist offener Teil der Brücke, der insbesondere für Anlegemanöver einen besseren Überblick ermöglicht.
Bug: vorderster Teil des Schiffes
CQD: Erster Funknotruf der Fa. Marconi auf See vor Einführung des internationalen SOS-Signals. CQ steht dabei für seek you (suche euch/dich), das D für distress (Gefahr). Als englische Eselsbrücke dient auch: come quick, danger (komm schnell, Gefahr)
Davit: schwenkbarer Kran (in der Regel paarweise vorhanden), mit dem ein Boot ausgesetzt bzw. eingeholt werden kann.
dicht (-holen): strammziehen
Dienstflagge: Flagge, die auf Schiffen des öffentlichen Dienstes einer Nation am Flaggenmast gesetzt wird.
Ducht: Sitzbank in einem Boot
Fall (Pl. Fallen): Tau zum hieven oder fieren von Gegenständen (in diesem Fall Boote)
fieren: herunterlassen
Fockmast: vorderster Mast auf mehrmastigen Schiffen (die Titanic hatte zwei Masten)
Handelsflagge: Flagge, die von Handelsschiffen, aber auch von Privatleuten am Flaggenmast eines Schiffes geführt wird.
Heckschwell: Siehe Schwell
hieven: hochziehen
Klampe: Vorrichtung zum Befestigen von Leinen auf einem Schiff, aus Holz oder Metall gefertigt und mit zwei voneinander weg gerichteten Hörnern versehen. Die Hörner einer Klampe sind in der Regel parallel zur Reling ausgerichtet.
Knoten: nautische Geschwindigkeitseinheit, 1 Knoten (kn) entspricht 1 Seemeile pro Stunde. Die Einheit entstand daraus, dass eine mit einem Log genannten Gewicht beschwerte Knotenleine vom Schiff ins Wasser gehalten wurde. Das Log zerrte durch seine Bremswirkung die Knotenleine durch die Hand des messenden Matrosen. Je nachdem, wie viele Knoten in einer bestimmten Zeit durch die Hand des Matrosen liefen, so viele Seemeilen bzw. Knoten je Stunde lief das Schiff.
Niedergang: Steile Treppe auf einem Schiff
Persenning: in der Seemannssprache: wasserfest gemachtes Gewebe, um Hohlräume vor dem Eindringen vom Wasser zu schützen.
Pinne: Direkt mit dem Ruderblatt im rechten Winkel verbundenes Rundholz. Das Boot wird damit ganz direkt gesteuert.
Pullen: nix Flaschen … Seemännisch korrekter Ausdruck für das, was Landratten „rudern“ nennen.
Red Ensign: Handelsflagge Großbritanniens. Der Flaggengrund ist rot, in der Oberecke (siehe auch Dienstflagge) befindet sich der Union Jack.
Reling: Geländer zur Sicherung gegen Absturz auf einem Schiff.
Riemen: nein, kein Gürtel. Rundholz mit Blatt, um ein Boot durch pullen vorwärts zu bewegen. Unseemännisch auch „Ruder“ genannt.
Schanzkleid: das; die massive, brüstungs- oder wandartige Fortsetzung oder Erhöhung der Bordwand über ein freiliegendes Schiffsdeck hinaus. Es ist insofern eine Sonderform der sonst offenen Reling.
Schwell: der, in Häfen und begrenzten Gewässern von fahrenden Schiffen bewegtes Wasser oder hinein stehende schwache Dünung. Kann aber auch in offenem Gewässer hinter schnell fahrenden Schiffen entstehen, insbesondere bei propellergetriebenen Schiffen
Scotland Road: Eigentlich eine Straße in Liverpool (die Titanic war in Liverpool registriert), über die die Postkutschenlinie von Liverpool nach Schottland verlief. Heute ist es die 109 Meilen (175 km) lange Hauptstraße A 59, die auf der Merseyside von Liverpool beginnt und in York/North Yorkshire endet. Sie wurde im Laufe ihrer Geschichte verbreitert, gilt als sehr lange Straße und innerhalb Liverpools als Zentrum der Zuwanderer nach Großbritannien. Ähnlich war auch die Dritte Klasse der Titanic strukturiert, weshalb der einzige, zudem besonders breite vom Bug zum Heck durchgehende Korridor im E-Deck diesen Spitznamen bekam.
Seemeile: nautisches Längenmaß, Abk. sm = 1.852 m
Smutje: Koch auf einem Schiff
SOS: Internationaler Notruf, kann mit save our souls ausgeschrieben werden; dies ist jedoch nur eine Eselsbrücke, um sich den Ruf zu merken. Die Morsezeichenfolge drei Punkte, drei Striche, drei Punkte ist auch so eingängig, dass selbst ein funktechnischer Laie sie schnell begreift und im Notfall auch senden bzw. empfangen kann. Entgegen der sonstigen Morseregel, dass zwischen den Buchstaben eine Pause einzulegen ist, die die Länge eines Punktes hat, wird SOS durchgängig gemorst, also ohne Pause.
Stag: Dauerhaft befestigtes („stehendes“) Tau auf einem Schiff in Längsrichtung zur Schiffsachse, das zur Befestigung von Masten oder Schornsteinen dient oder – bei Segelschiffen – an dem auch längs zur Schiffsachse Segel gesetzt werden können.
Steuerbord: nautisch rechts, rechte Schiffsseite
Talje: seemännische Bezeichnung eines Flaschenzuges, der aus Tauen und Blöcken gebildet wird.
Tampen: Ende eines Taues/einer Leine
Vorstag: Siehe Stag
Want: (Mrz. Wanten), das; dauerhaft befestigtes („stehendes“) Tau auf einem Schiff in Querrichtung zur Schiffsachse, das zur Befestigung von Masten oder Schornsteinen dient.
Welldeck: Offener Bereich des Hauptdecks zwischen dem Backdeck und den Hauptaufbauten Schiffes.
** Allgemeines Lexikon
Chiton: der; altgriechisches Gewand, das direkt am Leib getragen wurde. Es wurde aus einem rechteckigen Stück Leinenstoff gefaltet. Er ist an der linken Seite geschlossen, bleibt an der rechten Seite offen und wird durch Fibeln auf der Schulter zusammengehalten. Als Frauengewand war der Chiton lang und reichte bis fast auf den Boden, als Männergewand reichte er etwa bis zum Knie. In der Regel bestand er aus einem leichten Leinengewebe. Die schwere Variante aus Wollstoff (und eigentlich ein reines Frauengewand) wurde als Peplos bezeichnet
Cloche: Abdeckhaube für Speisen, die hauptsächlich in der gehobenen Gastronomie eingesetzt wird. Eine Cloche besteht aus Glas, Kunststoff (allerdings nicht 1912 …) oder Edelstahl und dient zum Warmhalten der Speise zwischen Küche und Gästetisch. Als Nebeneffekt der Benutzung einer undurchsichtigen Cloche ergibt sich eine Art Überraschungseffekt für den Gast, wenn die Speise vor seinen Augen aufgedeckt wird. Ob angenehme Überraschung oder nicht, das liegt an der Speise selbst …
Entkleiden: Eigentlich liegt hier ein Filmfehler vor, da Rose sich nach den sonstigen Informationen aus dem Drehbuch das Korsett nicht allein ausziehen kann. Einen Hinweis darauf, dass Jack ihr hilft oder dass sie zu einem anderen Zeitpunkt am Tag das Korsett abgelegt hat, gibt es nicht. Es ist denkbar, dass die Szene mit dem Nervenzusammenbruch herausgeschnitten wurde, um hier das eigenständige Entkleiden glaubwürdig bleiben zu lassen.
Fuß: engl. Längenmaß, ca. 30 cm
Humidor: Behälter, in der Regel aus dem Holz der in der Karibik heimischen Westindischen Zeder hergestellt, in dem Zigarren bei der für sie besten Luftfeuchtigkeit von ca. 70 – 75% und einer Temperatur von 18 – 22° C gelagert werden können. Im Deckel des Humidors befinden sich ein Hygrometer, das die Luftfeuchtigkeit misst und anzeigt, sowie ein feuchtigkeitsdurchlässiger Behälter für ein benetztes Schwämmchen, der die Feuchtigkeit reguliert abgibt. Dadurch wird eine konstante Feuchtigkeit gewährleistet.
Inch: engl. Längenmaß, ca. 2,54 cm
Kinematograph: handbetriebener Vorläufer der Filmkamera
Komtesse: Im Dialog wird die Gräfin von Rothes als Komtesse bezeichnet. Hierbei handelt es sich um einen schlichten Übersetzungsfehler, da der englische Adelstitel Countess auf Deutsch Gräfin bedeutet. Eine Komtesse ist die unverheiratete Tochter eines Grafen. Gräfin Rothes war jedoch mit dem 19. Earl (Graf) of Rothes verheiratet.
Pfund: historische Maßeinheit für Masse; 0,5 kg
Pint: engl. Hohlmaß, ca. 0,5 l
Quadratfuß: Im Prinzip die Übersetzung für square feet (Abk. sq ft). 1 sq ft. entspricht ca. 0,09 m², 9 sq ft ergeben 1 sq yd (square yard), was ca. 0,8 m² entspricht. Die im Text enthaltene Flächenangabe von 12 sq ft/Quadratfuß entsprechen etwas mehr als einem Quadratmeter.
Standard Oil: Die Abkürzung SO ist – lesbar als Esso – eine der weltweit bekannten Treibstoffmarken.
Tir na nÓg: altirisch, bedeutet Land der ewigen Jugend. Gilt in der keltisch-irischen Sagenwelt als einer der bekanntesten Orte der mystischen Anderswelt, des Jenseits. Dieser Ort soll der Mythologie nach im Westen Irlands liegen und ist mit dem Himmel in der christlichen Mythologie vergleichbar. Deshalb soll er nur durch eine beschwerliche Reise oder die Einladung eines Bewohners – meist sind es Elfen – erreichbar sein.
Yard: engl. Längenmaß, ca. 1 m
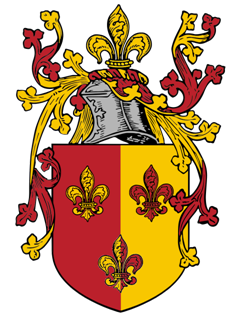

Danke, dass das Filmbuch wieder da ist.
Ich freue mich sehr darüber.
Liebe Grüße
Andrea
Hallo, Andrea,
willkommen zurück! Vielen Dank für deinen Kommentar. Ich wünsche dir weiterhin viel lesevergnügen.
Liebe Grüße
Gundula