Prolog
Der Sommer 1897 war heiß und entsprechend heißblütig wurde der 1.010. Jahrestag der Gründung des Königreichs Wengland gefeiert. Wie immer hatte es am 10. Juli ein großes Feuerwerk gegeben, am 11. Juli, dem eigentlichen Feiertag, fand die große Militärparade statt.
König Alexander I. von Wengland nahm die Parade in Begleitung seiner Gemahlin, Königin Simone, von der Königsloge des Steinburger Schlosses aus voller Vaterstolz ab. Sein jüngerer Sohn Friedrich war als Leutnant der Gardekavallerie mit dabei. Neben ihm standen noch Tochter Ursula, Friedrichs Zwillingsschwester, und der ältere Sohn Stephan, der Kronprinz.
Alexander nahm vertraulich die Hand seiner Frau.
„Täusche ich mich oder ist es heute fünfundzwanzig Jahre her, dass wir beide von hier aus die Parade gesehen haben?“, fragte er leise. Simone lächelte.
„Nein, du täuschst dich nicht“, erwiderte die Königin und drückte ihrem Mann einen sanften Kuss auf die Wange. Seit sieben Jahren regierte König Alexander – und sie, die Tochter des radikalsten Sozialistenführers im ganzen Königreich Wengland, war die Königin eines modernen und aufgeschlossenen Wengland.
In Wengland hatte sich politisch viel verändert. Schon 1875, als Alexander nach dem Tod seiner beiden älteren Brüder Friedrich und Eberhard Kronprinz geworden war, hatte er angekündigt, die Regierungsform in eine konstitutionelle Monarchie umwandeln zu wollen. König Wilhelm war davon zunächst wenig angetan gewesen, hatte seinen Sohn aber letztlich nicht behindert, als er ab 1880 entsprechende Vorbereitungen getroffen hatte, weil sich die reichsweite Änderung erst nach Alexanders Regierungsübernahme auswirken sollte. Der damalige Kronprinz hatte dafür gesorgt, dass sich Parteien bilden konnten, die sich zunächst auf der untersten Verwaltungsebene, den Städten und Dörfern, als Mittler des politischen Willens der Bevölkerung etablierten. Etwa fünf Jahre später, nachdem das System auf kommunaler Ebene funktionierte, hatte der Prinz sich mit den Spitzenpolitikern aller wenglischen Parteien – einschließlich der Sozialisten – getroffen und in jahrelanger Arbeit einen Verfassungsentwurf erarbeitet, der einen Teil der königlichen Macht an das Volk abtrat. Die Vorbereitungen waren so gründlich gewesen, dass ein halbes Jahr nach Alexanders Krönung ein Parlament gewählt worden war, zu dem alle Wengländer beiderlei Geschlechts das aktive und passive Wahlrecht hatten, sofern sie volljährig, also einundzwanzig Jahre alt waren.
Genau genommen wählte das Volk nur das Unterhaus, die eigentliche Volksvertretung, während das Oberhaus, die Vertretung des Adels, durch die Grafen und Barone erbliche Sitze hatte. Den alten Grafenrat gab es nicht mehr, dafür war das Oberhaus eingesetzt worden. Das Oberhaus hatte Kontrollfunktion gegenüber dem Unterhaus, wirkte bei der Gesetzgebung mit, hatte wohl ein Vetorecht, jedoch nur ein aufschiebendes, das durch eine Zweidrittelmehrheit des Unterhauses überstimmt werden konnte. Ein absolutes Vetorecht hatte nur der König – und das nur in Angelegenheiten des Adels. König Alexander selbst hatte diesen Passus eingefügt, weil er der Ansicht war, dass das Volk im Wesentlichen selbst seine Geschicke bestimmen sollte und dafür auch haften sollte, wenn es notwendig war …
Die erste fünfjährige Wahlperiode war beendet, die Regierungspartei der Königlich Konservativen unter Premierminister Maximilian Bärmann war im Amt bestätigt worden und hatte sogar Stimmengewinne auf Kosten der Sozialisten verzeichnen können.
Auch in der Verkehrstechnik hatte sich vieles verändert. In den letzten fünfundzwanzig Jahren hatte die Eisenbahn unter ihrem Direktor Alexander von Wengland ein so dichtes Netz von Verbindungen erstellt, dass beinahe jeder Ort mit Marktrecht von der Eisenbahn erreicht werden konnte. Felsbruck, damals im Jahr 1872, noch ein Flecken mit sieben Häusern und neun Spitzbuben, war Wenglands Eisenbahnhauptstadt geworden. Zwar war die Hauptverwaltung der KWE, der Königlich Wenglischen Eisenbahn, in Steinburg, aber die größte Regionalverwaltung, die RV West, befand sich in Felsbruck. Außerdem hatte Felsbruck das Ausbesserungswerk, was eigentlich eine grobe Untertreibung war. In Felsbruck wurde nicht nur repariert, die Eisenbahn arbeitete auch sehr eng mit den beiden dort befindlichen Lokomotivfabriken und drei Waggonwerken zusammen. Im so genannten Ausbesserungswerk befand sich die Erprobungsabteilung mit eigenem Labor, die ihresgleichen suchte. Schon seit zehn Jahren experimentierte man dort mit elektrisch getriebenen Fahrzeugen, seit einem guten Jahr hatte die LFF, die Lokomotivfabrik Felsbruck, die erste Elektrolok zur Serienreife gebracht. Spätestens zur Jahrhundertwende sollte die erste Teilstrecke elektrifiziert sein und künftig mit Elektroloks befahren werden.
König Alexander nahm weiterhin regen Anteil am Geschick seiner Bahn. Schließlich hatte er sie geplant, war ihr Bauleiter und Direktor gewesen. Als er 1890 nach dem Tod seines Vaters Wilhelm zum König gekrönt worden war, hatte er den Direktorenposten zugunsten seines damaligen Stellvertreters Anselm Krantz aufgegeben, hatte aber immer noch einen Sitz im Vorstand der Königlich Wenglischen Eisenbahn. Sein ehemaliger Hauptmitarbeiter, Dr. Ing. Andreas Ettinger, hatte an der Steinburger Universität den Lehrstuhl für Geologie, war glücklich verheiratet, hatte fünf Kinder, drei Töchter und zwei Söhne, die mittlerweile alle das Steinburger Martinsgymnasium besuchten. Die väterliche Intelligenz hatte bei den Ettinger-Kindern voll durchgeschlagen.
Fünfundzwanzig Jahre zuvor wäre es schiere Utopie gewesen, dass die Kinder eines selbst aus armen Verhältnissen stammenden Vaters ein Gymnasium besuchten. Intelligenz allein hätte ihnen nicht geholfen. Der Vater hätte es sich ob des teuren Schulgeldes einfach nicht leisten können, seine Kinder auf ein Gymnasium zu schicken. Doch noch unter der Regierung König Wilhelms war bereits vor zwanzig Jahren auf Anregung des damaligen Kronprinzen Alexander das Schulgeld abgeschafft worden. Schul- und Hochschulbesuch waren kostenfrei, ebenso die dazugehörigen Lernmittel. Die Folge war ein deutlicher Bildungsschub gewesen, der sich jetzt richtig auswirkte. Die Anzahl der Studenten – und Studentinnen! – hatte sich glatt vervierfacht, was zur Gründung weiterer Universitäten geführt hatte. Außer der altehrwürdigen Hochschule in Wachtelberg gab es nun die Universität Steinburg, die einen guten Ruf im Bereich der Naturwissenschaften und in der Archäologie hatte, die Universität von Siebeneich, die sich eher den sprachlichen Wissenschaften verschrieben hatte, sowie die Universität von Christophstein, die neben dem Polytechnikum auch die medizinische und juristische Fakultät mit der landesweit größten Bedeutung hatte. Eine besondere Spezialität der Universität Christophstein war der Umstand, dass alle Fächer sowohl in wenglischer, also deutscher, als auch in wilzarischer Sprache unterrichtet wurden.
Alexander konnte mit dem, was er erreicht hatte, durchaus zufrieden sein. Mit seiner Hilfe hatte Wengland den Sprung in eine neue Zeit geschafft, war ein mobiles, politisch waches und gebildetes Land geworden. Die Narben der alten Teilung, die noch bis in die Regierungszeit König Wilhelms zu spüren gewesen waren, waren ausgelöscht. Es schien, als sei Wengland nie etwas anderes gewesen, als das Land, was es jetzt war.
Doch es gab eine kleine Ausnahme – und das war Aventur. Aventur war die südöstlichste und die jüngste Grafschaft Wenglands, auch wenn die Zugehörigkeit bereits über sechshundert Jahre andauerte. Seit 1265 gehörte die Provinz zu Wengland. Gleichwohl wurden dort beide Sprachen gesprochen, verlief doch die Sprachgrenze zwischen dem Wenglischen und dem Wilzarischen mitten durch die Provinz. Sämtliche Orte waren zweisprachig bezeichnet, in den Schulen wurde zweisprachig unterrichtet. Kam ein Beamter oder Angestellter nach Aventur, musste er nachweisen, dass er beide Sprachen fließend beherrschte. An der Universität Christophstein gab es deshalb eine große Anzahl von Studenten mit mindestens wilzarischen Wurzeln, wenn sie nicht sogar wilzarische Staatsbürger waren. Und weil es im Gegensatz zu Wengland in Wilzarien keine Studienmöglichkeit für Frauen gab, war der Frauenanteil unter den wilzarischen Studierenden besonders hoch.
Auch wenn es seit nunmehr über sechshundert Jahren zu Wengland gehörte, war und blieb es ein Zankapfel mit dem östlichen Nachbarn Wilzarien. Aber auch hier schien eine Lösung am Horizont zu sein. Zwei Jahre zuvor war mit Paul von Silla zum ersten Mal seit Jahrhunderten ein König gekrönt worden, der nicht aus dem Buchenberger Fürstenhaus stammte. Sein Vorgänger, König Livor IV., hatte zwar einen Sohn gehabt – doch hatte er diesen Sohn hinrichten lassen, weil er einem wenglischen Spion aus der Zitadelle von Buchenberg zur Flucht verholfen hatte.
In Wilzarien erbte nach wie vor nur ein Sohn. Weder eigene Töchter des Erblassers noch andere Angehörige hatten in irgendeiner Form ein Erbrecht. Das gesamte Erbe ging an den ältesten Sohn. Hatte der Erblasser keine Söhne, ging das gesamte Erbe an den Provinzfürsten. Im Falle des Königs ging das Erbe auf den Fürstenrat über, der den neuen König dann aus seiner Mitte wählte.
So war Paldor von Silla zum König gekrönt worden. Der Name kam von einer Stadt, die schon lange nicht mehr wilzarisch war; unter dem Namen Christophstein war Silla die Hauptstadt der wenglischen Provinz Aventur.
Was sich die Wilzarenfürsten mit Paldor von Silla als König eingehandelt hatten, merkten sie erst, als der die absolute Macht des wilzarischen Königs in der Hand hatte. Kaum dass der letzte Fürst ihm den bedingungslosen Gehorsam geschworen hatte, hatte der neue König eröffnet, dass er das Verbot des Christentums aufhebe und dass er sich selbst zum Christentum bekenne und den Namen Paul annehme. Er widersagte der wilzarischen Sitte, nach der der König einen Harem von wenigstens zwanzig Frauen unterhielt. Weiterhin kündigte Paul an, sich nunmehr mit dem Nachbarn Wengland ein für allemal auszusöhnen und einen dauerhaften Frieden schließen zu wollen. Die wilzarischen Adligen waren hell entsetzt – und es gab durchaus welche, die an einen gewaltsamen Umsturz dachten.
Für einen dauerhaften Frieden war eine endgültige Lösung für Aventur unumgänglich, das war König Paul klar. Da immer wieder die Behauptung kursierte, die Wilzaren in Aventur wünschten eine Rückkehr nach Wilzarien, beschloss Paul, das näher zu untersuchen – aber unauffällig. Er sandte eine ganz besondere Vertrauensperson nach Aventur …
Kapitel 1
Neuer Lebensabschnitt
Für den Kronprinzen Stephan bedeutete dieser 11. Juli 1897 den Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt. Er hatte seinen zweijährigen aktiven Militärdienst beendet, war als Oberleutnant aus den Reihen der Gardepioniere ausgeschieden und würde am folgenden Tag nach Christophstein reisen, um sein Studium aufzunehmen.
Dass er gerade Vermessungstechnik studieren wollte, hatte niemanden verwundert. Schließlich war sein Vater Doktor-Ingenieur in diesem Fach, hatte darin eine Gastprofessur an der Universität Wachtelberg und arbeitete – wenn seine Aufgaben als König Wenglands es zuließen – noch immer als freier Vermessungstechniker für sein viertes Kind, die Königlich Wenglische Eisenbahn. Aber dass Stephan ausgerechnet in Christophstein studieren wollte, bereitete seinem Vater doch gewisse Sorgen.
Alexander hatte selbst zu oft in Grenzkonflikten mit Wilzarien um Aventur gestanden, als dass er seinen Erben gerade dort wissen wollte. Zwar hatte Stephan seinen Militärdienst dort geleistet, aber er hatte das Glück gehabt, dass in den beiden Jahren seiner Dienstzeit kein neuer Krieg wegen der Provinz ausgebrochen war. Der König wusste noch nicht recht, was er von seinem neuen Kollegen auf wilzarischer Seite halten sollte und mochte dem Angebot zu endgültigen Friedensverhandlungen nicht wirklich trauen.
Doch Stephan hatte darauf bestanden, nicht in Wachtelberg zu studieren. Ihm war die Gefahr zu groß, dass sein Vater ihn als dortiger Professor für Vermessungstechnik entweder zu sehr bevorzugen oder zu sehr unter Druck setzen würde. Das jedenfalls war Stephans offizielle Version, weshalb er gerade nach Aventur zurück wollte.
Der wirkliche Grund hatte lange Beine, dunkle Haare, rehbraune Augen, beim Lächeln niedliche Grübchen in den Wangen und hieß Sandra Habermann. Er wusste, dass Sandra wilzarischer Herkunft war und dass sie in Christophstein Jura studieren wollte. Sie waren sich im März des Jahres 1897 bei einem Tag der offenen Tür in der Pionierkaserne von Christophstein begegnet – und es hatte sofort gefunkt.
Stephan sah auf die Parade, aber er war nicht bei der Sache. Seit Wochen freute er sich auf seine Abreise am 12. Juli nach Christophstein, freute sich auf das Wiedersehen mit Sandra – aber darüber konnte er mit seinen Eltern einfach nicht sprechen. Dass ausgerechnet er, der Thronfolger Wenglands, eine in eine Wilzarin verliebt war, konnte er bei aller Toleranz seiner Eltern nicht offen aussprechen.
Seine offensichtliche Geistesabwesenheit deutete sein Vater falsch, dafür entschuldigend. Er war der Meinung, Stephan befasse sich intensiv mit einem Vermessungsproblem, das sie am Abend zuvor besprochen hatten und das auch noch beim Frühstück Thema gewesen war.
Wenn Stephan sein Studium aufnahm, würde er in seinem Fach kein Anfänger mehr sein. Er war unter den Fittichen eines Vermessungsingenieurs aufgewachsen und hatte schon als Junge gelernt, mit einem Theodoliten umzugehen. Rein aus Jux hatte Stephan den Steinburger Burgberg mit den Gerätschaften seines Vaters vermessen, die Werte auf eine Karte übertragen und nachgezeichnet. Unter Anleitung seines Vaters hatte er die Vermessung in Holz nachgebaut – und es war ein fast originalgetreues Abbild des Burgberges im Maßstab 1:100 herausgekommen. Von diesem Moment an hatte Alexander das offensichtliche Talent seines Ältesten gefördert. Genau genommen würde das Studium für Stephan ein Wiederholungskurs mit staatlichem Abschluss sein.
Am folgenden Tag brachte Alexander seinen Sohn selbst und außer dem Kutscher ohne Begleitung zum Steinburger Hauptbahnhof. Königin Simone konnte eine Bahnhofstrennung nicht ertragen. Sie hatte immer schreckliche Angst um ihre Kinder. So hatte der König seine Kinder bislang immer allein zum Bahnhof gebracht, wenn sie aus immer welchen Gründen ohne ihre Eltern reisen mussten. Nie hatte er das Gefühl gehabt, dass es sich um einen unabsehbar langen Abschied handeln könnte. Doch diesmal beschlich ihn eine eigenartige Ahnung.
„Du fährst in eine Gegend, bei der mir nicht ganz wohl ist, Stephan“, sagte er, als sie auf dem Bahnsteig auf den Zug warteten.
„Was soll schon passieren, Vater?“, fragte der junge Mann. „Im Dezember sind Semesterferien, und ich komme heim. Ich hab’ doch meinen Militärdienst auch dort abgeleistet, und du hast nie etwas dazu gesagt.“
„Da warst du Soldat, mein Junge, und deine Einheit war dort stationiert“, erinnerte Alexander.
„Damit, dass ich die Uniform ausgezogen habe, habe ich nichts davon verlernt, wenn du das meinst. Außerdem haben du und Großpapa immer gesagt, dass ein Wengländer immer Soldat sei, ob mit oder ohne Uniform. Und Paul von Wilzarien gehört nicht zu der Sorte Wilzaren, die auf Aventur scharf sind.“
„So? Wer sagt das?“
„In Christophstein pfeifen es die Spatzen von den Dächern. Hat Paul dir nicht sogar schon direkte Verhandlungen angeboten?“
„Ich traue den Wilzaren nicht. Ich habe zu oft erlebt, dass sie uns mit List und Tücke Aventur entreißen wollten. Mir wäre es wirklich lieber gewesen, wenn du in Wachtelberg studieren würdest.“
„Weiß ich, Paps, aber Christophstein gefällt mir nun einmal besser. Ist auch die einzige Gegend in der ich ab und zu mal ausprobieren kann, ob es sich gelohnt hat, Wilzarisch zu lernen.“
Alexander seufzte tief. Es fiel ihm schwer, seinen Sohn loszulassen …
„Ich … wünsche dir alles Gute, mein Junge. Mach mir keine Schande“, sagte er schließlich.
„Erwartest du, dass ich Abschlussbester werde?“, fragte Stephan mit verschmitztem Grinsen.
„Mindestens!“, gab sein Vater lachend zurück, auch wenn sich ein Schatten in das Lachen mischte. „Christophstein ist eine schöne Stadt“, sagte er dann leise.
„Warst du auch mal dort?“
„Ich habe auch einen Teil meiner Militärzeit in Aventur verbracht. Daran denke ich zwar nicht gern, aber Christophstein … oh ja, davon träume ich manchmal noch.“
„Grund?“, fragte Stephan.
„Wenn man zum ersten Mal richtig verliebt ist, dann ist jede Gegend rosarot.“
„Oh, wer war sie?“
„Jedenfalls nicht deine Mutter; der bin ich erst viel später begegnet. Ich habe mir oft gewünscht, ich hätte deine Mutter schon damals gekannt. So schön weit weg von allen Anstandswachen …“, erwiderte Alexander. „Aber das ist kein Freibrief, mein Sohn!“, schränkte er dann ein. „Ich erwarte, dass du fleißig studierst und einen guten Abschluss machst.“
„Jawohl, Majestät!“, bestätigte Stephan grinsend.
„Auf Gleis drei fährt ein Schnellzug nach Christophstein über Ahrenstein, Wutzbach, Turmesch, Rothenfels, Buchhausen. Nach Markbach in Ahrenstein umsteigen, nach Limmstedt in Wutzbach umsteigen, nach Karlstedt in Turmesch umsteigen!“, rief der Aufsichtsbeamte aus, als der Zug einrollte und mit quietschenden Bremsen am Bahnsteig zum stehen kam. Dampf entwich zischend aus den Bremsventilen. Alexander und sein Sohn gingen am Zug entlang, bis sie zu einem Wagen der II. Klasse kamen.
„Eins versteh’ ich nicht: Wieso reist du eigentlich nicht I. Klasse?“, fragte der König, als er dem angehenden Studenten das Gepäck hinaufreichte.
„Ach, Paps, ich möchte ein stinknormaler Studiosus sein“, erwiderte Stephan mit einem Seufzen. „Ich erinnere mich, dass mein Herr Papa das auch immer gewollt hat und außerhalb von Steinburg nur ungern der Kronprinz war … Wir haben viel gemeinsam, Vater.“
„Daraus schließe ich, dass niemand in Christophstein weiß, wer du wirklich bist“, schmunzelte der König.
„So ist es. Dort bin ich als Stephan Steiner eingeschrieben.“
„Du Lümmel!“, schalt Alexander, aber der Klang machte deutlich, dass es ironisch gemeint war. „Ich habe mich ja wenigstens noch von Steinburg genannt.“
„Zieht nicht mehr, der Trick ist bekannt, Paps. Deshalb habe ich mich fürs volle Inkognito entschieden. Außerdem … falls doch was schiefgeht, wissen die Wilzaren nicht sofort, dass Wenglands Kronprinz unter ihrer Nase tanzt.“
„Das beruhigt mich jetzt mehr, als du ahnst, mein Junge.“
„Nach Christophstein bitte einsteigen und Türen schließen! Vorsicht an der Bahnsteigkante!“, rief der Aufsichtsbeamte, ein schriller Pfiff ertönte. Stephan schloss die Abteiltür und zog das Fenster hinunter.
„Bis Weihnachten, Papa. Grüß Mama und die Kleinen.“
„Ja, mache ich. Lass es dir gutgehen und schreib bitte mindestens einmal in der Woche. Und telegrafiere unbedingt gleich, wenn du angekommen bist. Mama macht sich sonst Sorgen. Du kennst sie ja.“
Stephan nickte. Der Fahrdienstleiter hob die grüne Kelle, die dem Lokführer die geschlossenen Türen der Wagen signalisierte. Die Dampfpfeife der Lok fiepte schrill auf, als das Ausfahrtsignal auf „Freie Fahrt“ klappte. Der Zug setzte sich mit einem heftigen Ruck in Bewegung. Stephan blieb am offenen Fenster stehen und winkte, bis der Zug in die Kurve hinter dem Bahnhof fuhr, wo die Strecke gen Osten nach Ahrenstein abzweigte.
Zum ersten Mal in seinem Dasein als Vater hatte Alexander ein flaues Gefühl in der Magengrube, als er die roten Schlusslichter des Zuges am Ende der Kurve hinter dem Steinburger Stadtwald verschwinden sah.
‚Hoffentlich bereut Stephan seine Entscheidung nicht‘, durchzuckte es den König. Langsam ging er zur Empfangshalle, vor der Gottlieb, sein persönlicher Diener, mit der Kutsche auf ihn wartete.
„Majestät sehen nicht glücklich aus“, bemerkte der Diener.
„Wie soll ich glücklich sein, wenn ich meinen Jungen wieder hergeben muss, kaum dass er zu Hause war?“, seufzte Alexander.
„Darf ich Majestät daran erinnern, dass der Herr Außenminister Walter in einer Stunde einen Termin bei Ihnen hat?“, fragte Gottlieb.
„Ja, danke, Gottlieb. Fahren Sie nach Hause.“
Kapitel 2
Bekanntschaften
Kaum dass der Zug den Steinburger Hauptbahnhof verlassen hatte und die Silhouette der heimatlichen Burg hinter der Talbiegung verschwunden war, schob Stephan das Fenster wieder hoch und setzte sich auf den Fensterplatz in Fahrtrichtung. Das Abteil war – abgesehen von seinem Platz – leer. Er griff in die Innentasche seine Jacke und nahm einen Brief heraus, dem anzusehen war, dass er schon oft gelesen worden war.
Liebster Stephan!
Seit März ist so viel Zeit vergangen, in der wir uns nicht gesehen haben. Wenn der Kalender mich nicht narrt, dann hast Du heute in einer Woche Deinen letzten Tag als Soldat hier in Christophstein. Wenn wir uns auch nicht so oft gesehen haben, seit wir uns im März begegnet sind, so waren die wenigen Male umso unvergesslicher für mich. Wenn Du Christophstein in einer Woche verlässt, werde ich wohl lange auf Dich verzichten müssen. Oder hast Du es Dir mit dem Studienort überlegt? Professor Bäcker wäre gewiss froh, wenigstens einen Studenten zu haben, der ihm geistig folgen kann. Außerdem, das weißt Du ja, wollte ich gern in Christophstein studieren, weil wilzarisches Recht im Rahmen eines Jurastudiums nun einmal nur hier auch für Frauen angeboten wird.
Bitte Stephan, bleib in Christophstein.
Deine Sandra
Stephan las den Brief mit einem Lächeln. Seine Sandra! Was für ein Mädchen! Die junge Dame wilzarischer Herkunft hatte es dem Königssohn mit einer Macht angetan, die ihn völlig umgerissen hatte.
Dass sie eine Bürgerstochter mit Studienabsichten war, konnte seine Eltern nicht stören. Schließlich war seine Mutter ebenfalls bürgerlich erzogen und gebildet, seine Großmutter war eine Bürgerstochter gewesen. Aber der Umstand, dass Sandra wilzarisches Blut hatte, konnte Schwierigkeiten machen. Zwar waren Ehen zwischen Wengländern und Wilzaren nicht verboten, waren gerade in Aventur eher normal als eine Ausnahme, doch Stephan sollte eines Tages den Thron erben – und eine Königin mit Wilzarenblut auf Wenglands Thron, das ging gar nicht! Das konnte gut einen Volksaufstand geben.
Die meisten Wengländer mochten den Wilzaren nicht verzeihen, dass sie in den nun über tausend Jahren, die es Wengland als Königreich gab, immer wieder Streit gesucht hatten. Mit erschreckender Regelmäßigkeit waren wilzarische Heere mindestens seit dem Jahr 1200 immer wieder mit so erbarmungsloser Grausamkeit über Südwengland, zuweilen auch Eschenfels, Karlsfeld und Hirschfeld hergefallen, dass es geradezu sprichwörtlich war, zu sagen: Hier sieht’s ja aus, als hätten die Wilzaren gehaust, wenn etwas massiv unaufgeräumt oder großflächig beschädigt war …
Stephan hatte die Geschichte der Könige Wenglands aufmerksam gelesen. Jeder König oder Fürst hatte versucht, mit Wilzarien einen Ausgleich zu finden, was seit 1265 regelmäßig an der Aventurfrage gescheitert war. Seit König Ranador die Provinz 1265 nach einem verlorenen Krieg die Provinz als Sicherheitszone hatte abtreten müssen, hatten seine Nachfolger immer wieder eine Rückeroberung versucht, hatte Wengland wenigstens hundert Kriege mit Wilzarien nur um diese Provinz ausgefochten und war bis jetzt immer Sieger geblieben. In den ersten Jahren waren es bis zu vier Kriege in einem Jahr gewesen, dann hatte die Energie der Wilzaren allmählich nachgelassen.
Nun war es schon fast dreißig Jahre ruhig, aber die Wengländer hatten gelernt, dass die Wilzaren unberechenbar wie ein Vulkan waren. Auch nach jahrzehntelanger Ruhe konnte ohne jede Vorwarnung ein Ausbruch erfolgen. Stephan war wie jeder Wengländer überzeugt, dass die Gewalt von Wilzarien ausging, denn Wenglands Könige fingen von sich aus keinen Krieg an, auch wenn sie stets auf Auseinandersetzungen gut vorbereitet waren.
Die Menschen in Aventur hatten sich bisher stets wenglandtreu gezeigt. Sie hatten auch keinen Grund, es nicht zu sein. Die Wilzaren hatten ihre Sprache behalten, den Ortsnamen war nur eine wenglische Übersetzung oder Neubenennung hinzugefügt worden, die auf den Ortsschildern in der wilzarischen Sprachregion ganz bescheiden an zweiter Stelle stand. Der Provinzname war erhalten geblieben, es gab nicht einmal eine Übersetzung ins Wenglische. In der Regel verwendeten die Wengländer die neuen Ortsnamen, die Wilzaren die alten.
Aber es gab Ausnahmen, wie Sandra Habermann bewies. Nicht nur, dass der alte Name Havanor mit Habermann übersetzt war, sie nannte die Hauptstadt der Provinz auch beim wenglischen Namen Christophstein und nicht wilzarisch Silla. Bei Stephan konnte sie sich sprachliche Verrenkungen sparen, denn er war nicht nur tolerant, sondern auch sprachbegabt. Wie jeder wenglische Prinz hatte er Wilzarisch gelernt und sprach mit Sandra in der Sprache, die sie beide gerade bevorzugten.
Das Einzige, was die Wilzaren hatten aufgeben müssen, war ihr Glaube. Eigentlich war Wengland ein tolerantes Land, in dem jeder glauben konnte, was er wollte, aber bei Teufelsanbetung hörte diese Toleranz auf. Gerade unter König Ranador war die Teufelsanbetung das hauptsächliche Bekenntnis in Wilzarien gewesen, der Urglaube an die nordischen Götter schon zur verschwindenden Minderheit geworden. Nachdem den Wilzaren in Aventur die Ausübung ihres Teufelsrituals bei Todesstrafe verboten worden war, hatte König Sevur, Ranadors Nachfolger, seinerseits die christlichen Riten unter Todesstrafe gestellt.
Stephan lehnte sich zurück und schloss die Augen. In der zentralwenglischen Ebene zwischen Ahrenstein und Wutzbach versäumte er ohnehin nichts und gab sich lieber verliebten Träumen von Sandra Habermann hin.
In Wutzbach wurde die Abteiltür aufgerissen und ein weiterer Passagier stieg zu. Es war ein junger Mann, etwa im gleichen Alter wie Stephan, der ebenso wie der Königssohn die Studentenmütze der Universität Christophstein ohne Stufenstreifen trug, kenntlich an ihrem grünen Mützenbeutel.
„Grüß dich, Kommilitone!“, begrüßte Stephan ihn und machte in dem engen Durchgang Platz.
„Was haben wir miteinander zu schaffen, Mann?“, knurrte der Zugestiegene. Stephan stutzte. Solche Grobheit war er nicht gewohnt, obwohl er sich stets bürgerlich gab und sich noch nie als Sohn des Königs zu erkennen gegeben hatte.
„Ich habe höflich gegrüßt. Ich denke, ich kann eine höfliche Antwort erwarten“, gab er zurück. „Der Mütze nach bist du ein Student. Unter Studenten ist dieser Gruß üblich. Bist du kein Student, dann gib dich nicht als solcher aus!“, wies er den Grobian zurecht.
„Weißt du überhaupt, mit wem du es zu tun hast?“, fauchte der andere. „Ich bin Rupert, Erbgraf von Limmenfels. Also, zeig mehr Ehrfurcht!“
Stephan lachte fröhlich auf.
„Ach so, der Herr ist von Adel! Warum tragt Ihr Euer Wappen nicht im Schilde, edler Erbgraf? Beinahe hätte ich Euch für meinesgleichen gehalten.“
Rupert ahnte nicht einmal, wie doppeldeutig Stephans lachende Antwort war.
„Auch wenn ich II. Klasse reise, heißt das nicht, dass ich zweiter Klasse bin!“, versetzte der Erbgraf hochnäsig.
„Nein, Sie benehmen sich drittklassig, Herr von Limmenfels!“, schnaubte Stephan. „Von einem Adligen erwarte ich, dass er sich adlig benimmt – und das tun Sie wahrhaftig nicht!“
„Gib Acht, was du sagst, Lümmel, sonst lasse ich dich verhaften!“
„Den Tatbestand der Majestätsbeleidigung hat es in Wengland mindestens seit der Einführung des Codex Rex Wenglandia im Jahre 1265 nicht gegeben, geschweige denn den Straftatbestand der Erbgrafenbeleidigung. Aber Sie sollten es lassen, mich Lümmel zu nennen. Mein Name ist Steiner, Stephan Steiner aus Steinburg.“
„Dein Name tut nichts zur Sache. Für mich bleibst du ein Lümmel, wenn auch aus der Hauptstadt. Dann eben ein Hauptstadt-Lümmel.“
„Na schön, dann bist du der Provinz-Lümmel!“, grinste Stephan. „Wie du mir, so ich dir …“
Rupert lief puterrot an und wollte auf Stephan losgehen, als der Schaffner an der Durchgangsseite des Wagens in das Abteil trat. Der seitliche Durchgang vor den Abteilen durch die Personenwagen war eine Besonderheit, die andere Bahngesellschaften (noch) nicht hatten.
„In Wutzbach noch jemand zugestiegen?“, fragte er und sah den Neuankömmling im Abteil deutlich an. Rupert setzte sich wieder, machte aber keine Anstalten, seine Fahrkarte vorzuzeigen.
„Ihre Fahrkarte bitte, mein Herr!“, forderte der Schaffner ihn auf.
„Wie reden Sie überhaupt mit mir?“, entfuhr es von Limmenfels.
„Wie mit jedem Fahrgast. Ihre Fahrkarte, bitte!“
Rupert verschränkte die Arme.
„Ein gewöhnlicher Beamter hat wohl kaum ein Recht, den Erbgrafen von Limmenfels nach irgendeinem Ausweis zu fragen!“
Der Beamte holte tief Luft, doch bevor er etwas sagen konnte, schaltete sich Stephan ein.
„Hör mal, du Provinz-Lümmel: In dieser Bahn hat nicht mal König Alexander selbst freie Passage! Also rück’ deine Fahrkarte raus oder ich befördere dich an die frische Luft!“
Das war so scharf und befehlend vorgetragen, dass Ruperts kunstvolle Adelsfigur zusammenbrach. Er saß mit offenem Mund da.
„Der Beamte hat nicht nur das Recht, sondern die beeidete Pflicht, deine Fahrkarte zu kontrollieren! Also?“, setzte der Prinz grollend hinzu. Von Limmenfels machte große Augen und gestand dann kleinlaut ein, keine Fahrkarte zu haben. Der Beamte nickte, zog seinen Fahrkartenblock, den Kopierstift und leckte daran.
„Bis wohin wollen Sie?“, fragte er.
„Was geht Sie das …“, setzte er an, aber die vernichtenden Blicke Stephans und des Schaffners bremsten ihn.
„Christophstein“, sagte er leise. Der Schaffner nickte und schrieb die Fahrkarte aus.
„Macht sechzig Gulden für die einfache Fahrt und dreißig Gulden wegen Schwarzfahrens.“
„Aber ich will doch zahlen!“, protestierte Rupert.
„Ein bisschen spät, mein Herr. Hätten Sie mir das gleich gesagt, hätten Sie lediglich zwei Gulden Zugaufpreis bezahlt.“
„Ich zahle die Strafe nicht!“
„In dem Fall …“, grinste der Schaffner, drehte sich um und zog die Notbremse. Der Zug kam mit blockierenden Rädern rutschend zum Stillstand.
„Raus!“, fauchte der Schaffner, packte Rupert beim Schlafittchen und beförderte ihn samt Gepäck unsanft aus dem Zug.
„Drei Kilometer in Fahrtrichtung ist die Station Meisenwies. Von dort verkehrt täglich der Personenzug nach Christophstein. Aber bezahlen Sie lieber freiwillig vor Fahrtantritt, sonst bekommen Sie Ärger mit der Polizei!“, rief der Schaffner ihm nach, löste die Bremse, gab dem Lokführer ein Zeichen, bevor Rupert sich wieder aufgerappelt hatte. Der Zug fuhr an und ließ einen völlig verdatterten Erbgrafen von Limmenfels zurück.
Der Schaffner ließ ihn nicht aus den Augen bis der Zug so viel Geschwindigkeit aufgenommen hatte, dass der Mann nicht mehr aufspringen konnte.
„Erleben Sie so etwas häufiger?“, fragte Stephan.
„Immer wenn Adlige aus Limmenfels in Wutzbach zusteigen. Graf Thorwald soll es so gewurmt haben, dass die Schnellzugstrecke Steinburg – Christophstein nicht über Limmenfels gebaut wurde, dass er und seine Familie sich grundsätzlich weigern, eine Fahrkarte zu kaufen. Gestern habe ich grad des Herrn Grafen Großmutter in Meisenwies ausgesetzt.“
„Nein, wie hartherzig!“, empörte sich Stephan gespielt. Der Schaffner wollte aufbegehren, aber er sah in Stephans lachendes Gesicht und merkte, dass der junge Mann es nicht ernst meinte.
„Vielleicht sollte die Königlich Wenglische Eisenbahn von ihren aufmerksamen Schaffnern und zahlungsunwilligen Kunden erfahren. Wie ist Ihr Name?“, fragte der Prinz.
„Habermann, Udo Habermann aus Silla“, erwiderte der Schaffner und sah, dass Stephan sich den Namen notierte.
„Was haben Sie vor?“, fragte er dann.
„Ich werde jemandem, dem die Bahn sehr am Herzen liegt, berichten, wie ein pflichtbewusster Schaffner aus Aventur die Rechte des Königs wahrt, Herr Habermann.“
„Und wen wollen Sie unterrichten?“
„Den König.“
„Sie … Sie kennen unseren König?“
„Ja, er hat mir Stunden in Vermessungstechnik gegeben“, erwiderte der Königssohn.
„Ich habe gehört, unser König Alexander sei ein freundlicher Mann, der auf die Sorgen seines Volkes hört.“
„Das ist er“, bestätigte Stephan.
„Ob es wohl möglich wäre, dass ich ihn irgendwann mal persönlich treffen könnte? Ich bin zwar wilzarischer Abstammung, aber mein Herz schlägt einfach wenglisch.“
„Das kann ich nicht versprechen, aber ich werde es mit erwähnen. Sagen Sie, Herr Habermann, haben Sie vielleicht eine Tochter mit Namen Sandra?“
Habermann zuckte zusammen.
„Nein, aber eine Nichte. Sie wohnt bei mir. Wieso?“
„Oh, wir kennen uns gut …“
„Dann müssen Sie der Oberleutnant Steiner vom Gardepionierregiment sein“, mutmaßte der Schaffner.
„Das war ich“, lächelte Stephan. „Jetzt bin ich kein Soldat mehr. Ich will in Christophstein studieren.“
„Sandra hat sehr von Ihnen geschwärmt. Meine Frau und ich hätten noch ein Zimmer frei. Sind Sie interessiert?“
„Oh, gern. Kommt aber drauf an, was es kosten soll. Ich muss mir die Miete durch Gelegenheitsarbeiten verdienen.“
„Das lässt sich sicher regeln, Herr Steiner. Bisher haben wir fünf Gulden die Woche genommen.“
„Donnerwetter, haben Sie Tarife in Christophstein!“, entfuhr es dem jungen Mann. „Ich glaube, ich hätte doch in Wachtelberg studieren sollen … Drei Gulden wären normal.“
Schaffner Habermann zwinkerte
„Sie wissen Bescheid, Herr Steiner. Für Sie Vorzugspreis zweifünfzig.“
„Topp, abgemacht!“, bestätigte Habermann den Handel.
Am Abend rollte der Zug in den Hauptbahnhof von Christophstein ein. Stephan stieg aus und wartete, dass die Menschenmenge sich etwas verzog.
„Warten Sie, Herr Steiner!“, hörte er jemanden rufen. Er drehte sich um und sah den Schaffner vom Zug her winken. Er blieb stehen. Der Schaffner stieg aus, ging am Zug entlang und schloss die Türen. Dann gab er dem Lokführer ein Zeichen, dass alles gesichert war. Der Zug rollte langsam aus dem Bahnhof auf das Vorfeld.
„Sie sagten doch, dass Sie Ihr Studium mit Gelegenheitsarbeit finanzieren wollen, oder?“, fragte er.
„Ja.“
„Die Bahn sucht manchmal Mitarbeiter auf Zeit, beim Bahnbau zum Beispiel. Sie sehen kräftig aus. Schwellenlegen könnte etwas für Sie sein. Soll ich mich mal umhören?“
„Wäre nicht zu verachten. Wer weiß, ob ich später nicht sogar für die Bahn arbeiten werde. Da schadet es nicht, sich das mal von unten anzusehen.“
„Sehr vernünftige Ansicht. Es heißt, unser König hätte als junger Mann auch für die Bahn gearbeitet“, bemerkte Habermann. Stephan lächelte.
„Oh, das ist keine Sage, Herr Habermann. König Alexander vermisst noch immer für die KWE, wenn er Zeit hat“, erwiderte er.
„Woher wissen Sie das so genau?“
„Zum einen ist es in Steinburg kein Geheimnis, zum anderen gibt es im Königlichen Vermessungsamt in Steinburg mindestens fünfzig Karten neueren Datums, auf denen als Zeichner Alexander von Steinburg dokumentiert ist. Wenn er arbeitet, benutzt er immer noch sein altes Alias.“
„Lernt man so was in der Schule?“
„Nein, im Probesemester in Steinburg – und bei den Fürst-Wolf-Pionieren.“
„Ach ja, Sie waren ja bei den Gardepionieren …“, fiel es Udo Habermann wieder ein.
Wenig später hatten Sie das Haus in der Bahnhofstraße erreicht. Habermann klopfte und eine ältere Frau öffnete.
„Guten Abend, Maria“, sagte der Schaffner und umarmte seine Frau.
„Guten Abend, Liebling. Sag, wer ist der junge Herr?“
„Das ist unser neuer Mieter, Herr Stephan Steiner aus Steinburg. Ich habe ihm unsere Studentenbude vermietet“, erklärte Habermann.
„Sehr schön, kommen Sie, Herr Steiner.“
Stephan nahm die Studentenmütze ab, verbeugte sich höflich und putzte sich ordentlich die Schuhe ab, als er eintrat. Seine Vermieter nahmen sein höfliches Benehmen angenehm überrascht zur Kenntnis.
Eine gute Stunde später hatte Maria Habermann Stephan sein Zimmer gezeigt, ihm erklärt, wo er seine Habseligkeiten lassen konnte – und dass sie es mit der wenglischen Tradition hielten, nach der Damenbesuch bei Mietern von Studentenbuden nicht erwünscht war. Stephan bestätigte dies, obwohl ihm klar war, dass es ihm schwerfallen würde, sich daran zu halten, wenn Sandra im gleichen Hause wohnte …
„Ach so, noch etwas:“, sagte Frau Habermann. „Meine Nichte wohnt hier gleichfalls. Sie ist die Tochter eines einflussreichen Mannes. Lassen Sie also die Finger von ihr!“, mahnte sie.
„Ich werde mir alle Mühe geben, Frau Habermann“, versprach Stephan.
„Wenn Sie das nicht garantieren können, dann muss ich den Vertrag für nichtig erklären“, warnte sie. Stephan sah sie lange an.
„Frau Habermann, ich bin mit Ihrer Nichte befreundet“, sagte er dann langsam. „Es war purer Zufall, dass Ihr Mann mir das Zimmer anbot, und ich wäre sehr daran interessiert, zumal es meinen schmalen Geldbeutel schonen würde. Aber ich kann keine Versprechen abgeben, die ich nicht halten kann.“
Maria Habermann lief bereits rot an, als unten die Haustür geöffnet wurde und Schaffner Habermann seine Nichte begrüßte.
„Tante, ich bin wieder da!“ rief sie hinauf. Frau Habermann schnaufte heftig, ging die Treppe hinunter; Stephan stellte seinen Koffer ab und folgte ihr in einem gewissen Abstand. Er hielt sich aber zunächst im Hintergrund, hörte, wie Sandra fröhlich von ihrem Tag berichtete. Plötzlich stockte sie, als sie eine Gestalt im Dunkel hinter ihrer Tante bemerkte. Er trat ins Licht.
„Stephan?“, fragte sie verblüfft. Er nickte nur, sie sprang die drei Stufen zu ihm hinauf und fiel ihm vor Freude weinend um den Hals.
„Ich bin so froh, dich wiederzuhaben, Stephan!“, jubelte sie unter Freudentränen.
„Ich auch, mein Kleines“, erwiderte er, tief berührt von ihrem überschwänglichen Empfang.
„Sag, wo wohnst du?“, erkundigte sie sich. Die Eheleute Habermann sahen sich mit stummem Seufzen an.
„Na ja, eigentlich …“, setzte er an, aber Sandra ließ ihn nicht zu Wort kommen.
„Du bleibst hier!“, entschied sie. Er legte ihr vorsichtig den Zeigefinger an die rosigen Lippen.
„Sandra, mein Schatz, ich habe mich hier eingemietet und bereits gegen den Mietvertrag verstoßen, weil ich die Finger von dir lassen soll.“
Sie sah lange in seine warmen, braunen Augen, deren sanften Blick sie so schmerzlich vermisst hatte. Dann drehte sie sich zu ihren Verwandten um.
„Onkel Udo, du weißt doch, dass ich mit Stephan befreundet bin. Außerdem hatte ich mit Tante Maria schon geklärt, dass Stephan hier wohnen kann, falls er hier studiert“, rotestierte sie.
„Sandra, wir sind deinem Vater für dich verantwortlich“, erinnerte Schaffner Habermann.
„Ach was!“, widersprach sie heftig. „Ich bin volljährig. Papa ist sonst auch nicht so kleinlich!“
„Wir wollen keinen Ärger mit deinem Vater haben, falls etwas passiert“, warnte ihre Tante.
„Den werdet ihr nicht haben. Das garantiere ich euch“, erwiderte sie überzeugt. Ihre Worte wirkten offenbar Wunder, denn Habermanns nickten.
„Nun gut, wenn Sandra uns garantiert, dass ihr Vater nichts dagegen hat, dann gilt der Mietvertrag natürlich, Herr Steiner“, bestätigte Udo Habermann den Vertrag.
Kapitel 3
Aufstand der Milchbauern
Der warme Sommer des Jahres 1897 ließ die Weiden üppig sprießen. In Aventur schien das Gras immer noch ein bisschen grüner und schmackhafter zu sein, als anderswo. Die im Osten bis auf eine Höhe von fast zweitausend Meter aufragenden Gipfel des Aventurgebirges zwangen die meist von Westen her kommenden Luftmassen zum Aufsteigen, wobei sie zu Wolken kondensierten, die im welligen Vorland des Aventurgebirges abregneten und dort für die so besonders saftigen und kräuterreichen Weiden sorgten. Aventur war die Gegend für Milchbauern, weshalb die Provinz auch gern „Milchkanne Wenglands“ genannt wurde. Von hier kamen Wenglands beste Milch, die wohlschmeckendste Butter und der sahnigste Käse.
Die allerbesten Weidegründe lagen am Ostrand der Provinz, nur wenige Kilometer vor der eigentlichen Staatsgrenze, die sich über die unzugänglichsten Gipfel der Aventurberge zog. Gebirgskräuter wie Enzian durchsetzten die Almwiesen oberhalb von Rosenbach, das, obwohl es ein Bauerndorf von kaum sechshundert Einwohnern war, mit seiner Genossenschaftsmeierei geradezu als Milchhauptstadt Wenglands galt. Die Bauerngenossenschaft Aventur/Region Ost hatte in Rosenbach eine Niederlassung, die die örtliche Milch verarbeitete. Die Zentrale dieser Genossenschaft war in Christophstein, das gute siebzig Kilometer weiter westlich lag – ziemlich genau dort, wo die von Osten aus dem Gebirge herunterfließenden Flüsse Silvanur und Osteraventur mit den aus dem Süden kommenden Flüssen Aventur und Sillanur die Sprachgrenze zwischen Wilzarisch und Wenglisch markierten.
Und genau darin lag das Problem, jedenfalls für die Rosenbacher Bauern. Die Milchbauern von Rosenbach waren stockkonservative Wilzaren, die meist stur bei ihrer Sprache blieben und grundsätzlich nur den wilzarischen Namen Seleria für ihr Dorf benutzten, während die Genossenschaftszentrale in Christophstein eher wenglisch dominiert war.
Seit dem Frühjahr 1897 gärte es unter den Bauern, die dank ihrer hervorragenden Milchqualität wohlhabend geworden waren. In der Bauerngenossenschaft hatte es im März einen Führungswechsel gegeben. Der langjährige Regionalvogt der Genossenschaft, Mila Valadin, war siebzig Jahre alt geworden und hatte damit die von der Mehrheit der Genossenschaftsmitglieder einige Jahre zuvor beschlossene Altersgrenze für diesen Posten erreicht. Valadin stammte aus Rosenbach, war dort auch seit gut dreißig Jahren Bürgermeister. Er gehörte damit zu den letzten Bürgermeistern in Wengland, die noch von den Provinzgrafen eingesetzt worden waren. Die meisten eingesetzten Gemeindeoberhäupter waren bei den ersten demokratischen Wahlen 1885 auf Gemeindeebene abgewählt worden, Valadin dagegen war von seinen Rosenbachern nahezu einstimmig im Amt bestätigt worden und seither immer wiedergewählt worden. Auch bei der Genossenschaft hatte er keine Konkurrenz gehabt, weshalb die Bauern im Aventurgebirge eigentlich angenommen hatten, dass Valadin trotz der beschlossenen Altersgrenze angesichts einer fehlenden Alternative weitermachen würde.
Nachdem sich kein Wilzare aus der Bergregion gefunden hatte, der Valadins Nachfolger werden wollte, hatte der Obervogt der Genossenschaftszentrale in Christophstein, Herrmann Bauernfeind, außerhalb der Bergregion nach Bewerbern für den verantwortungsvollen Posten gesucht und mit Gilbert de Restignac auch jemanden gefunden.
De Restignac war der Spross der alten französischen Adelsfamilie Ibelin, die mit der wenglischen Königsfamilie verwandt war und seit 1195 in Wengland und seit über zweihundertfünfzig Jahren auch in Aventur ansässig war. Nachdem Bauernfeind den regionalen Mitgliedern der Genossenschaft de Restignac als Kandidaten für die Nachfolge Valadins vorgestellt hatte, hatten sich die Rosenbacher vehement gegen einen Wengländer als neuen Regionalvogt ausgesprochen.
Obervogt Bauernfeind hatte den Wilzaren der Region eine letzte Frist gesetzt, in der sich einer der ihren als Nachfolger bereit erklären sollte, doch es hatte sich keiner gefunden. So war es Ende März zur Wahl des einzigen Kandidaten für diesen Posten gekommen. Die Wengländer in der Genossenschaft hatten Gilbert de Restignac einstimmig zum Regionalvogt Ost gewählt, aber die Wilzaren in der Genossenschaft hatten ihm komplett die Gefolgschaft verweigert. Nur die Tatsache, dass die Wengländer in der Genossenschaftsregion eine kleine Mehrheit hatten, hatte seine Wahl überhaupt möglich gemacht.
Schon bald fühlten sich die Wilzaren in ihrer Ablehnung eines Wengländers als örtlichen Vogt der Bauerngenossenschaft bestätigt. Mila Valadin hatte sich stets dafür eingesetzt, dass die Bergbauern von Rosenbach ein höheres Milchgeld erhielten als die Bauern im Hügelland um Christophstein und Buchhausen oder in der Ebene bei Rothenfels. Er hatte dies immer mit der besseren Qualität der Milch begründet und war damit in der Regel auch auf Gehör bei den anderen Regionalvögten und den Handelspartnern der Genossenschaft gestoßen. Der Milchpreis wurde jedoch von Jahr zu Jahr neu ausgehandelt, schließlich war nicht jedes Jahr gleich, was Ernte und Weidebewuchs betraf.
In diesem Jahr waren die Bauern der anderen Regionen Aventurs aber ebenso vom Wetter verwöhnt wie die Bergbauern – und die Genossenschaftsmitglieder außerhalb der Bergregion sahen keinen Grund, sich in Sachen Milchgeld zu bescheiden und ihre Milch weiterhin für fünf Heller den Liter zu verkaufen, wenn die Wilzaren in den Bergen sieben Heller bekamen und es – jedenfalls in diesem Jahr – keinen Qualitätsunterschied gab.
Gilbert de Restignac kämpfte für die Pfründe der Bauern, die er vertrat, aber alle Argumente, die er vorbringen konnte – von besserer Milchqualität über besseren Geschmack bis hin zu höherem Arbeitsaufwand im Gebirge – wischten die anderen Vertreter vom Tisch. In Qualität und Geschmack bestand kein Unterschied, und den höheren Arbeitsaufwand der Bergbauern wiesen die anderen Regionalvögte mit dem Hinweis auf andere Probleme wie steinige oder schlammige Böden, Überschwemmungs- oder Dürrerisiko bei ihren Bauern zurück.
Die Regionalversammlung der Bergbauern in Rosenbach, die Gilbert de Restignac am 15. August 1897 einberief, um mit den Bauern zu beraten, ob man sich von der Zentralgenossenschaft trennen wollte, um Milch, Butter und Käse künftig selbst direkt zu verkaufen, endete in einem Eklat. Die wilzarischen Bergbauern gaben Gilbert die Schuld daran, dass sie in diesem Jahr kein höheres Milchgeld bekamen als die Bauern der anderen drei Regionen, warfen ihm vor, sie nicht gut genug vertreten zu haben, weil sie eben bekennende Wilzaren wären, jagten ihn mit Steinen, faulen Eiern und Dreschflegelschlägen aus Rosenbach fort und drohten ihm an, ihn aufzuknüpfen, wenn er sich je wieder im Umkreis von Seleria sehen lassen sollte.
Avnor Valadin, Mila Valadins Neffe, sprang auf den Tisch im Rosenbacher Gasthaus Schwarzer Drache, in dem das Treffen stattgefunden hatte.
„Es reicht jetzt! Wir lassen uns von diesen verdammten Wengländern nicht länger bevormunden! Gründen wir unsere eigene Genossenschaft und übernehmen die Meierei!“
Sein Onkel hob die Hand.
„Das wird nicht ohne Ärger abgehen, mein Junge!“, sagte Mila Valadin ruhig.
„Wieso, Onkel?“
„Weil die Meierei Eigentum der Bauerngenossenschaft ist. Wenn wir die Meierei der Genossenschaft wegnehmen, ist das Raub – und das wird Folgen haben.“
„Das ist mir so was von egal, Onkel! Wir sind weitab von Christophstein! Wir übernehmen die Meierei und verkaufen unsere Milch direkt!“
„Du weißt, dass die Händler verpflichtet sind, nur von den staatlich anerkannten Genossenschaften zu kaufen?“, fragte Mila weiter.
„Dann wird es Zeit, dass wir Wilzaren uns gerade machen und die staatliche Anerkennung erwirken!“, grollte Avnor. „Ich reise gleich morgen durch die Dörfer und Städte und versuche, direkte Abnehmer für unsere Milch zu finden. Ich verkaufe jedenfalls keinen Tropfen Milch mehr an die Wengländer-Genossenschaft! Und wenn ich sie weggieße!“
Avnor begann tatsächlich am nächsten Tag seine Rundreise durch die östlichen Dörfer und Städte wie Katzenwald, Waldsitten und Osteraventwald, sprach in jedem einzelnen Milchgeschäft den Inhaber an.
„Und welchen Preis stellen Sie sich vor, Herr Valadin?“, fragte gleich der Erste.
„Wir hatten an zehn Heller pro Liter gedacht.“
Der Händler dachte einen Moment nach. Die Bauerngenossenschaft verkaufte ihre Milchprodukte für fünfzehn Heller, Erzeugnisse aus Rosenbach sogar für zwanzig Heller. Dieses Jahr hatte die Genossenschaftsmeierei den Preis für alle Meiereiprodukte um fünf Heller erhöht und dem Preis der Rosenbacher Spezialitäten angepasst. Die Direktvermarktung der Rosenbacher bot die Chance, den unzufriedenen Kunden mindestens gleiche Qualität für einen geringeren Preis zu bieten …
„Das ist ein guter Preis. Ab wann können Sie liefern?“, fragte schon der erste Händler.
„Nun, wir sind noch im Aufbau, aber ich denke, sobald wir geklärt haben, wie wir die Milch gekühlt nach Silla bringen können, werden wir mit den Lieferungen beginnen können“, erklärte Avnor. Der Händler nickte und Avnor setzte seinen Weg fort.
Der Zuspruch der Händler war groß, obwohl Valadin noch keinen genauen Termin für den Lieferbeginn nennen konnte. Der Rosenbacher hatte für das Kühlproblem auch schon eine Idee und besuchte auch die örtliche Brauerei. Die Brauereien lagerten für die Kühlung ihrer Produkte im Winter Eis ein, das sie in Eiskellern aufbewahrten und auch an Privatleute verkauften. Avnor Valadin konnte mit der Christophsteiner Landbrauerei einen Vertrag abschließen, nach dem die Brauerei einmal pro Woche einen Wagen Eis nach Rosenbach schickte, sofern die Lieferung abgefordert wurde.
Am selben Tag trafen sich die jeweiligen Mitglieder der Handelsgilde Aventur der Gemeinden, die Valadin besucht hatte, die sich sehr schnell einig waren, das Angebot der Rosenbacher Milchbauern anzunehmen. Jetzt war nur noch die Frage, ab wann die Rosenbacher liefern würden.
Der nächste Schritt der grantigen Milchbauern nach Valadins Rückkehr zehn Tage nach seinem Aufbruch war die Übernahme der Rosenbacher Filiale der Genossenschaftsmeierei, die nicht ohne Rauferei abging. Der Milchmeister und einige wenglische Angestellte wurden wie der gewählte Regionalvogt mit Schimpf und Schande aus dem Tal gejagt, der Milchmeister selbst dabei verletzt. Den Weg in ihr Hochtal sperrten die Rosenbacher ab, um zu verhindern, dass die wenglischen Betreiber der Meierei zurückkehrten. Dann demontierten sie das zweisprachige Ortsschild und ersetzten es durch eines, das nur die wilzarische Bezeichnung Seleria trug.
Die verjagten Angestellten der Meierei flohen eilig nach Katzenwald, der nordwestlich des Tales gelegenen Kreisstadt, zu deren Landkreis Rosenbach gehörte. Sie erreichten die Kreisstadt in der Abenddämmerung und wandten sich sofort an die Polizei. Der diensthabende Wachtmeister der Berggrenzpolizei nahm die Anzeige auf und sagte zu, dass am kommenden Morgen eine Abteilung Polizei nach Rosenbach reiten würde, um den Inhabern der Meierei ihr Recht zu verschaffen.
Als die berittenen Polizisten am nächsten Morgen durch den Bergwald in das Hochtal von Rosenbach ritten, wurden sie mit Gewehrschüssen empfangen. Drei der zehn Polizisten wurden getötet, drei weitere verwundet. Die anderen vier konnten das Feuer zwar erwidern, aber die berittene Polizei war grundsätzlich nur mit Faustfeuerwaffen ausgerüstet, die allenfalls sechs bis acht Schuss Munition hatten. Hinhaltend das Feuer erwidernd mussten die Polizisten sich zurückziehen, konnten aber die Verwundeten und die Toten mitnehmen.
Die Männer aus Seleria jubelten und riefen den Polizisten noch Schmähungen nach. Mila Valadin kam als Erster wieder zur Besinnung.
„Sie werden wiederkommen – und in größerer Zahl. Wir müssen uns vorbereiten!“, rief er. Bis auf wenige Männer, die mit Repetiergewehren ausgerüstet die Straße nach Katzenwald bewachten, versammelten sich die Bauern im Schwarzen Drachen und beratschlagten ihr weiteres Vorgehen. Ein Teil von ihnen sollte sich um die Meierei kümmern und die Milch verarbeiten, ein anderer Teil übernahm die Versorgung und das Melken der Kühe, ein dritter Teil sollte für die Sicherheit des Ortes sorgen. Dafür bekamen sie alle Waffen, die im Ort vorhanden waren.
Mila Valadin jr., der Enkel des Bürgermeisters, war jetzt zweiundzwanzig Jahre alt und galt als ein begeisterter Bergsteiger. Er erklärte sich bereit, über die Berge nach Wilzarien in die Provinz Bonat zu gehen, um den Fürsten von Bonat um Hilfe für die Aventurer Wilzaren zu bitten.
Mila jr. machte sich im Morgengrauen des folgenden Tages auf den gefährlichen Weg über die schroffen Berge. Er hatte für drei Tage Proviant und Wasser bei sich. Diese Vorräte würden wohl reichen, bis er nach Ikarnur kam, der Hauptstadt der an Aventur angrenzenden wilzarischen Provinz Bonat.
Während der junge Mann auf dem Weg war, verteidigten die Männer der Bauernwehr beide Zugänge zu ihrem Ort verbissen gegen eilig herangerufene Soldaten aus Katzenwald, wo ein Bataillon Gebirgsjäger der wenglischen Armee stationiert war. Die Katzenwalder Polizeiführung hatte Graf Albert von Aventur informiert, der die Angelegenheit aber möglichst unauffällig bereinigen wollte und darauf verzichtete, das Kriegsministerium in Steinburg ebenfalls in Kenntnis zu setzen. Nicht einmal der Befehlshaber der für Aventur zuständigen Ostarmee, General Hubert von Limmenfels, erhielt eine Nachricht darüber, dass ihm unterstehende Soldaten gegen die Einwohner des Ortes Rosenbach eingesetzt waren. Nachdem die Soldaten unter dem Befehl von Major Edgar Engelmann es nicht fertig brachten, überhaupt nach Rosenbach einzudringen, weil die störrischen Bauern ihr Dorf ringsum gut gesichert hatten, war es den eingeweihten Militärs auch mehr als nur peinlich, einzugestehen, dass eine Handvoll bockiger Hinterwäldler ein gut ausgerüstetes und ausgebildetes Gebirgsjägerbataillon an der Nase herumführte.
Mila Valadin jr. erreichte drei Tage nach seinem Aufbruch unangefochten Ikarnur. Zwar konnte er nicht direkt beim Fürsten vorsprechen, aber dessen Militärgouverneur sagte Valadin zu, den Fürsten augenblicklich darüber zu unterrichten, dass in Aventur Wilzaren drangsaliert würden.
Fürst Gobur von Bonat schmunzelte vergnügt vor sich hin, als er das Telegramm seines Generals in den Händen hielt.
„Loki ist mit uns!“, frohlockte er, als er seinen Generalstab nur vierundzwanzig Stunden nach Erhalt der Botschaft aus Aventur versammelt hatte. „Das Milchbauerndorf Seleria probt den Aufstand gegen die wenglische Genossenschaft, hat die Meierei gewaltsam übernommen und verteidigt sich jetzt gegen Polizei und Militär der Wengländer. Oberst Sigram, Ihre Bergtruppen werden den Leuten aus Seleria helfen, ihr Dorf zu halten! Sie gehen mit dem Boten aus Seleria über die Berge und schützen dieses Dorf gegen alles, was die Wengländer anstellen!“
„Jawohl, mein Fürst!“, bestätigte Sigram. Oberst Malun, der Chef des Bonater Geheimdienstes, meldete sich zu Wort.
„Malun?“
„Mein Fürst, wäre das nicht eine gute Gelegenheit, Aventur wieder heim nach Wilzarien zu holen?“
„Im Prinzip ja, aber wir haben uns schon so oft eine blutige Nase geholt, dass ich nicht annehme, andere Fürsten dazu zu bringen, ihre Soldaten gegen Aventur marschieren zu lassen. Die gut fünftausend Soldaten, die Wengland in Aventur hat, sind Gebirgsspezialisten, erstklassige Pioniere und kampferprobte Männer, die bisher in jedem Kampf die Oberhand behalten haben“, gab Fürst Gobur zu bedenken. Malun lächelte kühl.
„Mein Fürst, diesmal werden wir es schlauer anfangen. Wenn Aventur an Wilzarien fällt, ist Euch die Krone sicher. Seine Majestät hat kein Interesse an Aventur, will es angeblich sogar endgültig aufgeben. Ich hätte da eine Idee …“
Malun trug einen Plan vor, der die Gesichter der anderen Anwesenden erstrahlen ließ. In der Tat: Der kleine Aufstand, den die Milchbauern da machten, war die beste Gelegenheit, den wilzarischen Teil der Bevölkerung Aventurs auf die Seite Wilzariens zu ziehen. Man musste es ihnen nur schmackhaft machen … Das Konzept, das Geheimdienstoberst Devilir Malun schon fertig ausgearbeitet hatte, war narrensicher, zumal darin auch ein Vorschlag enthalten war, wie man das wenglische Militär von einem Eingreifen abhalten konnte. Fürst Gobur von Bonat lächelte warm.
„Das ist ein sehr guter Plan, Oberst Malun. Führen Sie ihn aus.“
Mila Valadin jr. kehrte eine Woche nach seinem Aufbruch mit einer Verstärkung von dreihundert wilzarischen Soldaten nach Seleria zurück, das über eine Nachschublinie aus Ikarnur mit Waffen und Munition versorgt wurde. Da nur in Katzenwald bekannt war, dass um Rosenbach im Wortsinne gekämpft wurde, die zuständige Polizeibehörde in Katzenwald auch keine provinzweiten Haftbefehle für die Männer von Rosenbach herausgegeben hatte, ahnte außerhalb von Katzenwald und Rosenbach keine Menschenseele, was sich dort im Gebirge tat.
Nur die Milchhändler in in den östlichen Gemeinden Aventurs wunderten sich, weshalb die zugesagten Lieferungen aus Rosenbach ausblieben und die Verkäufer der Brauerei, wieso kein Eis abgefordert wurde. Dort vermutete man jedoch, dass die Bauern erst eine eigene Meierei aufbauen mussten, nachdem sie sich aus der Bauerngenossenschaft zurückgezogen hatten. Da so etwas Zeit brauchte, ersparte man sich Anfragen. Inzwischen verkauften sich die Produkte aus den anderen Regionen dank des guten Sommers immer besser, die erhöhten Preise wurden wegen der verbesserten Qualität auch klaglos akzeptiert. Selbst eine weitere Preiserhöhung im September, ausgelöst durch Verknappung des Angebotes wegen der fehlenden Mengen aus Rosenbach, wurde ohne Beanstandungen hingenommen.
Die Rosenbacher hielten mithilfe der wilzarischen Soldaten durch. Nur wenige in dem Ort registrierten, dass es nur wenige Soldaten des Fürsten in Seleria/Rosenbach gab, die ständig dort waren und dass die meisten nach nur wenigen Tagen ersetzt wurden. Diejenigen, die es gemerkt hatten, unterstellten, dass Fürst Bonat seinen Männern rasch Ruhepausen gönnte, sie damit frisch und motiviert hielt. Wohin die Männer, die in der Regel in Zivil waren, um sich im Falle der Gefangennahme nicht als Soldaten Wilzariens zu verraten, wirklich verschwanden, ahnten die Rosenbacher nicht …
Kapitel 4
Frühjahrsschock
Von all dem hatte außerhalb der beteiligten Orte niemand etwas mitbekommen. Das Leben verlief in den normalen, ruhigen Bahnen, die es seit dem letzten Aventurkrieg nahm.
Stephan von Wengland nahm im Juli 1897 sein Studium auf und galt bald als Semesterprimus, der aber nicht nur schnell verstand, sondern auch half, wenn man ihn um Hilfe bat. Von selbst drängte er sich nicht auf. Oft saßen zehn Kommilitonen in seiner Studentenbude und nahmen Nachhilfeunterricht. Trotz seiner niedrigen Tarife von fünfzig Hellern pro Stunde erwirtschaftete er seinen kompletten Lebensunterhalt allein aus dem Nachhilfeunterricht. Er neigte nicht dazu, sich die Nächte um die Ohren zu schlagen, aber ein gutes Wengländer Dunkel im Schwarzen Eber schräg gegenüber des Habermann’schen Hauses schlug er nicht aus.
Seine Art trug ihm schnell Freunde ein, die ein so verschworener Haufen waren, dass Stephan und seine Freunde sehr schnell als die Christophsteiner Musketiere bekannt wurden. Zu dieser Clique gehörten sowohl Wengländer als auch Wilzaren, sowohl Männer als auch Frauen. Mochte es auch gelegentlich Reibereien zwischen Aventurern der unterschiedlichen Volksgruppen geben – in dieser Gruppe gab es sie nicht. Es waren auch nicht nur Studenten der Vermessungstechnik, sondern auch angehende Mediziner, Juristen und Chemiker dabei. Der Studentenzirkel traf sich jeden Abend in der Wohnung eines anderen Mitglieds. Schon bald kristallisierten sich Paare heraus, wobei Sandra und Stephan den Anfang gemacht hatten.
Die Studenten erlebten eine sorglose Zeit bis … ja, bis eines Abends im März 1898 Wilfried Busch deutlich verspätet zum Zirkel kam, der an diesem Abend bei Carl Fischer stattfand.
„Ha! Willi hat den Pudel!“, jubelte Carl, als Wilfried in der Tür stand. Aber dessen Gesichtsausdruck war so bleich und verstört, dass die Unterhaltung sofort verstummte, als die anderen ihm ins Gesicht sahen.
„He, Willi, was ist mit dir?“, fragte Sandra.
„Wilzaren!“, presste Busch heraus. „Wilzarische Soldaten sind in Aventur einmarschiert!“, keuchte er. Wie auf Kommando sprang die ganze Truppe auf.
„Was faselst du da, Willi?“, fragte Stephan nach.
„Ich fasele nicht, zum Teufel! Mir sind eben ein paar völlig aufgelöste Grenzwächter über den Weg gelaufen; was heißt über den Weg gelaufen? Die haben mich glatt umgefegt! Und mir im Wegrennen zugebrüllt, dass die Wilzaren mal wieder scharf auf Aventur sind!“, rief Wilfried entnervt.
„Großer Gott!“, entfuhr es Stephan. „Was weißt du noch?“
„Reicht das nicht?“
„Nein“, entgegnete Stephan kühl.
„Es … es gibt Gerüchte über wilzarentreue Milizen in Aventur“, ließ Busch die Katze aus dem Sack. Die anwesenden Wilzaren erbleichten.
„Nein!“, stieß Niklas Artenstein hervor. „Die Aventurwilzaren stehen treu zu Wengland!“
„Wer weiß?“, zischte Carl giftig. Stephan bemerkte die aufkommende Wut in Carls Gesicht.
„Halt!“, rief er. „Keine haltlosen Verdächtigungen!“, mahnte er dann. „Aventur geht wirklich verloren, wenn Aventurs Bevölkerung entzweit wird.“
Einen Moment war betretenes Schweigen.
„Ich möchte nicht, dass unsere Freundschaft daran zerbricht, dass wir unterschiedlicher Herkunft sind“, sagte Sandra langsam. „Ich mache euch einen Vorschlag: Wir alle, die wir hier sind, erneuern hier und jetzt unseren alten Schwur und schwören gleichzeitig, Wengland zu schützen. Alle, auch und gerade die Wengländer wilzarischer Abstammung!“
Alle sahen wie gebannt auf Sandra, dann kam Leben in Stephan.
„Carl, hast du ‘ne Bibel?“, fragte er.
„Hältst du mich für einen Heiden?“, erwiderte Carl und nahm seine Bibel aus dem Regal. Alle schworen auf ihre Freundschaft und versprachen, Wengland zu schützen.
„Und wenn es mein Leben kostet – ich verspreche, Aventur als wenglische Provinz zu erhalten!“, setzte Stephan entschlossen hinzu.
„Was hast du vor?“, fragte Carl.
„Ich bin Reservist. Ich werde mich noch heute bei meiner alten Einheit melden“, erklärte Stephan.
„Und wir? Ohne dich sind wir nur die Hälfte wert“, bemerkte Wilfried.
„Wer war Soldat und ist jetzt Reservist?“, fragte Stephan. Außer ihm selbst waren es nur Carl und Niklas, alle anderen hatten erst studieren wollen.
In diesem Moment polterte es unten im Haus, Schüsse fielen, wilzarische Befehle wurden gerufen.
„Teufel, was ist das?“, fragte jemand.
„Der wilzarisch gebrüllte Befehl, das Haus auf den Kopf zu stellen!“, antwortete Stephan. Er öffnete leise die Tür, lauschte und schloss sie genauso leise wieder.
„Los, raus, über den Balkon aufs Nachbarhaus!“, zischte er dann. Seine Kommilitonen sahen ihn ungläubig an.
„Seid ihr schwerhörig?“, fauchte er, als sie nicht gleich reagierten. „Schnappt euch eure Paletots und raus hier!“
Carl löste sich aus der Erstarrung, öffnete die Balkontür und peilte vorsichtig hinaus. Unten war alles ruhig. Stephan kam ebenfalls zum Balkon und sondierte mit Carl vorsichtig die Lage.
„Komm, Willi, du machst den Anfang!“, wies er Busch an. Wilfried stieg auf die Balkonbrüstung, zog sich auf das direkt angrenzende Haus auf das dortige Flachdach. Stephan schickte dann die Mädchen hinterher, die mit Wilfrieds Hilfe das Dach erklommen, dann die jungen Männer. Er selbst verließ als letzter Carls Wohnung.
„Deckung, bevor sie uns sehen!“, wies er die anderen an, als er sich auf das Nachbardach gezogen hatte. Die Köpfe zuckten hinter die Dachkante. Auf dem Balkon unter dem Dach waren Schritte und wilzarische Befehle zu hören. Stephan lugte vorsichtig über die Dachkante. Drei wilzarische Soldaten durchsuchten Carls Wohnung, sahen über die Balkonbrüstung, fanden aber augenscheinlich nicht, wen oder was sie suchten und verließen die Wohnung wieder.
„Mein Gott!“, japste Carl. „Das war knapp!“
„Die Soldaten haben was von durchsuchen gesagt“, erwiderte Stephan mit hörbarem Aufatmen. „Ich fürchte, sie werden wiederkommen.“
Er sah sich im ungewissen Licht um, das von den trüben Straßenlaternen fünfzehn Meter unter ihnen herauf schien. Die knapp zwanzig Studenten kauerten in der Kälte des Märzabends klappernd hinter der Dachbrüstung.
„Wer spricht Wilzarisch?“ fragte er. Außer Carl und Wilfried waren es alle. Stephan nickte.
„Ihr kommt erst einmal mit zu mir. Redet sonst vorläufig nur Wilzarisch, wenn ihr Soldaten über den Weg lauft. Wir treffen uns morgen im Unikeller.“
Alle nickten, dann schlichen sie durch das unbewohnte Haus hinunter.
„Wachen vor der Tür!“, warnte Carl, der als Erster unten ankam.
„Wir gehen durchs Kellerfenster!“, entschied Stephan. Einer nach dem anderen schob sich durch das Oberlicht des Kellers an der Rückseite des Hauses, Stephan diesmal als Erster. Er blieb an der Hausecke stehen und behielt den Posten vor dem Haus über eine Hecke im Auge, während die anderen nach und nach hinter ihm an der Hecke ankamen.
„Wir trennen uns. Bis morgen im Unikeller“, flüsterte er. Schweigend verabschiedeten sie sich voneinander, dann schlüpften sie vorsichtig in den nächsten Hof.
Jede Deckung ausnutzend lotsten Stephan und Sandra Carl und Wilfried durch die Höfe zum Garten des Hauses Habermann. Sandra schlich voran, um die Lage zu erkunden. Sie ging nicht ins Haus hinein, sondern prüfte die Lage versteckt hinter der Vorgartenhecke.
„Ich fasse es nicht!“, keuchte sie, als sie in das Versteck unter der Hofhecke zurückkehrte. „Unsere neuen Nachbarn stehen vor der Tür und haben Waffen in der Hand!“
„Was?“, entfuhr es Stephan.
„Ja, die Hofners. Beide Jungs mit Schrotflinten. Sie tragen schwarz-gelbe Armbinden.“
„Die wilzarischen Landesfarben!“, japste Carl. Stephan nickte.
„Und ich hatte mich so auf mein warmes Bett gefreut!“, seufzte Stephan. „Sie suchen nach mir, nehme ich mal an“, mutmaßte er. Sie nickte.
„Mein Onkel hat sie grade rausgeschmissen. Hat ihnen gesagt, es gäbe keine Wengländer im Haus“, berichtete Sandra, was sie vorne hinter der Hecke gehört hatte. Im fahlen Licht der Gaslaternen, das bis unter die Hecke drang, zeigte sich eine Mischung aus ungläubigem Staunen und Misstrauen auf Stephans Gesicht.
„Ich gehe hinein“, flüsterte Sandra, schlüpfte wieder aus der Hecke und schlich zum Kellerausgang des Hauses, den sie dann aufschloss. Laut und deutlich begrüßte sie ihre Verwandten auf Wilzarisch.
„Traust du ihr wirklich?“, fragte Carl zähneklappernd.
„Im Moment haben wir wohl keine andere Wahl“, erwiderte Stephan flüsternd. Vorne vor dem Haus gingen zwei junge Männer mit den wilzarischen Armbinden vorbei.
„Hatte nicht grad jemand erwähnt, die Aventurwilzaren seien wenglandtreu?“, spottete Wilfried mit bitterem Unterton.
„Der Meinung bin ich grundsätzlich immer noch, aber vielleicht muss ich sie revidieren …“, gestand der Prinz. Dann fiel ihm ein, dass Familie Hofner erst im Februar dieses Jahres im Nebenhaus rechts neben den Habermanns eingezogen war. Er kam nicht mehr dazu, seinen Gedanken laut auszusprechen, als ein Tropfen ihn direkt auf die Nase traf und der Ärger darüber den Gedanken gleich mit wegschwemmte.
„Mist!“, fluchte er. „Regen fehlt uns grad’ noch!“
Er zog den Mantel enger um sich, Wilfried und Carl wickelten sich ebenfalls tiefer in die Kapuzen. Der Regen wurde schnell stärker, aber Sandra kam auch einigermaßen rasch wieder.
„Die Luft ist rein. Die Milizionäre sind weg“, sagte sie leise und winkte ihren Kommilitonen. Stephan hielt sie sanft, aber bestimmt fest.
„Bist du sicher, dass ihr waschechte Wengländer verstecken wollt?“, fragte er.
„Ja, ganz sicher. Wir werden euch nicht ausliefern. Nun kommt schon.“
Habermanns empfingen die Wengländer herzlich.
„Gott sei Dank! Sie sind durchgekommen. Wir haben uns schon große Sorgen gemacht“, atmete Udo Habermann auf.
„Was ist eigentlich los?“, erkundigte sich Stephan, als er sich den Mantel auszog. Maria Habermann nahm ihm und den beiden anderen die nassen Überzieher ab und brachte sie auf den Trockenboden.
„Etwas Schreckliches ist geschehen: Soldaten des Fürsten von Bonat haben Aventur angegriffen. Sie haben Leute nach Aventur eingeschleust, die die Grenzwachen sabotiert haben. Außerdem haben sie die verbliebenen Anhänger der Wilzarenpartei mobilisiert. Das sind zwar keine Massen, aber an den richtigen Stellen eingesetzt, können die wirklich Ärger machen“, erklärte Schaffner Habermann.
„Woher das Wissen?“, fragte Carl.
„Ich habe gerade meinen Dienst beendet und das auf dem Bahnhof erfahren. Die Zugstrecke nach Steinburg ist von hier aus zehn Kilometer vor Rothenfels unterbrochen, die Straßenbrücke ebenfalls. Und obendrein sind sämtliche Telegrafenleitungen nach Wengland gekappt“, sagte Habermann. Stephan nickte. Schlau angefangen …
Zwischen der Provinz Aventur und den altwenglischen Provinzen Südwengland und Eschenfels gab es nur wenige Brücken über den Aventur: die Eisenbahnbrücke bei Rothenfels und zwei Straßenbrücken, eine ebenfalls bei Rothenfels und eine bei Mühlenstedt, knapp zwanzig Kilometer südlich von Rothenfels. Dazwischen gab es nach wie vor allenfalls Furten. In keinem der unendlich vielen Kriege, die Wengland und Wilzarien um Aventur geführt hatten, waren die Wilzaren auf die Idee gekommen, die wenigen Brücken zu sabotieren, um die Wengländer an der Verteidigung ihrer Provinz zu hindern.
„Das heißt im Klartext: Aventur ist komplett von Wengland abgeschnitten, seh’ ich das richtig?“, hakte Stephan nach. Habermann nickte schweigend.
„Irgendwelche Truppen in Sicht?“, fragte Stephan weiter. Der Schaffner schüttelte den Kopf.
„Im Gegenteil: Gestern und vorgestern hatten wir große Truppentransporte aller Einheiten, die in Aventur stationiert sind, zu einem großen Frühjahrsmanöver nach Hirschfeld. Hier sind nur noch die unbedingt notwendigen Rumpfbesatzungen der zehn Kasernen“, sagte er.
„Wenn hier nur noch wenige wenglische Soldaten sind, keine Nachrichten von hier mehr herausdringen und die Brücken zerstört sind, können wir lange auf Hilfe aus Wengland warten. Frage ist: Können die vorhandenen Truppen sich noch sammeln, um von sich aus einen Gegenschlag zu führen?“, überlegte er laut. Allgemeines Schulterzucken der Anwesenden folgte.
„Wie haben die Wilzaren das eigentlich hingekriegt, ohne dass der Geheimdienst was gemerkt hat?“, fragte Wilfried.
„Keine Ahnung“, seufzte Stephan. „Aber ich nehme mal an, dass der Tanz erst richtig losgehen wird, wenn die Truppen vom Manöver zurückkommen und feststellen, dass sämtliche Verbindungen gekappt sind.“
„Sag mal … was wird eigentlich jetzt aus unserem Studium?“, fragte Carl. „Die Drachenanbeter hängen uns doch an den Füßen auf, wenn wir uns in die Uni trauen.“
„Wir machen Folgendes: Du und Willi, ihr bleibt erst einmal hier. Sandra und ich gehen morgen ganz normal zur Vorlesung. Wir werden sehen, ob das bloß ein nächtlicher Spuk ist oder ob es sich zu einer ernsthaften Gefahr auswächst“, erwiderte Stephan.
„Und … wenn Letzteres zutreffen sollte?“, hakte Wilfried nach.
„Dann müssen wir uns was Neues überlegen …“, seufzte der Prinz.
Am folgenden Morgen gingen Sandra und Stephan in Richtung Innenstadt, wo der Campus war, vorsichtshalber aber ohne Studentenmützen. Doch schon an der ersten Straßenecke wurden sie von einem Korporal in wilzarischer Uniform aufgehalten.
„Halt! Stehenbleiben!“, befahl eine herrische Stimme in wilzarischer Sprache. Gehorsam blieben die jungen Leute stehen.
„Ausweise!“, fuhr der Korporal sie an.
„Wie bitte?“, fragte Sandra.
„Ausweiskontrolle!“
Nach kurzem Zögern griff sie in ihre Handtasche und zog einen wilzarischen Reisepass heraus, den sie dem kontrollierenden Korporal gab. Der sah hinein, sah auf die junge Frau, schüttelte den Kopf.
„Was hat eine Wilzarin hier zu suchen?“, fragte der Soldat.
„Ich studiere.“
„Frauen gehören in den Harem oder in die Küche!“, versetzte der Soldat. „Werde dafür sorgen, dass du wieder dahin kommst, wo du hingehörst. Und du?“, grunzte er Stephan an, der in seinen Taschen herum grub und so tat, als ob er seinen Ausweis suchte. Seinen wenglischen Pass, der ihn auch nicht als Stephan Steiner, sondern als Stephan von Wengland auswies, konnte er einem in feindseliger Absicht eingedrungenen Soldaten Wilzariens wohl kaum unter die Nase halten …
„Tut mir Leid, Herr General, den hab’ ich wohl vergessen …“, lächelte er schief.
„Mitkommen! Alle beide!“
„Und wohin?“
„Ins Polizeigefängnis!“
Stephan sah sich unauffällig um. Der Korporal war allein, seinen Dienstrevolver hatte er wieder in die Pistolentasche gesteckt, als er Sandras Ausweis geprüft hatte, weit und breit war niemand zu sehen. Der junge Mann drehte sich um, aber statt gehorsam vorwärts zu gehen, rammte er dem Korporal den Ellenbogen in die Magengrube und versetzte ihm einen saftigen Pferdekuss unter das Kinn, als der Mann wie ein Taschenmesser zusammenklappte. Stephan fing ihn auf und verpasste ihm noch einen Kinnhaken, der ihn endgültig außer Gefecht setzte. Dann schleppte er den Korporal ins Gebüsch und durchsuchte eilig dessen Taschen, ließ dessen Revolver in der eigenen Tasche verschwinden und nahm ihm sämtliche Papiere ab, deren er habhaft werden konnte. Ein Schlüsselbund schien dem Prinzen ebenfalls passable Beute zu sein, die er sich nicht entgehen ließ.
Sandra stand noch wie erstarrt da, als Stephan wieder aus dem Gebüsch auftauchte.
„Los, komm!“, zischte er. Sie erwachte aus ihrer Starre. Eilig verließen sie die Straße, verschwanden in einem gepflasterten Hof, wo sie keine Spuren hinterließen. Doch die Mauern, die den Hof umgaben, waren zu hoch, um sie ohne Hilfsmittel zu überklettern; die drei Türen, die in angrenzende Häuser führten, waren verschlossen. Sandra entdeckte eine Art Brunnenschacht und winkte ihrem Freund. Sie schlüpften in den Schacht.
„Hier werden sie uns bald gefunden haben …“, mutmaßte Stephan, als sie die als Leiter dienenden Eisenkrampen bis zu einer Zwischenstufe des Brunnens hinuntergestiegen waren.
„Oder auch nicht …“, grinste sie und zog einen dicken Busch Kresse beiseite, hinter dem sich ein mannshoher Tunnel auftat. Sie trat hinein.
„Ziemlich dunkel“, sagte sie. Stephan folgte ihr und sortierte die nasse Kresse wieder zurück. Oben wurde es wirklich schnell laut, als bestiefelte Füße die Straße entlang rannten und auf Wilzarisch nach einem Sanitäter gerufen wurde. Die Schritte schwärmten wieder aus, offensichtlich kam auch jemand in den Hof, in dem sich die jungen Leute versteckt hatten.
„Alle Türen verschlossen. Da über die Mauer kommt keiner rüber. Was ist mit dem Brunnen?“
„Keiner drin, Herr Wachtmeister!“
„Wir sollten uns besser dünn machen“, murmelte Stephan, fingerte aus seiner Tasche Streichhölzer, riss eines an der rauen Tunnelwand an. Auf dem Boden lagen einige dicke Tonscherben herum, die wie Reste zerschlagener Dachziegel aussahen. Von der Decke des Tunnels hingen trockene Pflanzenwurzeln herunter, Stephan rupfte einige davon ab, tat sie auf einen Ziegelrest und zündete sie mit dem Streichholz an. Die brennenden Wurzeln gaben genügend Licht, so dass sie durch den Tunnel weitergehen konnten. Nach wenigen Metern kamen sie an eine Verzweigung, die rechts abging, aber schon nach zwei Schritten an einem verschlossenen Gitter endete. Geradeaus war ein Lichtschimmer zu erkennen.
„Da lang!“, flüsterte Stephan und wies mit seinem Ziegellicht auf den Lichtschimmer. Sie gingen weiter, dann blieb Sandra stehen.
„Warte mal. Verwirren wir sie noch ein bisschen, falls sie doch noch hinter uns her steigen …“, sagte sie, kramte in ihrer Tasche und fand eine stabile Nadel, mit der sie in dem Vorhängeschloss des Gitters herumstocherte, dessen Schließmechanismus rasch nachgab. Das Schloss ließ sie geräuschvoll fallen und zog das Gitter auf.
„Das wird sie vielleicht vom geraden Weg abbringen“, sagte sie und folgte Stephan dann wieder in den geraden Tunnel. Der Tunnel war noch gute zweihundert Meter lang und endete schließlich in einem dichten Gebüsch am Rand eines Villengartens. Stephan kletterte hinauf und peilte vorsichtig einmal rundherum, aber es war niemand zu sehen. Er stemmte sich hoch und half dann Sandra hinauf.
„Wir sind in der Kirchstraße“, sagte sie, als sie sich umgesehen hatte. „Wir brauchen andere Kleidung. So sieht jeder, wo wir gerade herkommen“, bemerkte sie dann, als sie den Dreck auf Stephans Jacke sah. Er grinste und schnippte ihr einige Pflanzenreste vom Mantel.
„Ich gebe zu, ich hätte nicht jeder Frau zugetraut, durch einen Tunnel zu spazieren, in dem Spinnen und Mäuse sein könnten.“, lächelte er. Sandra lächelte süß.
„Vielleicht sind Wilzarinnen etwas härter als Wengländerinnen?“, sagte sie.
„Du könntest Recht haben“, sagte er langsam. „Das war ein wilzarischer Pass, oder?“
„Ja“
„Echt?“
„Ja“
„Lass uns vorsichtig nach Hause gehen.“
Auf vorsichtigen Umwegen erreichten sie das Haus der Habermanns. Zu ihrer beider Erleichterung stand es noch.
„Gott sei Dank, dass diese Adresse nicht in meinem Pass steht“, flüsterte Sandra. „Sonst wäre es nicht mehr da.“
Als sie wieder im Haus waren, nahmen Maria Habermann, Carl und Wilfried sie erleichtert in Empfang. Tanta Maria zog nach dem ersten Schrecken dann zweifelnd eine Augenbraue hoch.
„Geradeaus über die Straße seid ihr jedenfalls nicht gekommen …“, kommentierte sie die verdreckte Kleidung. Sandra und Stephan schüttelten die Köpfe.
„Nein, sie kontrollieren ziemlich scharf“, sagte er. „Ich werde mal meine Beute untersuchen und mir dann überlegen, was ich dann anstelle. Unikeller fällt jedenfalls aus wegen ist nicht.“
„Beute?“, entfuhr es Carl.
„Ich habe dem Korporal, der uns filzen wollte, die Taschen ausgeräumt“, erwiderte Stephan. „Einschließlich seiner Hausschlüssel …“, sagte er und hob das Schlüsselbund.
Einige Zeit später hatte Stephan in seinem Zimmer alles ausgebreitet, was er dem wilzarischen Korporal abgenommen hatte: Dienstwaffe, Schlüssel, Dienstausweis, Pass, einige Karten, die verschiedene Stadtviertel von Christophstein beinhalteten – und eine Gesamtkarte, die wilzarische Stützpunkte in Aventur zeigte. Es war ein Stück, das ein militärisches Hauptquartier normalerweise nie verließ.
„Treffer!“, frohlockte Stephan. „Lotteriegewinn!“
„Was hast du gefunden?“, fragte Carl.
„Eine Karte, die einen großen Anteil – wenn nicht alle – Stützpunkte der Wilzaren in Aventur zeigt. Seht euch das an!“
Wilfried und Carl kamen näher.
„Wie sind die Wilzaren da herangekommen?“
„Das weiß ich nicht, aber ich habe den Verdacht, dass diese Aktion von ganz langer Hand geplant gewesen ist. Sie haben sämtliche wenglischen Kasernen gekapert.“
Sein grübelnder Blick entging seinen Freunden nicht, obwohl Stephan auf die Karte sah.
„Was hast du vor?“, fragte Wilfried.
„Ich weiß es noch nicht genau … Erst einmal sollte ich in Erfahrung bringen, was hier eigentlich wirklich passiert ist – und eine Möglichkeit finden, diese Informationen an die Ostarmee in Karlsfeld weiterzuleiten.“
Hier endet die Leseprobe. Wenn dir diese Probe gefallen hat, findest du das ganze Buch mit 308 Seiten hier:
Stephan von Wengland im Tredition Shop
Gebundenes Buch 20,00 €
E-Buch 4,99 €
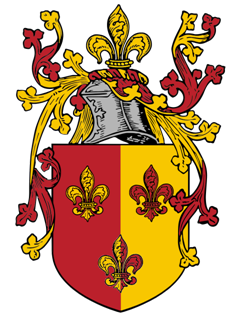

Schreibe einen Kommentar