Frankreich, 1184: Nachdem seine Frau wegen der Totgeburt des gemeinsamen Kindes Selbstmord begangen hat, erhält der junge Schmied Balian Besuch von einer Gruppe Kreuzritter, die auf dem Rückweg ins Heilige Land sind. Der Anführer, Baron Godfrey von Ibelin, bekennt sich als leiblicher Vater des überraschten Schmieds und bietet ihm einen Platz an seiner Seite an. Balian lehnt zunächst ab.
Doch als er erfährt, dass sein Bruder, der Priester des Dorfes, seine tote Frau als Selbstmörderin hat köpfen lassen, ist es mit seiner Duldsamkeit vorbei. Er bringt seinen Bruder um und eilt seinem Vater nach, um in Jerusalem Vergebung für sich selbst und seine tote Frau zu finden.
Es ist der Beginn einer Reise, die Balian nicht nur in den Orient führt, sondern auch zu sich selbst und zu seiner wahren Bestimmung.
Das Buch zum Film in der Version Director’s Cut aus dem Jahr 2006 mit den Originaldialogen der deutschen Synchronfassung
Disclaimer
Die Rechte an dieser Story, den handelnden Personen und den gewählten Orten, soweit sie nicht historisch sind, liegen ausschließlich bei 20th Century Fox, William Monahan und Ridley Scott. Ich leihe sie mir nur aus und verdiene hiermit kein Geld (es sei denn, die Rechteinhaber gewähren mir doch noch das Privileg, dieses Buch zum Film tatsächlich in Buchform zu veröffentlichen). (Siehe auch Lizenzen)
Vorwort
Vorwort zum Director’s Cut von Sir Ridley Scott:
Ich glaube, man kann dies den Director’s Cut nennen, da es meine Lieblingsversion ist. Hier wurden nicht nur einfach ein paar Aufnahmen hinzugefügt, und die Anfänge und Enden verschiedener Szenen verlängert. Dies ist eine organische Charakterisierung, die ich wieder in den Film eingefügt habe.
Eine der wichtigsten Ergänzungen, die – wie ich finde – nicht hätte fehlen dürfen, war die Sibylla-Figur, die ein Kind hatte. Es hieß immer, diese Geschichte würde vom Thema nicht hineinpassen.
Wenn man in den dritten Akt gelangt, gibt es dort einige Szenen, die in den Augen mancher Leute zu lang sind oder einen zu langen Aufbau haben.
Aber schauen und urteilen Sie selbst. Ich hoffe, es gefällt Ihnen.
Anmerkung der Verfasserin:
Ich bezeichne mich hierfür ausdrücklich nicht als Autorin, mögen die erzählenden Texte auch von mir sein; schließlich war das Drehbuch von William Monahan die Grundlage für den Film. Auch wenn die auf der DVD veröffentlichte Drehbuchfassung nicht in allen Einzelheiten so umgesetzt wurde, wie William Monahan geschrieben hatte, so ist der Inhalt doch zuallererst sein geistiges Kind. Deshalb betrachte und bezeichne ich mich für eine Filmbuchfassung lieber als eine Art Ghostwriter, der das in eine flüssig lesbare Fassung bringt, was Monahan als Richtschnur zu Papier gebracht hat und Ridley Scott mit dem Filmteam in sichtbare Bilder und gesprochene Dialoge umgesetzt hat.
Zugegebenermaßen ist dieses Filmbuch nicht ganz die absolute Treue zu Ridley Scotts favorisierter Fassung, da ich Szenen aufnehme, die auch jetzt noch nicht in der entsprechenden Director’s-Cut-Fassung sind, sondern sich als entfallene bzw. alternative Szenen auf der 4. DVD als Bonusmaterial befinden. Ridley Scott mag es anders sehen, aber manche davon geben ergänzende Informationen über die Charaktere wieder und verleihen ihnen noch mehr Tiefe, als eine entsprechende kürzere oder anders gewählte Szene, die den Weg in den fertigen Director’s Cut gefunden hat. Eine Buchfassung soll – das ist jedenfalls meine persönliche Meinung – immer noch etwas an zusätzlicher Information liefern, was vielleicht beim Betrachten eines Films nicht sofort augenfällig ist, aber vom Leser eines Buches grundsätzlich erwartet wird.
Mit Rücksicht auf die vom Regisseur favorisierte Fassung habe ich diese Szenen aber am Anfang mit ► und am Ende mit◄ markiert. Wer also die Fassung lesen möchte, die der Regisseur als seine Lieblingsfassung bezeichnet, lese bitte über diese Markierungen hinweg. Ridley Scott möge mir verzeihen, dass ich noch etwas neugieriger bin als vielleicht der größte Teil der Zuschauer … oder er selbst.
Bei den Kapiteln habe ich mich sowohl inhaltlich als auch vom Titel her an die Kapitelbezeichnungen des DVD-Begleitheftes gehalten.
Ein Hinweis zu den Namen: William Monahan hat von nunmehr rund 40 Sprechrollen lediglich 14 mit Namen bedacht, was sehr ungewöhnlich ist und Verwirrung stiften kann; besonders dann, wenn die wenigen Namen, die überhaupt in der Besetzungsliste erscheinen, auch nur zur Hälfte in den Dialogen genannt werden. Wozu das führen kann, zeigt das Beispiel der Internetseite imdb.de, die für gewöhnlich sehr gut informiert ist, hier aber über den Unwillen, handelnde Personen mit Namen zu versehen, ziemlich heftig gestolpert ist. So gibt es dort einen Hinweis, dass ein Ritter, der von Godfrey von Ibelin und seinen Mannen besiegt wird und sich als Sohn von Roger de Cormier bezeichnet, der jüngere Sohn von Godfreys Bruder sei. Woher diese Behauptung stammt, lässt sich aus keiner der beiden mir vorliegenden Drehbuchfassungen (eine von der DVD, eine, die in den USA im Handel ist) entnehmen, ergibt sich auch nicht aus den auf der DVD befindlichen Kommentaren von William Monahan und Ridley Scott und erst recht nicht aus der Besetzungsliste des Abspanns.
Nun ist es vielleicht nicht lebenswichtig, wirklich jede Rolle mit einem Namen zu belegen, und mir ist klar, dass insbesondere Balians Bruder und der Johanniter eher stereotypische Figuren jener Zeit sein sollen und deshalb mit allgemeinen Bezeichnungen versehen wurden. Aber letztlich handelt es sich doch um ganz konkrete Menschen, die in einer ganz bestimmten Art und Weise handeln, die gewiss nicht als wirklich stereotyp zu bezeichnen ist. Bei allem Respekt vor dem Spezialwissen von William Monahan nehme ich ihm nicht ab, dass wirklich jeder Dorfpriester ein neidischer Lump und Lügner war (oder doch die meisten so gewesen sein könnten) und jeder Johanniterritter so bodenständig und vernunftorientiert war, wie die von ihm entworfenen Filmfiguren. Zudem heißt es schon in der Bibel: „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen.“ Im Hinblick darauf, dass William Monahan wie ich selbst katholisch erzogen ist (das lässt sich jedenfalls aus seinem Kommentar zum Film entnehmen) und vor dem Hintergrund, dass Religion in diesem Film durchaus eine Rolle spielt, berufe ich mich auf diese Regelung. Ich bin daher so frei, den in der Besetzungsliste erscheinenden namenlosen Rollen jeweils hauptsächlich die Namen ihrer Darsteller in der französischen bzw. arabischen Form zu geben. Ergänzend habe ich die zusätzlich gewählten Namen in der Besetzungsliste am Ende eingetragen.
Von dieser Form der Namenswahl weiche ich jedoch bei einigen Personen ab, deren Vornamen schwerlich ins Französische übersetzbar sind, für die es historisch belegte Namen gibt oder die im Drehbuch bereits vorhanden sind, aber nicht den Weg in den Abspann fanden. Die Figur des Tiberias ist hier noch eine kleine Besonderheit. Im Kommentar zum Film gibt William Monahan zu verstehen, dass er diese Figur ursprünglich Raymond von Tiberias nennen wollte (im Drehbuch erscheint diese Figur auch noch so), dessen Vorbild er selbst auch ganz klar als Raymond von Tripolis bezeichnet. Er hat diesen Rollennamen auf Tiberias verkürzt, weil die Verantwortlichen bei der Produktionsgesellschaft mit den vielen Reynalds und Raymonds durcheinander kamen … Ich traue den Lesern dieses Filmbuchs mehr Intelligenz zu und werde Graf Raymond von Tiberias auch so nennen. Man wundere sich also nicht darüber, dass zuweilen der Abwechslung wegen „Raymond“ auftaucht, wo Tiberias erwartet werden könnte …
Noch ein Wort zu Balians Dorf und zum Bruder seines Vaters: Auch in diesem Fall ist mir natürlich bewusst, dass das Dorf austauschbar sein soll und eigentlich überall in Frankreich sein könnte, ebenso wie die Adelsfamilie eher allgemeingültig sein soll. Ich persönlich schätze aber eine konkrete Zuordnung, auch wenn ich mich im fiktiven Rahmen bewege. Daher habe ich mir erlaubt, diesem Dorf einen Namen zu geben und es in eine konkrete Gegend zu versetzen, auch wenn es unter dem Strich fiktiv bleibt.
Die im Film (und damit im Buch) tragende Figur Balian von Ibelin ist eine halbfiktive Figur. Der historische Balian von Ibelin war deutlich älter (etwa in Godfreys Alter), unzweifelhaft ehelich und im Heiligen Land geboren. Dieser historische Balian von Ibelin war der Neffe des Vizegrafen von Chartres, wie ich verschiedenen Sekundärquellen entnommen habe. An diesen Umstand habe ich angeknüpft, indem ich sowohl das Dorf in die Nähe von Chartres verlege als auch den Bruder Godfreys mit dem Namen du Puiset belege, da die Familie du Puiset in jenen Tagen Inhaber der Vizegrafschaft Chartres war. Sollten noch Nachkommen dieser Familie existieren, bitte ich sie auf diesem Weg um Verzeihung, mich literarisch an ihnen vergriffen zu haben.
Ein Hinweis zur Handlungszeit: Nach der mir vorliegenden schriftlichen Drehbuchfassung sollen die ersten Szenen in Frankreich im November spielen. Der Film selbst gibt dazu außer der eingeblendeten Jahreszahl 1184 keine Information. Mir ist bekannt, dass die Dreharbeiten mit den Frankreich-Szenen am 12. Januar 2004 begannen – einen Tag vor Orlando Blooms 27. Geburtstag.
Im Hinblick darauf, dass Balduin IV. von Jerusalem am 16. März 1185 starb und Balian bis dahin erst einmal ins Heilige Land kommen muss, sein Lehen auf Vordermann bringen kann und er auch noch an der Ausbesserung der Jerusalemer Stadtmauer maßgeblich beteiligt ist, erscheinen mir allenfalls fünf Monate dafür dann doch erheblich zu knapp zu sein.
Daher übernehme ich den Starttag der Dreharbeiten für den Beginn der Handlung – die Handlung beginnt halt nur 820 Jahre früher.
Einige Begriffe, von denen ich annehme, dass sie nicht jedem Leser bekannt sind, habe ich mit einem * versehen und im Glossar am Ende des Buchs erklärt.
Prolog
Fast hundert Jahre sind vergangen, seit christliche Armeen Jerusalem eroberten.
Armut und Unterdrückung greifen in Europa um sich. Bauern wie Adlige fliehen auf der Suche nach Reichtum oder Erlösung in das Heilige Land.
Ein Ritter jedoch kehrt auf der Suche nach seinem Sohn in die Heimat zurück …
Kapitel 1
Die Hinrichtung
Frankreich 1184
Es war Januar in Frankreich. Januar bedeutete hier eine Zeit, in der Matsch und Frost sich durchaus abwechseln konnten. In der Morgendämmerung eines trüben Tages tauchte das Dorf Saint-Martin-au-Bois in den Hügeln nordwestlich der Stadt Chartres auf. Durch dünne Nebelschleier, in die sich immer wieder einige Schneeflocken mischten, klang das metallische Geräusch einer Spitzhacke, die den frostigen Boden aufriss. Das langsam zunehmende Licht enthüllte einen Mann, der mitten auf der Kreuzung zweier Landstraßen den Boden zu einem rechteckigen Loch aufhackte. Die eine schmale Straße führte von Chartres herauf zum Dorf, die andere schmale Straße kreuzte die erste keine hundert Klafter* vor dem Dorf und verlor sich in der hügeligen Landschaft. Die Kreuzung der beiden Straßen wurde von einem Wegkreuz überragt, wie es sie im katholischen Frankreich zu Tausenden gab und das so verwittert war, dass es seit Beginn der Christianisierung hier zu stehen schien.
Die Dämmerung ließ einen schmalen Körper erkennen, der in ein grobes Leintuch gehüllt war und neben einer einrädrigen, flachen Karre halb auf der Kreuzung und halb im braungrauen Gras des Wegesrandes lag. Der eisige Wind hob das lose über dem Kopf liegende Tuch ab und gab das bleiche Gesicht einer toten Frau frei. Jung war sie, vielleicht Anfang, allenfalls Mitte zwanzig. Ihre toten Augen starrten auf den leise fallenden Schnee, an ihrem schmalen Hals waren deutlich die Würgemale des Seils zu erkennen, durch das sie zu Tode gekommen war – durch Selbstmord. Über den Würgemalen zeichnete sich im stärker werdenden Tageslicht ein dunkles Lederband ab, an dem ein silbernes Kreuz schimmerte.
Unter dem Kreuz saß ein weiterer Mann mit fast kahlem Kopf und einem eingekerbten Ohr und knabberte an einem mageren Frühstück. Sein Name war François, seine Profession das wenig angesehene Amt des Totengräbers. So mager und verhärmt wie er aussah, war klar, dass François keine vierzig Jahre alt werden würde. Nur ein paar Schritt weiter saß ein erbärmlich frierender Priester und teilte mit froststarren Fingern einen frostschlaffen Apfel, der ihm als Frühstück dienen sollte. Ein erbärmliches Frühstück, fand Père Michel, zu erbärmlich für ihn, der gesellschaftlich weit über den beiden Totengräbern stand, mit denen er hier an der Kreuzung den Unbilden des französischen Winters trotzte. Als er den Apfel offen hatte, wurde deutlich, weshalb er ihn lieber zunächst in zwei Hälften geteilt hatte: Ein mindestens ebenso verfrorener Wurm wand sich in der plötzlichen Helligkeit. Und schlimmer als ein ganzer Wurm im Apfel war nur noch ein halbes Exemplar dieser Spezies… Michel schnippte ihn angewidert weg und warf nach dem Fund eines weiteren Wurms tiefer im Apfel die Frucht schließlich weg, ohne auch nur einen Bissen davon genommen zu haben. Der knurrende Magen trug nicht dazu bei, dass ihm wärmer wurde …
„Wegen Selbstmordes wird ihr das Kreuz verweigert – und dann wird sie an einer Kreuzung begraben. Erklärt mir die Logik!“, riss François’ Stimme Michel aus seiner Betrachtung. Als Père Michel nicht gleich antwortete, weil er gedanklich von ziemlich weit weg an die nasskalte Kreuzung zurückkam, verlieh François seiner Aufforderung Nachdruck:
„Vater?“
„Ja?“, erkundigte sich Michel etwas verwirrt.
„Der Teufel ist ein praktischer Mann“, bemerkte François. „Wäre sie eine Hexe gewesen, hätte es sich für ihn wohl kaum gelohnt“, setzte er spitz hinzu. Welcher Teufel der Hölle würde sich schon eine Seele unter einem Wegkreuz schnappen?
Mit einem gereizten Seufzer erhob sich Père Michel und ging zu der jungen Toten hinüber.
„Was weißt du schon von Logik?“, grollte er. Der Totengräber gehörte zu den schlaueren Leuten, dennoch wartete er noch immer auf die Chance seines Lebens, die er längst verpasst hatte.
„Ich habe Ohren, Vater“, erwiderte François. „Auch wenn in einem eine Kerbe ist, weil ich für die Gerechtigkeit eintrete“, spöttelte er und zupfte sich am Ohr. Das eingekerbte Ohr, ein echtes Schlitzohr, bewies, dass François seinem Glück auch auf nicht ganz legale Weise hatte auf die Sprünge helfen wollen.
„Du bist ein armseliger Dieb“, erinnerte Michel ihn an den Grund für die Kerbe im Ohr. „Halt den Mund und grab’ weiter!“
Gehorsam erhob sich der Totengräber und schippte mit seinem Gehilfen das Grab mitten auf der Kreuzung.
Michel ließ sich bei der Toten nieder, scheinbar, als ob er ihr das vom eiskalten Wind fort gewehte Leichentuch wieder über die starren Züge legen wollte, doch das tat der Priester nicht. Seine Hand glitt sanft über die auch im Tod noch schönen Züge der jungen Frau. Michel war Mönch, und das bedeutete, dass er Ehelosigkeit gelobt hatte. Aber er war auch ein Mensch und hatte menschliche Gefühle. Und dass diese Tote in ihrer Schönheit nicht ihm gehört hatte, machte ihn neidisch auf den, dessen Weib sie gewesen war; neidisch auf den, der das elterliche Erbe ungeschmälert bekommen hatte, weshalb für Michel nur der Weg ins Kloster geblieben war …
Seine Hand traf auf das dunkle Lederband, folgte ihm und gelangte zu dem silbernen Kreuz, das recht roh schien. Gleichwohl stammte es aus den Händen eines überaus geschickten Schmiedemeisters, der allerfeinste Silberarbeiten zu machen verstand. Wenn dieses Kreuz das nicht widerspiegelte, lag es eher daran, dass er dieses Kreuz vor langer Zeit gemacht hatte, als er gerade erst begonnen hatte, Schmied zu lernen … Das Kreuz stellte schon wegen seines kostbaren Materials ein kleines Stückchen Wohlstand in dieser armen Bauernwelt dar. Kein Bauer oder Pächter konnte sich so etwas leisten. Michel hatte als Priester auch Besitzlosigkeit versprochen, allen weltlichen Gütern entsagt, aber ein Kreuz …, nun ja, das war schließlich so etwas wie das Handwerkszeug des Geistlichen … Er sah sich verstohlen um, aber die beiden Totengräber waren vollkommen auf das Grab fixiert und sahen nicht zu ihm. Mit einem Ruck riss Michel das Kreuz samt Lederband vom Hals der Toten und ließ es diskret in seiner Gewandtasche verschwinden. Eine Strieme mehr oder weniger würde an einem Hals mit Würgemalen nicht auffallen.
Vor Schreck aufflatternde Krähen, Aasvögel, die auf den kahlen Bäumen nicht weit von der Kreuzung auf eine Möglichkeit gewartet hatten, sich an der Toten gütlich zu tun, bevor sie von Erde bedeckt wurde, weckten die Aufmerksamkeit der beiden Totengräber. Sie sahen eine Lanze* Ritter auf der von Chartres heraufführenden Straße zum Dorf hinauf reiten. Die beiden Männer sahen sich an. Ob sich daraus etwas ergeben konnte?
„Kreuzritter …“, murmelte François. Immer wieder kehrten Kreuzritter nach Frankreich zurück, doch nicht, um zu bleiben; die meisten hatten einst das Kreuz genommen, weil es für sie in Frankreich buchstäblich nichts zu erben gab. Daran hatte sich für sie nichts geändert, und so kamen sie lediglich her, um neue Leute für den Kampf gegen die Heiden anzuwerben. François witterte eine neue Chance, sich in einer neuen Welt ein neues Leben aufzubauen und sich hoffentlich nicht noch länger mit dem Begraben toter Menschen befassen zu müssen.
Von dem Trupp löste sich ein einzelner Reiter und ritt in schärferem Tempo zu der Kreuzung hinauf. Er trug einen Gambeson*, der von dunklem Rot und hellem Ocker gespalten war und aus Samt gearbeitet war. Farbgebung und Material sprachen für einen Knappen als Träger dieser Rüstung, da Knappen in den Farben ihrer ritterlichen Herren eingekleidet wurden, aber bessere Stoffe erhielten als die gewöhnlichen Soldaten. Ein Knappe sollte eines Tages zum Ritter geschlagen werden und war damit Anwärter auf den Adelsstand, wenn er nicht gar adliger Geburt war.
„Bitte, macht den Weg frei“, bat er höflich mit verschnupfter Stimme. Der Knappe hatte sich in der für ihn völlig ungewohnten nassen Kälte eine fürchterliche Erkältung zugezogen … Dass er darum bat, den Weg freizumachen, war ungewöhnlich. Zumeist forderten die hohen Herren in recht grobem Ton, dass das einfache Volk von der Straße verschwinden möge, wenn sie einen Weg zu benutzen gedachten. Dass es hier anders war, sprach für den Herrn des Knappen, unter dessen Banner die bunte Mischung von Männern ritt. Offenbar hatte dieser Mann nicht vergessen, dass auch Adelsfamilien nicht seit Erschaffung der Welt adlig waren, sondern irgendwann in diesen Stand erhoben worden waren …
Eilig räumten die beiden Totengräber den Leichnam und die Leichenkarre von der Straße. Sie und Père Michel verneigten sich ehrerbietig vor den Reitern und wagten kaum, den Blick zu heben. François sah verstohlen hoch und stolperte, von blankem Entsetzen gepackt, prompt einige Schritte rückwärts, als er in das ebenholzschwarze Gesicht eines Mohren sah. Dann erst wurde ihm bewusst, dass dieser Mohr vielleicht ein Nachkomme des berühmten Melchior sein könnte, jenes Weisen aus dem Morgenland, der mit Caspar und Balthasar als einer der Ersten dem Christuskind gehuldigt hatte. Welchen Stellenwert die Weisen aus dem Morgenland in den christlichen Reichen hatten, war schon daran zu erkennen, dass Friedrich Barbarossa, der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, die Gebeine der Heiligen Drei Könige vom Zweiten Kreuzzug mitgebracht und in Köln in einem kostbaren Schrein aufgebahrt hatte.
Der ganze Zug passierte die in ehrfürchtiger Haltung verharrenden Dörfler. Erst, als der letzte Reiter auf seiner Höhe war, riskierte Père Michel einen scheuen Blick nach oben und bemerkte, dass dieser Mann offenbar der Herr dieser Truppe war. Er mochte etwa fünfzig Jahre alt sein, trug einen Topfhelm, dessen Visier abgenommen war, einen kostbar mit Pelz besetzten und gefütterten Übermantel und wie alle seine Männer eine Rüstung, die für den Gebrauch im Orient abgeändert war. Das Banner von Gold mit einem schwebenden, dunkelroten Tatzen-kreuz, unter dem die Männer ritten, war seines. Das des Barons Godfrey von Ibelin.
„Knappe!“, rief der Baron. Gehorsam sprengte Knappe Philippe hinter seinem Herrn her, doch kam er schnell zurück und warf Michel eine Münze zu.
„Das ist von meinem Herrn für ein Begräbnis und eine Messe … für ihre Seele“, sagte er, wendete sein Pferd und folgte eilig den anderen Reitern.
Reisende aus dem Orient waren immer gut für Nachrichten aus der großen, weiten Welt, die ein gewöhnlicher Dörfler nie zu sehen bekam; die er auch schon deshalb nie sehen würde, weil es für die meisten Menschen schon eine Versuchung Gottes darstellte, auch nur wissen zu wollen, was sich hinter dem Nachbardorf verbarg …
Während François darüber spekulierte, wie er sich den Kreuzrittern am besten anschließen konnte, raffte Michel schon die Kutte, um den Kreuzrittern ins Dorf nachzulaufen. Aus dem Augenwinkel bemerkte er noch, dass die Totengräber mit dem Aushub des Grabes fertig waren und die Tote ins Grab legen wollten. Er blieb stehen.
„Wartet!“, rief der Priester. „Habt ihr’s vergessen?“
François stutzte. Das meinte Père Michel doch nicht wirklich ernst?
„Sie war das Weib Eures Bruders“, erinnerte er erschrocken. Michel verzog das Gesicht.
„Sie war eine Selbstmörderin. Köpft sie!“, befahl er den Totengräbern eisig. „Und bringt die Axt zurück!“, setzte er hinzu und beeilte sich, den Kreuzrittern zu folgen.
François sah zu der Toten, dann zuckte er verlegen mit den Schultern, hob eine große Henkersaxt und ließ sie niederfahren. Die Axt trennte den Kopf vom Rumpf der Toten.
Kapitel 2
Das Dorf
Godfrey und seine Männer kamen dem Dorf näher, das eine viertel Meile abseits der Burg lag. Godfreys Blick ging zu einem großzügigen Anwesen, dem ein gewisser Wohlstand anzusehen war. Es war eine Schmiede. Jean, ein Johanniterritter, folgte Godfreys Blick. So verloren, wie der Baron dort hinsah, schien er in alter Erinnerung versunken.
„Kennt Ihr diesen Ort, Mylord?“, erkundigte sich der Johanniter.
„Kennen?“, versetzte Godfrey kurz angebunden. „Ich weiß alles über ihn …“
Damit gab er seinem Ross die Sporen und strebte eilig der Burg zu.
Auf dem Weg zur Burg passierten die Kreuzritter eine Baustelle, die ganz danach aussah, dass hier eine neue Kirche gebaut wurde. Viel war noch nicht erkennbar, aber die Fundamente hatten die Handwerker bereits verlassen. Guillaume, der Erzbischof von Chartres, eilte mit nervösen Schritten zur Baustelle hinauf, begleitet von Père Michel.
„Dein Bruder …“, setzte der Erzbischof an, „hast du mit ihm gesprochen?“
„In welcher Angelegenheit, Herr?“, fragte Michel. „Er steht immer noch unter Arrest.“
„Dein Bruder ist so verantwortlich für die Sünden seines Weibes, wie ich es bin“, entgegnete der Erzbischof. Dass Michel seinen Bruder wegen des Selbstmordes seiner Frau hatte ins Gefängnis werfen lassen, passte Guillaume weder ins Konzept noch verstand er es.
„Da gehen die Meinungen auseinander, Herr“, widersprach Michel. Oh, er hatte da ganz andere Ansichten als sein geistlicher Herr …
„Das Begräbnis wurde …“, fuhr der Erzbischof fort, während er den schmalen, steiler werdenden Pfad hinauf strebte.
„Ja“, bestätigte der Priester. Guillaume blieb stehen und hielt Michel fest.
„Und du hast ihren Leichnam … nicht verstümmelt?“, erkundigte er sich, wenngleich der Tonfall mehr Feststellung als Frage war. Er hatte Michel schlichtweg verboten, die Leiche zu köpfen, obwohl es sonst üblich war, dem Allmächtigen einen unmissverständlichen Hinweis zu geben, dass sich ein Menschenkind das Paradies durch Selbstmord hatte erschleichen wollen. Selbstmord war Todsünde und durfte nur durch die Pforten der Hölle führen! So sahen es die weitaus meisten Menschen, nicht nur Geistliche. Aber Erzbischof Guillaume war anderer Meinung und glaubte fest an einen liebenden, verzeihenden Gott.
„Nein“, log Michel beflissen. Der Erzbischof, der einem Seelsorger grundsätzlich nie zugetraut hätte, sich der Sünde der Lüge schuldig zu machen, nickte zufrieden, auch wenn seine Weisung an den Priester dem grausamen Gesetz widersprach.
„Gut. Ein Gesetz kann zu weit gehen. Es kann zu weit gehen!“, schnaufte Guillaume. Sie hatten den Zugang zur Baustelle erreicht und Guillaume blieb am Gerüstabsatz stehen und hielt sich daran fest.
„Ich frage mich, ob Jesus es getan hätte. Im Christentum wurde so viel getan, wozu Christus nicht fähig gewesen wäre“, fuhr er fort. Erzbischof Guillaume kamen zuweilen ernsthafte Zweifel, dass alles, was in den letzten tausend Jahren im Namen des Christentums geschehen war und was manche Christen im Namen Christi getan hatten, vor Christi Augen tatsächlich Gnade gefunden hätte …
„Lass deinen Bruder frei!“, wies er Michel dann an. „Ich komme ohne ihn nicht aus.“
Michel packte ein eisiger Schreck.
„Aber mei… mei… mein Bruder, Mylord Bischof… er ist vom Teufel besessen, und er muss unbedingt … examiniert werden“, wandte er nervös ein.
„Dein Bruder ist so verrückt, wie du es bist!“, wies Guillaume den Dorfpriester zurecht. „Er trauert. Ohne deinen Bruder werde ich die Kirche nicht fertig kriegen. Lass ihn frei!“, wiederholte er seine Anweisung. Dann kramte er in seiner Gewandtasche und förderte eine Handvoll Silbermünzen zutage.
„Und gib ihm das hier“, sagte er und legte die Münzen in Michels Hand, die er dann sanft zur Faust verschloss. „Und sag ihm, dass ich ihn in jedes meiner Gebete einschließen werde.“
Michel verbeugte sich wortlos, sah dem Erzbischof grimmig nach. Als er sicher war, dass der alte Kirchenfürst sich nicht mehr umdrehen würde, ließ er das Geld in seiner Gewandtasche verschwinden. Dann schlug er unwillig den Weg zum Gefängnis ein.
Ein den Kükenfedern kaum entwachsener Junghahn begrüßte mit lautem Krähen und eifrigem Flügelschlag einen herrlichen Sommermorgen und nahm ein genüssliches Staubbad. Das Krähen machte den Herrn des Hahns aufmerksam, der in sauberem, weißem Leinenhemd zur Gartenseite der Schmiede kam und in den Obstgarten hinuntersah. Mit einem glücklichen Lächeln erkannte Balian seine Frau Natalie unten im Obstgarten, wo sie gerade einen jungen Baum pflanzte. Der Obstgarten war ihr ganzer Stolz, den sie hegte und pflegte – und der ihr das mit guten Erträgen dankte. Zwischen den Bäumen pickten die fleißigen Hennen, die Eier und Fleisch lieferten. Auch ihre Schwangerschaft hatte Natalie nicht daran hindern können, sich weiter hingebungsvoll ihrem Garten zu widmen.
Als Balian an den Verandaabsatz der Schmiede kam, stand sie gerade auf, nachdem sie den jungen Baum in die Erde gebracht und gewässert hatte. Eine Bewegung in ihrem Leib erinnerte sie an die frohe Hoffnung und den Mann, den sie liebte. Mit einem ebenso glücklichen Lächeln erwiderte Natalie den liebevollen Blick ihres Mannes Balian und schäkerte mit unschuldigem Augenaufschlag und verführerischem Drehen ihres schlanken Körpers mit ihm.
Balians glückliches Lächeln wich einem besorgteren Ausdruck. Er wollte nicht, dass sie in ihrem Zustand schwer arbeitete – und das Pflanzen von Bäumen war schwere Arbeit. Doch er hatte sie nicht von ihrem Vorhaben abbringen können, den Baum selbst zu pflanzen …
Der wundervolle Traum von besseren Tagen verblasste, und Balian fand sich in der kalten Realität einer trüben, nasskalten Dämmerung und in schmutzigem Gefängnisstroh wieder. Das heißt, er fand sich eigentlich nicht wieder, er spürte nichts mehr; nicht einmal die nasse Kälte, die durch die offenen Gitter des Verschlags drang, in dem man ihn eingesperrt hatte. Balian war ein junger Mann von sechsundzwanzig Jahren, sah unverschämt gut aus mit seinem gut nackenlangen, gepflegten, dunklen Haar, dem ebenso gepflegten, kurzen Bart, der den Mund umrahmte und die Wangen etwa drei Finger breit zierte. Normalerweise war dieser Bart sorgsam gestutzt, aber jetzt zeigten sich an den sonst ausrasierten Stellen dunkle Bartstoppeln. In den nussbraunen Augen fehlte die sonst darin leuchtende Wärme. Sein Blick war leer und stumpf. Nichts mehr war in ihm außer der bitteren Erkenntnis, dass seine geliebte Frau Natalie tot war. Die bodenlose Trauer hielt ihn umklammert wie eine eiserne Kralle aus seiner eigenen Werkstatt. Balian war – anders als die meisten Leute in Saint-Martin-au-Bois – kein Bauer, er war Handwerksmeister, genauer: Schmiedemeister; ein Künstler seines Fachs, der Waffen und Rüstungen mit derselben Kunstfertigkeit herstellte, wie er silberne Pokale machte und Pferden gute Hufeisen anpasste, die haltbar waren und den Huf gut zu schützen vermochten. Was immer aus Metall gemacht werden konnte: Balian verstand sich darauf – auch die Winkeleisen für die Mauern der neuen Kirche kamen aus seiner Schmiede.
So sehr er sein vom Vater ererbtes und erlerntes Handwerk sonst auch liebte, im Moment hatte für ihn nichts mehr Bedeutung; nur die Tatsache, dass seine Frau tot war … Tot und begraben … Er hatte sie nicht einmal auf ihrem letzten Weg begleiten dürfen. Père Michel, sein Bruder, hatte es ihm verboten, bei der Beerdigung anwesend zu sein – und weil er in seiner abgrundtiefen Trauer schier hysterisch geworden war, hatte Michel ihn einsperren lassen – offiziell, weil Michel ihn vom Teufel besessen nannte, damit er sich nicht noch selbst etwas antat, quasi um ihn vor der gleichen Todsünde zu retten, die sein Weib begangen hatte.
Wie lange er schon im Gefängnis saß, wusste Balian nicht. Er hatte das Zeitgefühl verloren; es war, wie alles andere, was ihm einmal wichtig gewesen war, nun bedeutungslos. Ohne Natalie, ohne den kleinen Sohn, der leblos auf die Welt gekommen war, hatte sein eigenes Leben keinen rechten Sinn mehr. Er fragte er sich stumm, weshalb er noch hier war. Er wäre viel lieber dort gewesen, wo seine Frau und sein Söhnchen jetzt waren – und gleichzeitig kamen ihm wieder Zweifel, was seine Frau betraf … War sie nicht möglicherweise in der Hölle? Nein, das konnte nicht sein …
Balians Gedanken kreisten immer wieder um die Frage, weshalb er nicht imstande gewesen war, seine Frau vor sich selbst zu schützen. Natürlich war es für sie ein furchtbarer Schock gewesen, dass ihr gemeinsamer Sohn tot geboren worden war, sie hatte sich schreckliche Vorwürfe gemacht; auch, dass sie nicht auf ihn gehört hatte, der sie von den schweren Arbeiten hatte fernhalten wollen. Aber auch bei reicheren Familien kamen Totgeburten vor, das war nicht das Ende der Welt …
Ein Geräusch drang in seine trübsinnigen Betrachtungen, aber Balian nahm es dennoch nicht wirklich wahr. Er reagierte nicht einmal darauf.
„Der Bischof braucht dich“, hörte er die Stimme seines Bruders wie aus weiter Ferne. Als er noch immer keine Reaktion zeigte, wandte Michel sich an den Wächter:
„Lasst ihn frei!“
Dann eilte er wieder aus dem Gefängnis fort. Der alte Wachmann kam zu Balian, schüttelte ihn an der Schulter.
„Na los, steh auf. Dies ist nicht der Himmel, es ist die Welt und sie ist voller Argnis“, sagte er gutmütig.
Wie in Trance stand Balian schließlich auf und ließ sich mit hängendem Kopf von dem Wächter hinaus in die neblig-frostige Luft eines neuen Januartages schieben. Draußen wartete Michel, der sich verfroren in seine Kutte gewickelt hatte, aber auch Balians Hund, der vor der Tür gelegen hatte, seit sein Herr eingesperrt worden war. Schwanzwedelnd begrüßte er Balian, der mehr aus Gewohnheit den Hund streichelte, als er es bewusst tat. Der junge Schmied war ein tierlieber Mensch, was jedes Tier in seiner Nähe instinktiv spürte, doch jetzt war er nur eine wandelnde Leiche. Der Hund spürte, dass sein Herr Kummer hatte und folgte ihm mit wedelndem Schwanz, als Balian langsam und ohne auch nur hochzusehen den Weg zu seinem Anwesen einschlug. Der Wächter folgte Balian und setzte sich wieder an sein wärmendes Feuer vor dem Gefängnis.
„Füge dir selbst kein Leid zu“, warnte er den jungen Schmied noch. „Dafür werden genug andere Männer sorgen.“
Balian reagierte nicht und trottete schweigend und in sich zusammengesunken die schlammige Straße hinab zu seinem Haus. Wie aus weiter Ferne hörte er, dass oben in der Burg Musik spielte …
Kapitel 3
Kreuzritter
Der Rittersaal der Burg von Saint-Martin-au-Bois war vom nur schlecht abziehenden Rauch des Kamins durchzogen. Ein helles, wärmendes Feuer loderte in der Feuerstelle und beschien zusammen mit ungezählten Kerzen, die in vielen Kerzenständern im ganzen Raum verteilt waren, ein reichhaltiges Buffet, auf dem Hasenkeulen, Hühner, Brot, Gemüse und viele andere Leckereien appetitlich angerichtet waren. Hugo du Puiset, der Vizegraf von Saint-Martin-au-Bois, hatte weder Kosten noch Mühen gescheut, zu Ehren seines jüngeren Bruders Godfrey ein reiches Bankett zu veranstalten.
►Außer den Reisenden aus dem Orient waren auch die Honoratioren des Dorfes eingeladen, darunter auch Père Michel, der die Gelegenheit nutzte, sein ausgefallenes Frühstück in Form des schlappen, wurmstichigen Apfels vergessen zu machen und seinen Teller mit sämtlichen Leckereien überlud, die in Reichweite seiner Hände auf den appetitlich angerichteten Platten lagen. Er balancierte vorsichtig den hoch beladenen Teller zu dem Tisch, an dem er Platz gefunden hatte, schnappte sich auf dem Weg noch eine Hasenkeule von der Platte, die ein Küchenhelfer gerade zum Buffet trug, ließ sich mit einem zufriedenen Glitzern in den Augen am Tisch nieder und ließ sich schmecken, was er als buchstäblich armer Dorfpriester viel zu selten genießen durfte. Ein solcher Festschmaus, bei dem er sich ausnahmsweise einmal richtig satt essen konnte, war für Père Michel wie Ostern und Weihnachten auf einem Tag. Er sandte ein besonderes Stoßgebet gen Himmel, dass die Kreuzritter noch rechtzeitig vor der Fastenzeit gekommen waren, sonst wäre aus diesem Festschmaus nichts geworden … ◄
In der Mitte des Rittersaales saßen Hugo du Puiset, sein Sohn Nicolas und Godfrey mit seinen Leuten um einen massiven, großen Tisch und zerlegten die leckeren Fleischstücke mit den Tafelmessern.
„Und was ist mit Jerusalem?“, erkundigte sich Hugo neugierig. Viel zu selten kamen Nachrichten aus dem Heiligen Land; in der Regel nur, wenn Kreuzfahrer für kurze Zeit zurückkehrten.
„Jerusalem? Es ist in Gefahr, Mylord. Wie immer“, antwortete Bruder Jean, obwohl Hugo eigentlich seinen Bruder Godfrey angesprochen hatte. Doch Godfrey wirkte abwesend und beteiligte sich nicht am Gespräch. Er schien mit seinen Gedanken sehr weit entfernt zu sein.
„Wir leisten den Sarazenen dort seit über hundert Jahren Widerstand“, bemerkte Hugo, als habe er selbst Jerusalem verteidigt. Jean lächelte milde.
„Die … Sarazenen … wie Ihr sie nennt, haben sich inzwischen zusammengeschlossen. Ägypten, Syrien und ganz Arabien. Sie haben einen neuen … Anführer“, erwiderte er.
„Saladin, ihr … König“, versetzte Nicolas spöttisch, wobei er ‚König’ besonders verächtlich betonte.
„Kauderwelsch“, schnaufte Hugo und rülpste vernehmlich. Seiner Ansicht nach brachte man diesem ungläubigen Usurpator damit nur viel zu viel Achtung entgegen, die er nicht verdiente.
Johanniter Jean fand, dass es Zeit war, unverfänglichere Themen zum Gegenstand des Gesprächs zu machen und nahm den Weinpokal in die Hand. Es war ein wunderschönes Stück aus Silber, fein gearbeitet, formschön und handlich. Ein Meisterstück der Silberschmiedekunst.
„Das ist wirklich schön“, sagte er mit aufrichtiger Bewunderung und drehte den kostbaren Pokal in den Händen, um ihn von allen Seiten zu betrachten. Hugo folgte dem Blick des Johanniterbruders.
„Und doch wollt Ihr nicht trinken“, bemerkte er spöttisch. Im Gegensatz zu allen anderen, die um Herrentisch saßen, hatte Jean den guten Wein in eher kleinen Schlucken genossen und nicht hinuntergekippt. Entsprechend nüchtern war der Johanniterritter – für Hugo ein seltsamer Vogel. Er ließ seinen Blick prüfend über den Ritterbruder gleiten.
„Ein Ritter sollte ein Ritter sein und ein Mönch ein Mönch“, brummte er dann. Mit dieser Verbindung von Geistlichkeit und Waffengewalt konnte Hugo nicht viel anfangen. Ein Ritter kämpfte und ein Mönche betete – aber beides gleichzeitig? Nein, das passte nicht in Hugos Weltbild.
Die Idee der Ritterorden war nun gut hundert Jahre alt, gemessen an der Existenz des christlichen Glaubens neu und doch schon erheblich langlebiger als die normale Lebenserwartung des Menschen. Der Johanniterorden war 1070 als Krankenpflegeorden gegründet worden, etwas, was nach Hugo du Puisets Meinung auch zu einem Mönchsorden passte; aber dass die Johanniter 1120 zu den Waffen gegriffen hatten und es damit den zwei Jahren früher gegründeten Armen Rittern Christi und des Tempels von Salomon zu Jerusalem, kurz Tempelritter oder Templer genannt, gleichgetan hatten, wollte in Hugos Kopf nicht hinein.
„Bruder …“, mischte sich Godfrey ein, der wie aus weiter Ferne zurückzukommen schien, aber sofort präsent war, als er die Worte seines älteren Bruders als verbalen Angriff auf den treuen Jean verstand.
„Nicht beides. Das ist meine Meinung“, fuhr Hugo unbeirrt fort. „Nun … ich mag altmodisch sein“, schränkte er dann begütigend ein. „Aber … was den Becher anbelangt … ich habe einen Künstler, einen Schmied, an der Hand“, erklärte er. „Oder sagen wir: ich hatte“, setzte er seufzend hinzu.
Godfrey zuckte leicht zusammen, als Hugo von einem Schmied sprach. Doch nicht nur Godfrey wurde plötzlich aufmerksam, auch Père Michel, der keinen halben Klafter entfernt an seiner Hasenkeule knabberte, wurde aufmerksam und sah verstohlen zum Herrentisch hinüber.
„Welcher von den Söhnen des Schmieds, der zu meiner Zeit lebte, hat jetzt die Schmiede?“, fragte Godfrey interessiert.
„Balian, der Älteste. Sein Kind starb, sein Weib verfiel in Melancholie. Sie war nicht mehr ansprechbar. Sie wählte den Freitod. So was kommt vor“, erzählte Hugo gleichmütig und augenscheinlich gänzlich unberührt von dem tragischen Schicksal.
„Aber … was kümmert Euch das?“, fragte er dann verblüfft und sah seinen Bruder an. Das Schicksal des gemeinen Volkes fand normalerweise in Adelskreisen kein Interesse. Godfrey rang sich ein gequältes Lächeln ab.
„Nicht weiter wichtig“, wehrte er ab.
Er erhob sich und ging langsam zum Fenster, schob die zum Schutz vor der nassen Kälte heruntergelassenen, zerschlissenen Vorhänge beiseite und sah in das Dorf hinunter. Sein Blick traf genau auf die Schmiede, die am Hang lag. Vor Godfreys innerem Auge tauchte eine lange zurückliegende Geschichte auf, eine Sünde, die er immer noch mit sich herumtrug; eine Geschichte, die er gerade rücken musste, bevor Gevatter Tod nach ihm griff. Er hatte es fast vergessen, aber die Erwähnung des Schmieds hatte es in sein Gedächtnis zurückgerufen. Die Schmiede unten im Dorf schien Godfrey heller und schöner zu sein, als alle anderen Häuser im Dorf, und das, obwohl dort unten alles dunkel war.
Hugo sah seinem Bruder nach und beugte sich dann mit Verschwörermiene zu seinem Sohn hinüber.
„Vor sechsundzwanzig Jahren nahm mein Bruder das Kreuz“, brummte Hugo bitter und vom Wein schon benebelt. „Und jetzt kehrt er zurück … als wahrhaftiger Baron des Königreichs von Jerusalem. Was für ein Los trägt man da als jüngerer Bruder!“, schnaufte er.
Hugo hatte das elterliche Erbe ungeschmälert und ungeteilt bekommen; so war es üblich, um zu vermeiden, dass das Land durch Erbteilungen immer mehr zersplittert wurde. Doch die Folge dieses Erbrechts war, dass jüngere Söhne leer ausgingen und sehen mussten, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienten. Jüngere Söhne des Adels standen deshalb vor der Wahl, entweder ins Kloster zu gehen oder einem anderen Adligen als Ritter zu dienen. Seit dem Aufruf Papst Urbans II. 1095 zum Kreuzzug bot sich jüngeren Söhnen ohne Erbrecht noch eine dritte Möglichkeit: Sie konnten ihr Glück in der Neuen Welt im Orient versuchen.
Für Godfrey war nichts zu erben gewesen, er hatte schlicht nichts bekommen, sah man davon ab, dass er Schwert, Rüstung, Pferd und etwas Geld bereits besessen hatte, als sein Vater starb. Aber Klostermauern waren nichts für ihn gewesen, dafür liebte er die Frauen zu sehr; so war er ins Heilige Land gegangen und hatte dort aus dem Nichts eine Menge gemacht – zu viel für den Geschmack seines Bruders. Unüberhörbar schwang Neid in Hugos Stimme mit, wie Jean alarmiert registrierte.
„Ohne einen Erben fällt sein Besitz mir zu – also auch dir“, raunte er Nicolas zu, einem Rüpel vor dem Herrn, vor dem keine Gänsemagd sicher war. Nicolas grinste auf eine ziemlich gefährlich aussehende Art.
„Dann danke ich den Sternen für meinen Onkel“, griente er wenig christlich.
Kapitel 4
Sündenfall
Als Michel von der Burg in Richtung seines Pfarrhauses ging, begleitet von ein paar Leuten, die ihm Kannen mit Öl und Reisig als Spende des Vizegrafen für die Kirche nachtrugen, bemerkte er im Halbdunkel des einfach nicht hell werdenden Tages, dass Balian an der Kreuzung vor dem Wegkreuz hockte. Weit war er also nicht gekommen und hatte schon gar nicht getan, was der Erzbischof erwartete. Michel blieb am Wegkreuz stehen und bedeutete den Männern mit den Sachen, weiterzugehen. Dann wandte er sich seinem älteren Bruder zu, der mit leerem Blick wie verloren einsam an der Kreuzung kniete und um seine geliebte Frau trauerte. Gegen die Kälte hatte Balian sich die Kapuze seiner Gugel* über den Kopf gezogen und starrte schweigend auf das Wegkreuz. Die Spuren der Beerdigung waren längst im aufkommenden Frost gefroren und unter einer leichten Schneedecke verschwunden. Michel sah sich etwas unbehaglich um.
„Ihr Grab war gleich hier …“, sagte er, „oder war es dort?“, brummte er dann und zog kurz einen Arm aus den weiten Ärmeln seiner Kutte, wies ein paar Fuß in die andere Richtung und ließ dann schnell wieder die frierende Hand in der Kutte verschwinden. „Ich fürchte, ich kann’s dir nicht genau sagen, wo sie liegt. Ich war bei dem Begräbnis nicht zugegen“, log er ungeniert.
Michel genoss es, dass Balian nach dem Verlust seiner Familie mit ihm wieder gleich geworden war. Bis jetzt hatte Balian als der Ältere von beiden auf der Sonnenseite des Lebens gestanden. Er hatte das Handwerk des Vaters gelernt, hatte als der ältere Bruder die Schmiede und das Haus geerbt. Er war als Schmied ein angesehener Handwerker, dessen Produkte für die Bauern lebenswichtig waren, gleich, ob es Pflugscharen für die Pflüge, Sensen und Sicheln für die Ernte oder Hufeisen für die Pferde waren. Er hatte heiraten können, er war für die Verhältnisse des Dorfes ein schlichtweg reicher Mann, der es sich leisten konnte, zwei Häuser zu haben, er hätte beinahe einen Erben für seinen Besitz gehabt …
Nun war fast alles davon Vergangenheit, nur sein rein weltlicher Besitz und seine Arbeit waren ihm noch geblieben – und das schien ihn in seiner Trauer gar nicht zu interessieren. Das Ziel, einmal seinem Sohn die Schmiede weiterzuvererben, auf das er hingearbeitet hatte, war ohne Frau und Kind sinnlos geworden. Welchen Sinn hatte es, dass er überhaupt noch hier war? Balian stellte sich diese Frage immer wieder.
Michel dagegen hatte nichts zu erben gehabt, weil Balian alles bekommen hatte. Als nichterbender Sohn hatte er vor einer ähnlichen Wahl wie Godfrey gestanden: Er hätte ebenfalls Schmied lernen können und seinem Bruder als Geselle helfen können, einem der Bauern hier oder in einem der Nachbardörfer als Knecht dienen oder Priester werden können. Harte körperliche Arbeit war allerdings nichts für Michel gewesen, sich seinem Bruder unterzuordnen erst recht nicht. So war er Priester geworden, aber Priester zu sein – besonders, wenn die Entscheidung zum geistlichen Beruf nicht ganz freiwillig war – bedeutete für Michel nicht, dass er keinen Neid gekannt hätte. Schließlich war auch er nur ein Mensch …
Er hockte sich zu Balian, der schweigend vor dem Kreuz kniete und seinen Bruder mit einem traurigen Hundeblick aus seinen sanften, braunen Augen ansah. Fast schien es Michel, als ob Balian ihn gar nicht wahrnähme.
„Nenn mich einen Lügner, du hast Grund dazu“, grinste er provozierend und wohl wissend, dass er von ihm nichts zu befürchten hatte. Balian war der Ältere, aber er war so zurückhaltend, wie ein einfacher Mann nur sein konnte. Michel seufzte gereizt, weil sein Bruder überhaupt keine Reaktion zeigte.
„Du wirst dich nie wehren, he?“, sagte er und stieß ihn mit der Hand ins Gesicht, einmal, zweimal – keine Reaktion, nur ein leerer, trauervoller Blick aus großen, braunen Augen erreichte den Priester.
„He? Du hältst immer die andere Wange hin“, spottete Michel. „Ich hab’ das Gefühl, du betrachtest dich frei von Sünde … Das ist eine Sünde!“, fuhr er seinen Bruder mit der ganzen Autorität seines geistlichen Standes an, doch Balian sagte weder etwas, noch wehrte er sich gegen die Attacken seines Bruders. Angewidert und gelangweilt, dass Balian sich nicht mal zu ärgern schien, wandte Michel sich ab und verschwand im Dämmerlicht des trüben Tages.
Er war kaum weg, als Balians Hand in den Schnee griff und sich das kalte, nasse Etwas ins Gesicht warf. Immer noch war es ihm unbegreiflich, dass Natalie tot war, dass er sie nie wieder in den Armen halten würde – und niemals Kinder mit ihr haben würde. Schließlich kehrte er in sein Haus zurück.
►Balian erwachte langsam aus einem Traum in seinem einsamen Bett, als es noch dunkel war. Er konnte einfach nicht mehr schlafen. Helles Mondlicht fiel auf sein Gesicht. Die einzige Wärme, die er noch spürte, war sein Hund, der sich zu Füßen seines Herrn in dessen Bett schlafen gelegt hatte und nun ebenfalls hochkam. Noch verschlafen stand der junge Schmied auf, zog sich fröstelnd die Gugel um die Schultern. Sein Blick fiel auf einen der Tragbalken des Dachs, unter dem der Schlafplatz war. Wie in Trance stand er auf und ging langsam zu dem Gegenstand, der seinen Blick gefesselt hatte: das abgeschnittene Seil, mit dem Natalie sich erhängt hatte. Noch immer hing es lose über dem Balken. Schweigend zog er es herunter und ließ es achtlos fallen.◄
Langsam stieg er die Treppe vom Halbboden in den eigentlichen Wohnbereich hinunter. Er fand ein kleines Leinenjäckchen, das Natalie für ihren Sohn genäht hatte und nahm es in abgrundtiefer Trauer in die Hände, strich zärtlich darüber. Tot war das Kind gewesen, als es geboren wurde, stumm und bleich. Alles in Balian krampfte sich erneut zusammen, als ihn eine neue Welle der Trauer übermannte. Das Babyjäckchen legte er in die nun ebenfalls überflüssig gewordene Weidenzweigkrippe, klemmte sich die kleine Wiege unter den Arm und verließ das Wohnhaus. Vor der Tür zerbrach er in einem Steintrog, der das Regenwasser auffing und auch als Tränke für die Pferde diente, die Eisoberfläche und spritzte sich das eisige Wasser ins Gesicht, um endlich wirklich wach zu werden. Gefolgt von seinem Hund überquerte er die in der Morgendämmerung einsame Dorfstraße und ging in seine Schmiede.
Sein junger Lehrling hatte nach Rückkehr seines Meisters die Esse wieder angeheizt und wartete fröstelnd darauf, dass sein Meister zur Arbeit erschien. Noch saß er am Tisch und nahm sein aus dunklem Brot und Wasser bestehendes Frühstück ein, als Balian eintrat und das Babykörbchen samt dem Leinenjäckchen in das Feuer der Esse warf, als ob er seine Vergangenheit verbrennen wollte. Holz und Leinen fingen sofort Feuer. Der Widerschein der auflodernden Flammen beleuchteten Balians von Trauer erfüllte Züge auf eine gespenstische Art. Seine sonst so warmen, braunen Augen waren gleichzeitig leer und voller Zorn.
„Wir haben zu tun“, sagte er.
Wenig später drangen Hammerschläge durch die frostige Luft, als die ersten Stücke glühend genug waren, um sie mit dem Schmiedehammer zu bearbeiten. Wie im Zorn schlug Balian auf das Schmiedestück ein, das er bearbeitete. Seit Natalie ihrem jungen Leben ein vorzeitiges Ende gesetzt hatte, spürte er nichts mehr. Weder spürte er im Moment die ständige, kalte Zugluft unter der offenen Schmiede noch die Hitze des glühenden Eisens. Sein junger Lehrling hatte ob der herrschenden Kälte fast ständig eine Triefnase, wagte aber nicht, die Schmiede zu verlassen, um sich die Nase zu putzen. Balian war an sich ein guter Lehrherr, aber im Moment … Nun, er war nie ein Mann vieler Worte gewesen, aber im Moment sprach er fast gar nicht mehr. Sein Lehrling konnte deshalb nicht einschätzen, ob sein Meister mit ihm zufrieden war oder nicht.
Der unglückliche junge Witwer schwang seinen Hammer und drosch auf das glühende Eisen ein, als wollte er seinen Schmerz erschlagen. Immer wieder fragte er sich, warum Natalie sich und ihm das nur angetan hatte. War es nicht schlimm genug, dass Gott ihren kleinen Sohn so unendlich früh zu sich gerufen hatte, dass er tot geboren worden war? Sie hatten sich beide so auf ihr erstes Kind gefreut … Balian wusste nicht wohin mit seinem Schmerz. Der Tod des Kindes hatte ihn schon schwer getroffen.
Aber während er sich noch in seiner schweren, körperlichen Arbeit hatte vergraben können, hatte Natalie dem Schicksalsschlag ganz allein gegenüber gestanden. Es war wohl mehr, als die zarte Frau hatte ertragen können. Balian war wütend auf sich selbst und die Welt im Allgemeinen. Was hatte er nur getan, dass er so hart geprüft wurde? Warum hatte er seine Frau nicht trösten können? Er hatte sie so sehr geliebt – mehr als sein eigenes Leben; aber seine Liebe hatte nicht ausgereicht, um sie vor sich selbst zu schützen … Zornig und von einer neuen Welle der Trauer übermannt, hämmerte er auf das heiße Eisen ein, das eines von Dutzenden Winkeleisen für die neue Kirche werden sollte, und steckte es mit einer eckigen Bewegung in den Wassertrog, wo es zischend abkühlte. Der Lehrling führte dem Schmiedefeuer mit dem Blasebalg Luft zu und schob seinem bitter schweigenden Meister den nächsten rotglühenden Eisenstrang zu.
Kapitel 5
Erinnerungen
s „Das ist der Mann! Das ist der Mann!“
Michels Geschrei riss Balian erneut aus seinen Gedanken. Er ließ seine Arbeit liegen und ging mit finsterem Blick hinaus, um zu sehen, weshalb sein Bruder so einen Krach machte. Michel rannte vor einer Truppe Kreuzritter her und wies mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf Balian. Unglaublich, dass dieser Mann ein Priester Christi war …
Die Kreuzritter hielten ihre Pferde an und blieben im Halbkreis um die Schmiede auf der Dorfstraße stehen. Jean, der in der Mitte war, wandte sich an Balian:
„Du bist ein Waffenschmied, ja?“, fragte er. „Ein Künstler laut den Worten deines Herrn und dieses … Priesters.“
Balian sagte nichts und sah den Johanniter und dessen Begleiter nur schweigend an.
„Du hast mein Mitgefühl und meinen Segen“, fuhr der Johanniter mit einem freundlichen Lächeln fort. „Ich werde heute deine Frau und dein totgeborenes Kind in meine Gebete einschließen“, versprach er. Dann machte er eine ausholende Handbewegung.
„All diese Pferde müssen beschlagen werden. Wir brauchen Verpflegung – und wir bezahlen“, sagte er.
Es gab schlechtere Möglichkeiten, den Kummer zu vergessen, in dem er steckte, sagte sich Balian. Und wenn sie auch brav bezahlten – was, bei Gott, nicht alle diese hoffärtigen Adligen taten – sollte es ihm recht sein. Es wartete ja ohnehin niemand auf ihn mit dem Abendessen … Er würde früh genug auf sein einsames Strohlager kommen … Balian nickte wortlos.
„Er sagt ja!“, rief Michel begeistert.
Auf Balians schweigendes Zeichen brachte sein Lehrling den Kreuzrittern etwas zu essen. Die meisten ließen sich im schwachen Sonnenschein vor der Schmiede nieder und aßen dort, neugierig beäugt von den Dorfkindern. Godfreys schwarzer Gefolgsmann, Firuz, weckte das Interesse der Kinder besonders. Eines war sogar so mutig, Firuz ins Gesicht zu fassen, um zu sehen, ob die Farbe echt war. Firuz revanchierte sich lachend, kniff den kleinen Frechdachs leicht in die Wange und erntete dafür begeistertes Lachen der Kinder, die seine für Frankreich exotische Erscheinung einfach nur spannend fanden.
Währenddessen pries Michel die Vorzüge seines Bruders mit dem Talent eines Marktschreiers:
„Er hat großartige Belagerungsmaschinen gebaut. Er hat Kriegsmaschinen gebaut, die die größten Steine schleudern.“
Wie zur Unterstützung seiner Behauptung wedelte er mit den Armen, als ob er Steine warf.
„Und er macht die feinsten Silberarbeiten“, setzte er hinzu und wandte sich mit einem etwas unsicheren Lächeln an Odo, einen bulligen Deutschen, der in der wärmeren Schmiede zum Essen Platz genommen hatte und Balian bei seiner Arbeit interessiert zusah.
„Er wird einer der wenigen auf Eurer Reise sein, dessen Tod ein Verlust wäre“, fügte er hinzu.
Odo wischte sich den Mund mit seinem blonden Zopf ab. Der anbiedernde Ton des Priesters störte ihn.
„Sei still!“, raunzte er Michel an. „Warst du im Krieg?“, wandte er sich dann an Balian, der eins der zu beschlagenden Streitrösser beruhigend streichelte.
„Als Reiter“, erwiderte der junge Schmied und ging zum Amboss. „Und ebenso als Maschinist.“
„Für wen und gegen wen hast du gekämpft?“, fragte Odo weiter. Einen Mann mit Kampferfahrung als Schmied in einem eher abgelegenen Dorf zu treffen, war ebenso selten wie erfreulich.
„Für einen Fürsten gegen einen anderen“, sagte Balian und schlug ein weiteres Nagelloch in das Hufeisen, das er gerade anpassen wollte. „An einem Ort, der in Vergessenheit geraten ist“, versetzte er. An diese Geschichte wollte er nicht mehr erinnert werden, hatte sie aus seinem Gedächtnis gestrichen.
„Es geht jetzt um Größeres: ein Gott gegen einen anderen“, lockte Odo. „Dementsprechend ist der Sold.“
„Das sagte ich ihm bereits“, warf Michel beflissen ein und erntete einen vernichtenden Blick Odos.
Wie im Traum kam Godfrey langsam in die Schmiede und ging, wie magisch angezogen, zur Veranda. Sein Blick fiel auf den alten Obstgarten, dessen Bäume immer noch so sauber beschnitten waren wie zu Zeiten des alten Meisters Balian. Es war kalt und trüb, doch vor Godfreys innerem Auge erschien ein Sommertag. Er sah im Garten zwei Gestalten: Einen jungen Mann mit dunklem Haar in schwarzem Waffenrock über dem Kettenhemd und eine junge Frau mit hellbraunem Haar, die miteinander schäkerten. Ein Lächeln seliger Erinnerung zeigte sich auf Godfreys Gesicht, als er daran dachte, dass der junge Mann er selbst gewesen war und die junge Frau die Mutter des jungen Schmieds. Er hatte ihre Augen, eindeutig … So sanft und braun, ja das waren ihre Augen …
Dann erlosch sein Lächeln, als er daran dachte, dass da noch etwas zu bereinigen war. Etwas, was ihm sehr schwer fallen würde. Er spürte, dass Bruder Jean neben ihn trat.
„Haltet … Ihr an dem Ratschlag fest, den Ihr mir gegeben habt?“, fragte Godfrey und sah Jean nur halb von der Seite an.
„Das tue ich, Mylord“, erwiderte Jean. „Ich weiß, dass dieser Mann, Balian, um sein Weib trauert.“
Kapitel 6
Der Sohn des Freiherrn
Odo sah nach oben und bemerkte die lateinische Inschrift in dem Firstbalken über Balians Kopf. Sie lautete: nemo vir est qui mundum non reddat meliorem. Latein außerhalb der Kirche, noch dazu in so einem Nest, das war ungewöhnlich – mindestens so ungewöhnlich wie ein Schmied, der schon gekämpft hatte …
„Was bedeutet das?“, fragte Odo interessiert.
„Was für ein Mann ist ein Mann, der die Welt nicht verbessern will?“, gab Balian Auskunft und hämmerte das Hufeisen zurecht, das er auf dem Amboss hatte. Die Inschrift war schon der Wahlspruch seines Vaters gewesen, der einst beim Bau der Schmiede den Firstbalken entsprechend verziert hatte. Er hatte dieses Motto an Balian weitergegeben, ihn über die Bedeutung der eingravierten Worte aufgeklärt und dafür gesorgt, dass sein wissbegieriger Älterer nicht nur Lesen und Schreiben lernte, sondern auch etwas Latein mitbekam.
„Lasst mich mit diesem Mann allein!“, forderte Godfrey Odo und den inzwischen ebenfalls in die Schmiede hineingekommenen Firuz auf, die sich augenblicklich erhoben und die Schmiede verließen. Nur Balian blieb zurück, zeigte aber keinerlei Interesse an dem fremden Ritter. Er konzentrierte sich auf das Hufeisen, das er momentan formte.
„Gott hat uns zu Menschen gemacht. Wir … alle müssen leiden. Es tut mir Leid zu erfahren, dass du Weib und Kind verloren hast …“, setzte Godfrey langsam an. Balian schien ihn nicht zu hören, aber dann sah er den Ritter doch an und nickte kaum merklich.
„Auch ich habe … Verluste … erlitten“, fuhr Godfrey fort. Balian sah ihn unverwandt an. Es war freundlich von dem Ritter, ihm Trost zuzusprechen, aber es linderte keinen Augenblick den ungeheuren Schmerz seines Verlustes, so empfand Balian es.
„Manche sagen, Jerusalem sei der Ort, an dem alle Sünden verziehen werden können. Für mich ist es hier – jetzt …“, setzte der Ritter fort.
Balian verstand nicht, was der Ritter damit ausdrücken wollte. Aber Adlige sagten so viel daher, was ein einfacher Mann nicht verstand, sagte er sich und prüfte das Hufeisen, das er gerade bearbeitete. Nein, die Schenkel waren nicht in einer Ebene … Er hämmerte weiter.
„Ich kannte deinen Namensvetter. Ich … kannte … deine Mutter“, fuhr Godfrey fort, nahm seine Unterziehhaube ab, die er normalerweise unter der Kettenhaube und dem Helm trug, und knüllte sie zusammen. Balian sah langsam hoch und blickte Godfrey ungläubig und verwirrt an. Kennen – das war zwischen Mann und Frau gleichbedeutend mit dem Umstand, dass sie miteinander das Kissen geteilt hatten. Der junge Schmied begriff, und es traf ihn erneut wie ein Schlag mit seinem eigenen Schmiedehammer … Reichte sein Kummer noch nicht? Musste er sich jetzt auch noch sagen lassen, dass er der uneheliche Sohn eines ihm bis zu diesem Tag völlig Fremden war, der es nie für nötig befunden hatte, sich dazu zu bekennen? Nun – er tat es jetzt, aber warum? Warum ausgerechnet in diesem Moment, in dem er, Balian, genug andere Sorgen hatte? Doch nicht nur Balian bekam große Ohren; auch Michel draußen vor der Schmiede bekam eine Ahnung, dass hier Dinge geschahen, die eine deutliche Veränderung in Saint-Martin-au-Bois bewirken konnten.
„Höflicherweise sollte ich bemerken, dass es gegen ihre Einwände war, dass ich der Bruder des Fürsten war und dass sie keine Wahl hatte – aber … ich habe sie nicht gezwungen“, sagte Godfrey stockend. Einst hatte er geschworen, stets die Wahrheit zu sagen, unabhängig davon, was das für ihn selbst bedeuten konnte. Aber es fiel ihm in diesem Moment sichtlich schwer, es zu tun …
Godfrey konnte nicht erkennen, ob der junge Mann ihm glaubte, ihm verzieh oder ob er ihn gleich erschlagen würde, so abgeschottet war dessen Blick. Godfrey gehörte zu den Menschen, die für gewöhnlich nur in die Augen ihres Gegenüber zu sehen brauchten, um deren Empfindungen zu erkennen – bei Balian war es ihm nicht möglich. Es schien, als habe der junge Mann eine Wand in seinen Augen aufgebaut, eine undurchdringliche Festung.
„Ich habe die Pflicht, dich um Vergebung zu bitten“, fuhr Godfrey fort und senkte den Kopf. Balian sah ihn eher verstört an. Höchst ungewöhnlich, dass einer von diesen hochfahrenden Adligen sich vor einem gemeinen Mann wie ihm verbeugte. Zwar hatte Godfrey ihm, ohne es direkt auszusprechen, zu verstehen gegeben, dass er sein Vater war, aber konnte das überhaupt wahr sein? Balian entschloss sich, dem Fremden nicht zu glauben. Er drängte sich an dem in der Verbeugung verharrenden Ritter vorbei, um das Eisen erneut zu erhitzen. Godfrey drehte sich um und ging dem jungen Schmied nach.
„Ich bin Godfrey, Baron von Ibelin. Ich habe in Jerusalem hundert Männer unter Waffen. Wenn … du mit mir kommst, wirst du ein Auskommen haben – und meinen Dank. Das ist mein Angebot“, fuhr er fort. Balian sah auf. Der Ältere bemerkte, dass die Mauer in den dunklen Augen seines Sohnes fiel, aber keineswegs, um in stürmische Begeisterung zu münden. Unendliche Qual, Einsamkeit und tiefe Trauer spiegelten sich darin – und die größer werdende Wut. Balian war das Ebenbild seiner Mutter. Ebenso wie seine Mutter konnte der junge Mann mit nur geringen Veränderungen seines Augenausdrucks eine ganze Palette von Empfindungen seinem Gegenüber verdeutlichen – und das, was Godfrey jetzt in den Augen seines Sohnes sah, war pure Ablehnung, Zorn …
Balian beherrschte sich nur noch mit Mühe, seinem Zorn nicht freien Lauf zu lassen. Nicht nur, dass dieser Baron ihm nur knapp durch die Blume sagte, dass er nicht der Sohn des Schmieds war, wie er sein Leben lang geglaubt hatte, nein, jetzt wollte der ihn auch noch mitnehmen! Was bildete sich dieser Mann eigentlich ein? Sollte er Natalie und seine Mutter, seinen Ziehvater – einen Mann großer Güte und technischen Geschicks, der ihn sein Handwerk gelehrt hatte – etwa allein in Frankreichs kalter Erde zurücklassen? Sicher, sein jüngerer Bruder Michel, der hier im Dorf jetzt Priester war, hätte die Gräber versorgen können, aber für Balian war das nicht das gleiche. Insbesondere nicht, was seine geliebte Natalie betraf. Um deren Grab würde sich Michel nicht in hundert Jahren kümmern …
Mit aller Beherrschung, die ihm noch geblieben war, schüttelte Balian den Kopf. Für Godfrey sah die Bewegung eckig und unkontrolliert aus, als ob eine Lähmung den jungen Mann gepackt hatte.
„Wer Ihr auch seid, Mylord. Mein Platz ist hier!“, versetzte der Schmied kühl, dennoch leise und wehmütig. Godfrey seufzte. Der Junge war ein wesentlich härterer Brocken, als er nach den Worten des Priesters vermutet hatte. Der hatte ihn als freundlichen, höflichen und klugen Mann beschrieben. Godfrey wurde klar, dass die Trauer um zwei geliebte Menschen, die sein Sohn in kurzer Zeit so plötzlich und unerwartet verloren hatte, diesem Mann fast den Boden unter den Füßen weggerissen hatte.
„Was es zu deinem Platz gemacht hat, ist jetzt tot“, versetzte Godfrey schroff, doch er bereute die groben Worte augenblicklich, als er die Trauer in den Augen seines Sohnes sich wieder verstärken sah, auch wenn er nicht geglaubt hatte, dass das noch möglich war. Es tat ihm Leid.
„Du wirst mich nie wiedersehen. Wenn du etwas von mir willst, dann nimm es jetzt!“, beschwor Godfrey den jungen Mann.
Balian überlegte einen Moment. Was konnte dieser Mann ihm bieten? Nichts, was er für seine Zukunft ohne seine Frau und sein Kind benötigte. Er musste allein mit seiner Trauer und seinem Unglück fertig werden. Langsam schüttelte er den Kopf.
„Ich will nichts“, sagte er leise, aber bestimmt. Seine dunkelbraunen Augen waren voller Trauer, gleichzeitig aber stumpf und leer, glanzlos und beinhalteten so viel Bitterkeit, dass es Godfrey schauderte. Der Baron stülpte die Kappe wieder über.
„Ich bedaure deine Unbill“, sagte er. „Gott beschütze dich.“
Damit wandte er sich ab und verließ die Schmiede. Weder hatte sein Sohn ihm vergeben noch hatte er ihn überreden können, ihm nach Ibelin zu folgen. Godfrey war sicher, dass er und sein Sohn spätestens wirklich miteinander vertraut gewesen wären, wenn sie Ibelin erreicht hätten. Es war eine Reise von Monaten, in denen Vater und Sohn einander gut hätten kennen lernen können. Aber wieder einmal schien das Schicksal andere Pläne zu haben – wie schon so oft …
Er stieg in den Sattel seines Grauschimmels und folgte seinen Leuten, nachdem sein Knappe Balians Lehrling Arbeitslohn, Material und Bewirtung bezahlt hatte. Doch dann drehte er noch einmal um und ritt zurück zu der Schmiede. Der junge Schmied trat heraus und beäugte den Baron misstrauisch. Godfrey hielt vor ihm an und lächelte ihm zu.
„Jerusalem ist leicht zu finden“, sagte er. „Geh dorthin, wo man italienisch spricht – und dann geh weiter, bis man etwas anderes spricht. Wir ziehen an Messina vorbei“, erklärte er den Weg nach Jerusalem. Vielleicht überlegte sein Sohn sich es ja doch noch. Dann hatte er wenigstens eine Wegbeschreibung, um zu seinem Vater zu gelangen, sagte sich Godfrey. Mit einem Nicken drehte er wieder um und eilte seinen Männern nach, die schon voraus geritten waren. Balian sah ihm nach und war sicher, dass er die richtige Entscheidung getroffen hatte, wenn er blieb.
Als er sich wieder seinem Haus zuwandte, sah er dort Michel stehen, der mit einem gereizten Seufzen die Schultern zuckte und kopfschüttelnd davon stürmte.
Kapitel 7
Fahr zur Hölle
Später – es war längst dunkel und der kurze Wintertag der langen Nacht gewichen – arbeitete Balian allein in seiner Schmiede. Durch die eilig zwischengeschobenen Beschläge für die Kreuzritter war einiges von dem liegen geblieben, was er sich für den heutigen Tag vorgenommen hatte. Der Vizegraf hatte Schwerter bestellt, die dringend fertig werden mussten Seinen Lehrling hatte der Schmiedemeister längst heimgeschickt. Zum einen nutzte er seinen Lehrling nicht aus, das wäre ihm nicht im Albtraum eingefallen, zum anderen war der Junge noch nicht soweit in die Feinheiten der Schmiedekunst vorgedrungen, dass er seinem Meister eine echte Hilfe bei der Fertigung von Klingen gewesen wäre.
„Das Dorf will dich nicht!“, hörte er die Stimme seines Bruders Michel. Der Priester kam in den Lichtschein des Schmiedefeuers, das der Ältere gerade heftig anheizte. Balian schwieg, wie fast die ganze Zeit seit dem Tod seiner Frau.
„Wenn der alte Fürst stirbt, werden sie dich verjagen! Wenn der Erzbischofstirbt, ist es gewiss“, drohte Michel. Beide schätzten die Arbeit des Schmieds hoch, sorgten für lukrative Aufträge und hielten ihre schützende Hand über Balian. Aber der Rest des Dorfes würde ihn nicht länger dulden. Selbstmord war eine Todsünde – und die fiel auch auf den Ehemann der Selbstmörderin und das ganze Dorf zurück.
„Und meine Besitztümer gehen an dich“, stellte Balian fest. Wer auf einen Kreuzzug ging, gab in der Regel in der Heimat alles auf. Der eine Grund betraf die eher armen Leute, die allein schon für die Überfahrt schier Haus und Hof verkaufen mussten, dann aber immer noch keine Waffen hatten. Dafür verdingten sich die meisten gewöhnlichen Leute bei Adligen als Söldner und wurden dann entsprechend ausgerüstet. Der andere Grund, Haus und Hof den Menschen zu überlassen, die den Kreuzfahrer ohnehin beerben würden, traf bei den reicheren Leuten zu. Sie wollten sich im Orient eine neue Existenz aufbauen und hatten an ihrer alten Heimat kein Interesse mehr.
„An die Kirche“, korrigierte Michel geflissentlich. Balian hatte außer ihm keine Verwandten, denen er etwas hinterlassen konnte, also erbte die Kirche seinen Besitz. Doch Michel hatte nicht mit Balians Scharfsinn gerechnet.
„An dich“, beharrte er. Père Michel war schließlich die Kirche in Saint-Martin-au-Bois, der Erzbischof hatte seinen Sitz in Chartres …
Michel verzichtete auf Widerworte, wusste er doch nur zu gut, dass der intelligente Balian in diesem Punkt Recht hatte. Dennoch wunderte Michel sich, dass sein Bruder ihm überhaupt widersprach. Das war ungewöhnlich. Er ging darüber hinweg. Mochte der Ältere ihm auch erstmals widersprochen haben: Wenn er ihn erst einmal in Richtung Jerusalem los war, musste er sich über die plötzliche Aufmüpfigkeit Balians keine Gedanken mehr machen, sagte sich Michel. Was die Besitztümer betraf, hatte Michel von der Schmiedekunst zwar so viel Ahnung wie Balians Hahn von der heiligen Messe, aber er konnte die Schmiede an einen anderen Schmied verpachten, vielleicht sogar an Balians jetzigen Lehrling, wenn der erst nur Schmiedemeister war. Der Junge würde ihm keine Probleme bereiten … Er musste nur dafür sorgen, dass sein Bruder auch wirklich ging.
„Sie hätten dich mit nach Jerusalem genommen – fort von all dem hier. Ich hatte dafür gesorgt“, beschwerte sich Michel bei seinem ihm so undankbar erscheinenden Bruder. „Ich schwöre, dir, du wirst keinen Frieden finden, solange du hier verweilst. Kein Mann hat je eine neue Welt mehr gebraucht“, fuhr er fort und setzte sich halb auf den Hufeisenamboss, den der Schmiedemeister jetzt nicht benötigte. „Du könntest dich von Sünde und Schmerz befreien. Ausgelöscht – alles!“, warb er erneut für den vom Papst versprochenen vollkommenen Ablass aller Sündenstrafen. „Wenn du mit auf den Kreuzzug gehst, erleichterst du vielleicht das Los deiner Frau in der Hölle“, setzte er hinzu.
Balian sah ihn zwar schweigend, aber drohend an. Michel erkannte die Gefahr nicht, bemerkte nicht, dass die Wut seines Bruders kurz vor dem Siedepunkt war, dass hier ein Vulkan kurz vor der Eruption stand. Balian war immer ein sanfter, zurückhaltender Mensch gewesen. Michel kannte ihn nicht anders als freundlich und sanftmütig. Zuweilen kehrte der Priester die geistliche Autorität heraus, der dem gemeinen Mann ungebetene Ratschläge gab. In diesem Fall begriff Michel nicht, dass Balian sich so eine Gelegenheit entgehen lassen konnte. Aber er hatte diese Rechnung offenbar ohne die Sturheit seines Bruders gemacht … Er sah sich genötigt, dem etwas nachzuhelfen. Er musste Balian dazu überreden, dem Baron zu folgen! Erst dann kam er an das, was ihm eigentlich schon seit dem Tod seines Vaters zustand: an die Schmiede und den sonstigen weltlichen Besitz des alten Schmiedes Balian. Sein Bruder hatte nie ein Anrecht darauf gehabt, weil er gar nicht der Sohn des Schmiedes war, sondern der Bastard des Godfrey du Puiset! Michel hätte nie gewagt, das laut auszusprechen. Dazu hatte er zu viel Respekt vor der Kraft seines Bruders.
„Ich … will es … taktvoll ausdrücken: Sie war eine Selbstmörderin! Sie ist in der Hölle!“, stellte Michel hart und alles andere als taktvoll klar.
Balian unterdrückte ein zorniges Zittern nur noch mit aller Beherrschung, zu der er fähig war. Seine Natalie in der Hölle? Unmöglich!
‚Hör’ endlich auf!’, durchzuckte es ihn. ‚Halt den Mund, sonst kann ich für nichts mehr garantieren!’, dachte er. Inzwischen war sein viel zu lange unterdrückter Zorn so groß, dass er nicht mehr fähig gewesen wäre, seinen Bruder verbal vor dem zu warnen, was er mit diesen Ungeheuerlichkeiten heraufbeschwor. Doch Michel hörte nicht auf.
„Ich frage mich nur, was sie da ohne Kopf macht …“, sagte er und sah seinen Bruder halb von unten her mit einem höhnischen Grinsen an. Das Halbdunkel der Schmiede verbarg die tödliche Schwärze von Balians sonst so warmen, braunen Augen, als er den Blick Michels erwiderte. Dann sah er im Widerschein des Feuers etwas am Hals seines Bruders glitzern. Seine linke Hand griff zu und ertastete ein Kreuz – nein, nicht ein Kreuz, es war Natalies Kreuz! Balian zog es an dem Lederband aus Michels Kutte. Einen langen Augenblick lang knisterte nur das Feuer in der Esse, dann entrang sich dem Witwer ein schier unmenschlicher Wutschrei, als er Michel mit der Linken am Kragen zu fassen bekam, mit der Rechten eine der glühenden, halbfertigen Klingen packte – und sie seinem Bruder in den Leib rammte.
Michel brüllte vor Schmerz auf, stolperte von dem Hufeisenamboss rückwärts direkt in die lodernden Flammen der Esse hinein. Seine Kutte fing sofort Feuer. Balian drückte noch einmal nach, packte aber gleichzeitig das Silberkreuz und riss es Michel mit einem Ruck ab. Der Ruck beförderte den brennenden Priester wieder aus der Esse. Wie eine lebende Fackel wankte Michel schreiend durch die Schmiede. Holzteile und herumliegendes Stroh entzündeten sich rasch. Schließlich stürzte er vor einem Amboss zu Boden, wo er starb. Balian löschte hastig die Flammen, die seinen Ärmel ergriffen hatten. Dann sah er auf das Kreuz in seiner Hand – und die tiefe, Brandwunde, die das glühend heiße Metall in seiner Handfläche hinterlassen hatte.
Die Flammen schlugen höher. Balian deckte sich mit einem Arm gegen die wabernde Hitze und floh aus seiner brennenden Schmiede. Draußen griff er sich sein Pferd, das angebunden vor der Schmiede stand und ob des sich ausbreitenden Feuers immer panischer wurde. Er schwang sich behände in den Sattel und galoppierte in die Richtung, in der Godfrey und seine Männer verschwunden waren.
Der Kreuzzug mit dem Baron von Ibelin nach Jerusalem war seine letzte Chance, diese Sündenlast, die er sich aufgeladen hatte, wieder loszuwerden – und der sehr irdischen, aber tödlichen Macht des Vizegrafen zu entgehen …
Kapitel 8
Suche nach Vergebung
Der fliehende Schmied ritt die ganze Nacht durch. Er folgte nicht irgendwelchen Spuren, er nahm einfach die Straße nach Südosten, die in Richtung Italien. Seine Hand begann zu schmerzen, als die Anspannung nachließ. Balians Flucht war nicht mehr unmittelbare Rettung aus tödlicher Gefahr und das quittierte sein durch Trauer und Übernächtigung erschöpfter Körper nicht nur mit immer stärker werdendem Kältegefühl, sondern auch mit auftretenden Schmerzen in der verbrannten Handfläche. Balian nahm die rechte Hand hoch und zog sich den Gugelkragen zu. Damit hatte er die verletzte Hand vom scheuernden Zügel fort und behielt noch etwas Wärme um sich. Der feuchtkalte Wind und die wirbelnden Schneeflocken schienen ihm den letzten Rest an Kraft aus der überstrapazierten Muskulatur saugen zu wollen.
Als es langsam tagte, sah er vor sich einen Wald, in den der Weg hineinführte, dem er unbeirrbar folgte. Im Wald verstärkte sich der Morgendunst zu eisigem Nebel, durch den in einem nun zwar gedämpften, aber immer noch eiskalten Wind langsam Schneeflocken segelten und die Spur der Pferde vor Balian allmählich verdeckten. Der treue Grauschimmel trug seinen Herrn weiter, zunächst ein Stück hinab, dann wurde der Weg wieder ebener um zu einer Rechtskurve hin anzusteigen. Balian konnte im Nebel nicht um die Biegung sehen, aber er hörte leise Stimmen; etwas, das wie:
„Wartet hier!“, klang. Vorsichtig zügelte er sein Pferd und blieb abwartend stehen. Der Dunst verzog sich für einen Moment und Balian bemerkte, dass er nun etwas besseren Einblick auf den Weg hinter der Kurve hatte. Undeutlich und schemenhaft erkannte er berittene Gestalten, von denen eine in seine Richtung kam.
Es war Godfrey, der als Letzter, als seine eigene Nachhut, ritt und hinter sich Hufschläge vernommen hatte. Er machte in der leisen Hoffnung kehrt, dass es sein Sohn war, der ihnen folgte. Doch als er ihn sah, konnte er nicht recht ermessen, in welcher Absicht der junge Mann ihnen gefolgt war. Zu verschlossen hatte er sich gegeben, als dass God-frey sich über die tatsächlichen Gefühle sicher sein konnte, die sein Sohn ihm entgegenbrachte. Die seltsam vor die Brust gehaltene Hand verbesserte keinesfalls den Einblick in Balians Gedankenwelt.
„Bist du gekommen, um mich zu töten? Selbst in diesen Tagen ist das nicht leicht“, warnte Godfrey. Balian antwortete nicht, sah seinen Vater nur starr an. Was ging nur in seinem Kopf vor? Godfrey stellte sich diese Frage zum wiederholten Mal.
„Was ist?“, hakte der Baron nach.
Balian gab sich einen Ruck und trieb den Grauschimmel weiter vor. Es war tatsächlich sein Vater, der ihm entgegenkam. Er ritt vor, bis ihre Pferde fast Nüstern an Nüstern standen.
„Ich habe es getan …“, murmelte er. In seinen weit aufgerissenen Augen standen noch der Schock und der Unglaube über seine eigene Tat. „Gemordet“, brachte er mit sichtbarem Entsetzen hervor. Godfreys Züge entspannten sich leicht.
„Haben wir das nicht alle?“, erkundigte er sich. Der Baron wollte lieber nicht nachzählen, wie viele Menschen er schon mithilfe seines Schwertes unter die Erde gebracht hatte.
Balian sah kurz zu Boden, dann hob sich sein Blick wieder langsam zu seinem Vater. Ein leiser Hoffnungsschimmer keimte in ihm auf.
„Ist es wahr, dass ich in Jerusalem all meine Sünden auslöschen kann?“, fragte er „… und die meines Eheweibs?“, setzte er vorsichtig hinzu. „Ist es wahr?“
Godfrey lächelte. Diese Frage enthielt so viel tiefen Glauben und gleichzeitig so unendlichen Zweifel, dass er nie für möglich gehalten hätte, es könne jemals in einem einzigen Satz zusammengebracht werden.
„Das können wir gemeinsam herausfinden“, erwiderte er mit einem sanften Lächeln, das Balian verlorenes Vertrauen zurückgab. „Zeig’ mir deine Hand!“, forderte Godfrey ihn dann auf.
►Als die Nacht hereingebrochen war, lagerten die Kreuzfahrer in einem Wald nahe an einem schmalen, glasklaren Fluss. Firuz nahm sich auf Godfreys Geheiß der Brandwunde in Balians Hand an. Mit einem leisen, fremdartigen Singsang strich er Salbe auf die schlimme Verbrennung und verband sie dann mit einem sauberen Leinenstreifen. Bruder Jean, der als Johanniterritter nicht nur Mönch und Ritter in einer Person war, sondern auch Heilkundiger, trat hinzu und reichte Balian einen Becher, den der junge Mann mit einem leichten Lächeln annahm, das so dankbar wie freundlich war.
„Das ist vom Mohn, der im Osten wächst. Ich denke, dass dies in Wahrheit jener Lotos ist, von dem die Gefährten des Odysseus aßen. Er betäubt jeden Schmerz. Eine Brandwunde braucht das – und Salbe“, erklärte Jean. Balian sah den Becher noch einmal skeptisch an, dann trank er von der Opiumlösung, die der Arzt ihm verordnet hatte. Die betäubende Wirkung setzte rasch ein, Balians Pupillen erweiterten sich deutlich, die Welt begann sich zu drehen. Benebelt sah er auf – und im selben Moment schoss eine Sternschnuppe über den Himmel. Auch die Köpfe Godfreys und seiner Männer zuckten ob der Himmelserscheinung nach oben. Bruder Jean bekam ein amüsiertes Lächeln, wusste er doch um die abergläubische Furcht, die die meisten Menschen ergriff, wenn sie Sternschnuppen fallen sahen.
„Vielleicht ist Jerusalem gefallen“, bemerkte er spöttisch und sah Balian an, der mit glasigem Blick den Himmel beobachtete. „Es hat keine Bedeutung, glaub mir“, setzte er dann hinzu. Balian senkte den Kopf und stierte wie ein Betrunkener seinen Vater an. Godfrey hatte, sich Balian gegenüber auf der anderen Seite des Lagerfeuers schon in seine Satteldecke gewickelt niedergelegt, benutzte den Sattel als Kopfkissen und beobachtete ihn mit gewisser Besorgnis. Dann fielen Balian die Augen zu. Erschöpft von Kummer und Strapazen, betäubt vom Opium, fiel er in tiefen, erholsamen Schlaf.◄
Kapitel 9
Der Wächter des Falken
Der neue Tag brach an. Er war ebenso trüb und nasskalt wie die vorangegangenen. Schneeflocken mischten sich mit dem im Wald entschärften Wind. Langsam erwachte das Lager zum Leben. Bruder Jean packte sein Wasch- und Rasierzeug am Flussufer aus, klappte einen kleinen Behälter mit Zahnputzpulver auf, feuchtete einen kleinen Weidenzweig, dessen eines Ende er mithilfe eines Messers und Wasser zu einem steifhaarigen Pinsel ausgefranst hatte, im klaren Wasser an, nahm damit Pulver auf und putzte sich die Zähne.
Nicht weit von ihm kam Firuz an den Fluss. Ein plätscherndes Geräusch, das das leise Rauschen des Flüsschens übertönte, weckte die Aufmerksamkeit des Nubiers*. Er sah in die Richtung, aus der das Geräusch kam und bemerkte den Knappen Philippe, der auf einer kleinen Felsinsel im Fluss stand – und mit kräftigem Strahl hinein pinkelte. Firuz brüllte ihn auf Arabisch an, er solle das gefälligst bleiben lassen. Wasser war schließlich zum Trinken da, und was Philippe da tat, war entweder völlig gedankenlos oder unverschämt, auf jeden Fall aber eine Schweinerei. Philippe reagierte nicht und trollte sich erst, als Firuz ihn mit einem Stein bewarf und ihm damit unmissverständlich klarmachte, dass es noch Ohrfeigen setzen würde, wenn er jetzt nicht augenblicklich aus dem Fluss verschwand. Schmollend packte Philippe sich wieder ein und sprang an Land, ging ein Stück von Lager weg, um wenigstens sein großes Morgengeschäft in Ruhe zu erledigen.
Sergeant* Kevin saß beim Feuer, über dem ein Hase am Spieß briet, hielt eine Schüssel unter den Hasen, fing das herunter tropfende Fett auf und verrührte es mit bereits darin befindlichem, schon erkaltetem Fett und Sand, den er aus den Fluss geholt hatte. Mit dieser Mischung behandelte er das Kettenhemd Godfreys, was die Kettenglieder einerseits von Schmutz befreite und polierte und gleichzeitig durch den Fettanteil konservierte und flexibel bleiben ließ. Zwar verbreitete ein solcherart gefettetes und geschliffenes Kettenhemd mit der Zeit einen recht unangenehm ranzigen Duft, doch die Ritter stanken alle in ähnlicher Art, so dass dies kaum auffiel – jedenfalls, solange sie ihre Rüstungen trugen. Die Ritter, die im Orient lebten, hatten die hygienischen Vorstellungen der Araber weitgehend übernommen, badeten regelmäßig und wuschen sich mit kostbaren, duftenden Essenzen.
Godfrey schüttete den Rest seines Frühstücksgetränks in das Feuer und sah seinen Sohn an, der nach wie vor schlief und sich von den Aktivitäten im Lager nicht stören ließ. Der Baron hatte ihn in Ruhe schlafen lassen, weil ihm klar war, dass er Ruhe nötig hatte. Oft hatte er zu dem jungen Mann hingesehen. Wenn er so entspannt schlief wie jetzt, zeigte sich sein unglaublich gutes Aussehen in seiner vollen Schönheit. Godfrey sah seine verflossene Liebe in diesem ohne jeden Zweifel schönen Mann. Er hatte viel Ähnlichkeit mit seiner Mutter. Die schönen, braunen Augen, die so viel Sanftmut und Verletzlichkeit zeigten, waren vollkommen das mütterliche Erbe, aber das dunkle, leicht gewellte Haar und die schlanke Gestalt hatte er von Godfrey geerbt. Der Ältere machte sich zum wiederholten Mal Vorwürfe, dass er fünfundzwanzig Jahre gebraucht hatte, sich die Zeit zu nehmen, sich um seinen Sohn zu kümmern. Gewiss, es war etwas aus ihm geworden – nach den Maßstäben gemeiner Menschen hatte Balian es als selbstständiger Handwerksmeister durchaus zu etwas gebracht – aber für Godfrey waren es nicht ganz die richtigen Eigenschaften, die bei seinem Jungen gefördert worden waren. Balian sollte sein Erbe sein, sollte eines Tages Herr von Ibelin sein, dem König von Jerusalem treue Dienste in Frieden und Krieg erweisen und dafür Sorge tragen, dass es weiterhin ein lebendiges Gewissen christlicher Prägung an maßgeblicher Stelle an der Seite des Königs gab.
Godfrey gab sich einen Ruck und riss sich aus seinen Betrachtungen los. Möglicherweise gab es noch viel zu tun, um aus Balian einen passablen Erben Ibelins zu machen. Es empfahl sich, möglichst umgehend festzustellen wie viel … Der Baron zog ein eineinhalbhändiges Schwert aus dem Sattelgepäck und warf es neben dem langsam erwachenden Balian auf den Boden. Balian, der nicht mehr ganz fest geschlafen hatte, zuckte hoch und sah seinen Vater und dann das neben sich liegende Schwert etwas verschlafen an.
„Heb es auf!“, kommandierte Godfrey. „Mal sehen, aus welchem Holz du geschnitzt bist.“
„Seine Hand ist verletzt!“, mahnte Bruder Jean. Godfrey zeigte ein kühles Lächeln, schnallte sich seinen Schwertgürtel fester und sagte:
„Ich habe mal zwei Tage mit einem Pfeil in meinem Hoden gekämpft!“
Jean hob die Augen seufzend gen Himmel. Jeglichen Hinweis auf gesundheitliche Einschränkungen pflegte Godfrey mit diesem Einwand ohne Nachsicht vom Tisch zu wischen. Hatte er eventuell vergessen, in welcher Situation er damals gewesen war? Es war um Leben und Tod gegangen, nicht um einen einfachen Übungskampf, nicht um eine Feststellung, welche grundsätzlichen Fähigkeiten ein Mann hatte und welche weiterer Übung und Lehre bedurften.
Balian stand wortlos auf und hob das Schwert auf, hielt es mit beiden Händen schräg abwärts vor sich. Sein Vater griff ihn an und Balian hatte sichtlich Mühe, das Schwert richtig festzuhalten. Die Brandwunde in der Handfläche riss sofort auf und verursachte heftige Schmerzen. Er stolperte rückwärts über den unebenen Waldboden, sein Vater schlug im Vorwärtsgang hart zu, dass Balian die Hiebe kaum parieren konnte. Mehr instinktiv als bewusst reagierte er, aber er gab auch nicht auf, wie Godfrey anerkennend feststellte. Godfrey brach die Attacke ab.
„Benutze niemals eine tiefe Deckung!“, mahnte er dann. „Du kämpfst gut“, zollte er den Bemühungen seines Sohnes die fällige Anerkennung. „Arbeiten wir an deinen Fähigkeiten“, setzte er hinzu und ging ein Stück zurück, damit der Übungskampf seine Männer nicht gefährdete. Balian folgte ihm mit gesenkter Klinge.
In sicherer Entfernung hob Godfrey sein Schwert über den Kopf und nahm eine abwartende, aber wachsame Haltung ein.
„Wähle eine hohe Deckung – so etwa. Die Italiener nennen das ‚La poste di falcone’, die Wacht des Falken. Du schlägst von oben“, erklärte er und führte einige Hiebe von oben her aus. Balian beobachtete sie und nahm dann selbst diese Position ein, wie er sie sich abschaute.
„Halt das Schwert gerade!“, korrigierte Godfrey. „Komm schon, das Bein nach hinten, Knie durchdrücken! Halt das Schwert gerade! Verteidige dich!“
Godfrey schlug zu und traf die Klinge seines Sohnes, der von der Wucht des Hiebs zurückgeworfen wurde. Aber er wehrte sich tapfer, obwohl die Brandwunde höllische Schmerzen verursachte. Godfrey unterlief die nächsten Hiebe, packte plötzlich den Schwertgriff mit der Linken und die Klingenspitze mit der Rechten, drückte es mit Schwung gegen Balian, der sein Kinn nur knapp vor der Parierstange des Schwertes und die ungeschützte Kehle vor der scharfen Klinge in Sicherheit bringen konnte.
„Ein Schwert besteht nicht nur aus der Klinge!“ grinste Godfrey. Tricks waren also auch erlaubt, schloss Balian aus diesen Worten.
„Greif an!“ forderte Godfrey den jungen Mann auf, der auch gehorsam angriff. Die Haltung fühlte sich richtig an. Schließlich schlug er auch mit dem Hammer von oben her zu. Die geforderte Haltung kam dem Schmied entgegen.
Balian verstand es, aus einem Klumpen Metall Schmiedeeisen zu machen und aus dem Schmiedeeisen ein Schwert zu schmieden – aber der Umgang mit der fertigen Klinge war noch nicht wieder seine Welt. Er hatte seine als Sergeant des Vizegrafen erworbenen Fähigkeiten im Umgang mit dem Schwert lange nicht genutzt, sie waren ein wenig verschüttet. Aber auch im Vollbesitz seiner Kräfte, mit gesunden Händen und nur mit den seinerzeit erlernten Fechtkünsten wäre er für einen Ritter kein wirklich ernst zu nehmender Gegner gewesen. Kevin, Godfreys Sergeant, schüttelte den Kopf. Einerseits, weil es noch viel Arbeit bedeutete, trotz seiner leichtfüßigen Beweglichkeit aus Balian einen wirklich guten und gewandten Schwertkämpfer zu machen; andererseits, weil er sah, dass Godfrey nahe daran war, seinen Sohn im Moment zu überfordern. Er konnte doch nicht erwarten, dass ein Mann, der bisher nur als untergeordneter Reiter gekämpft hatte und das auch noch vor unbestimmt langer Zeit, innerhalb von weniger Momente ein perfekter Kämpfer wurde – noch dazu mit einer verbrannten Hand …
Odo, der Deutsche, der muskelbepackte, bullige Gefolgsmann Godfreys mit den dicken, blonden Zöpfen, stand auf. Unterricht im Schwertkampf sah für ihn anders aus. Der junge Mann musste doch erst einmal eine Vorstellung bekommen, wie der Hieb richtig aussah. Odo hatte seine eigenen Methoden in dieser Hinsicht.
„Hab’ ich Eure Erlaubnis?“, fragte er an Godfrey gewandt. Der Baron ließ sein Schwert sinken und nickte dem Deutschen zu, der seinen Platz einnahm und sein Schwert blankzog. Auch er nahm die Falkenwacht ein, die bei Odo für Balian noch bedrohlicher aussah, als wenn sein Vater sich so hinstellte.
„Gebt gut Acht“, sagte er – eher leise, Aufmerksamkeit erbittend. Dann zeigte er Balian ‚trocken’, wie er schlagen sollte und bemerkte den aufmerksamen, nachvollziehenden Blick des Sohnes seines Herrn. Nach kurzem Zusehen nahm Balian ebenfalls die Falkenwacht ein und bekam von Odo eine Lektion in Sachen Schwertkampf, dass es nur so schepperte – aber Balian nahm aus Odos Unterricht sehr viel mehr mit als aus den Instruktionen durch seinen Vater, der zu schnell die nächste Lehrstufe nehmen wollte. Balian hatte selbst einen Lehrling gehabt und wusste nur zu gut, wie viel Übung jeder einzelne Handgriff brauchte, bis er wirklich saß und mehr instinktiv als bewusst ausgeführt wurde – insofern unterschied sich die Ausbildung zum Schmied nicht von der zum Schwertkämpfer. Odo spürte, dass Balian eine schnelle Auffassungsgabe hatte, die einzelnen Bewegungen rasch verinnerlichte und so tatsächlich instinktiv handelte.
Die ganze Truppe sah dem erfahrenen Ausbilder und dem jungen Kämpferlehrling zu. Alle, Godfrey eingeschlossen, waren verblüfft über die Schnelligkeit, mit der der junge Mann begriff, wie er einem Hieb ausweichen musste und gleichzeitig selbst einen anbringen konnte. Godfreys interessierter Blick sah die Geschmeidigkeit der Bewegungen Balians. Eines nicht allzu fernen Tages würde er ein großartiger Kämpfer sein, dem so schnell keiner etwas entgegenzusetzen hatte. Bei der erwiesenen schnellen Auffassungsgabe konnte dieser Tag ganz schnell anbrechen …
Kapitel 10
Tod in den Wäldern
Knappe Philippe hatte seinen Platz gefunden, um sich in Ruhe dem Stuhlgang zu widmen. Direkt vor dem stillen Örtchen wuchsen Herbstzeitlosen. Versonnen pflückte Philippe eines davon und schnupperte daran. Die Bewegung hinter den Bäumen nahm er nur noch als Schemen wahr – und dann traf ihn wie aus dem Nichts ein Armbrustbolzen direkt unter dem linken Auge in den Kopf und tötete ihn auf der Stelle.
Hufschläge störten Godfrey und seine Mannen aus der Beobachtung des Unterrichts von Odo an Balian auf. Der Baron drehte sich um und sah vier Reiter durch den winterlich-grauen Wald herannahen.
„Wer ist das?“, fragte er. Balian ließ sein Schwert sinken und trat zu seinem Vater. Er hatte Nicolas, den Sohn und Söldnerführer* des Vizegrafen, erkannt. Es war zu erwarten gewesen, dass man ihn nicht ungeschoren davonkommen lassen würde. Seine Freiheit war kurz gewesen …
Die Reiter hielten einige Klafter vom Lager entfernt an. Nicolas sah in die Runde.
„Onkel“, grüßte er dann Godfrey.
„Neffe“, erwiderte der den Gruß knapp.
„Ihr habt einen Mann bei Euch – Balian. Er hat einen Priester getötet, seinen Bruder. Mein Vater sowie der Erzbischof haben mich beauftragt, ihn zurückzubringen“, nannte Nicolas seinen Auftrag. Godfrey sah Balian fragend an. Der junge Mann suchte keine Ausrede.
„Was er sagt, ist wahr“, bekannte er ohne Umschweife. „Sie haben das Recht, mich mitzunehmen“, setzte er hinzu. Godfreys Blick haftete noch auf Balian, dessen Wahrhaftigkeit er nur ritterlich nennen konnte, als sich Odo zu Wort meldete:
„Ich sage: Er ist unschuldig! Wenn Ihr sagt, er ist schuldig, werden wir kämpfen und Gott wird entscheiden, wer die Wahrheit sagt.“
Jean setzte seinen Nasalhelm* auf, klappte den Nasenschutz herunter.
„Mein deutscher Freund hier …“, sagte er und nickte in Odos Richtung, „ist ein eifriger Student der Rechte“, warnte er die Söldner. Nicolas grinste kühl.
„Übergebt ihn mir einfach. Wir kämpfen um etwas anderes“, schlug er vor, in der Hoffnung, eine Eskalation jedenfalls so lange vermeiden zu können, wie er selbst noch in unmittelbarer Nähe dieser Leute war und selbst in Gefahr geraten konnte.
„Onkel, er ist ein Mörder“, erwiderte er auf Jeans und Odos Einwände. Godfrey, der nahe an Nicolas’ Pferd stand, sah zu ihm hoch.
„Das bin ich auch“, versetzte er. „Wer immer hier heute sterben wird – Ihr werdet mit Sicherheit dabei sein“, drohte er. Ihm war nach Nicolas’ Gegenvorschlag klar geworden, dass die Suche nach Balian nur ein Vorwand war und es auf jeden Fall zum Kampf kommen würde, weil sein Bruder Hugo und sein Neffe Nicolas seine Besitztümer an sich bringen wollten. Nicolas richtete sein Pferd drei Schritte rückwärts, um Godfrey etwas auf Distanz zu bringen.
„Ihr seid mein Onkel. Ich muss Euch ziehen lassen“, sagte er dann und zog sich mit seinen Begleitern zurück.
Balian sah seinen Vater noch verblüfft an, als der bereits zum Lager zurückging und sein Schwert in der Scheide versenkte. Der geflohene Schmied hatte nicht erwartet, dass sein Vater und dessen Männer für ihn eintreten würden – zumal die Leute des Vizegrafen so offensichtlich im Recht waren. Es war einfach Tatsache, dass er Père Michel umgebracht hatte, und er leugnete es nicht. Er hatte schlicht sein Leben verwirkt. Das Beste, was er noch zu hoffen hatte, war dass es schnell ging mit der Hinrichtung … Warum hatten sie sich für ihn verwendet, für einen Mörder?
Godfreys Eile beruhte auf seiner Besorgnis, dass es viel zu einfach gewesen war, den Söldnerführer loszuwerden. Sein in vielen Jahren und Schlachten geschärfter Sinn für Gefahren warnte ihn vor einer Falle. Fast im selben Moment schrie Firuz auf Arabisch, dass er die Gefahr bereits konkret ausgemacht hatte.
„Deckt die Flanken!“, befahl Godfrey. Die Ibeliner waren – abgesehen von Balian – eine eingespielte Truppe, in der jeder wusste, was er im Moment der Gefahr zu tun hatte.
Auf dem gegenüber liegenden Ufer des Flüsschens, an dem sie lagerten, kamen vier oder fünf mit weittragenden Langbogen bewaffnete Söldner aus dem schützenden Gebüsch hoch und schossen auf die Männer Ibelins eine Salve Pfeile nach der anderen. Balian handelte instinktiv, brachte sich mit einem beherzten Sprung hinter einem Baum in Sicherheit. Dann erst bemerkte er, dass die Männer seines Vaters ebenso gehandelt hatten, nun aber zum Angriff übergingen, als ein Teil der Bogenschützen durch den flachen Fluss herüber stürmte und die Ibeliner mit Schwertern angriff. Die anderen ließen Pfeil um Pfeil von der Sehne schwirren, wieder andere hatten Armbrüste.
Ein Armbrustbolzen traf Odo mitten im Kehlkopf. Obwohl die Verwundung tödlich war, reichte die Kraft des bärenstarken Deutschen noch aus, um sich gegen zwei Söldner des Vizegrafen im Nahkampf zur Wehr zu setzen. Selbst ein zweiter Bolzen, der ihn knapp unter dem ersten in die Brust traf, brachte ihn nicht zu Fall. Er köpfte einen seiner Kontrahenten, schlitzte den zweiten regelrecht auf, bis ihn ein dritter Pfeil in die Brust traf.
Balian focht heftig mit den Leuten Nicolas’. Er setzte seine soeben erworbenen Kenntnisse im Schwertkampf sofort praktisch um, erweitert um eigene Erfahrungen, die er als Reiter des Vizegrafen erworben hatte, und die im Augenblick der konkreten Gefahr augenblicklich wieder nutzbar waren. Er trat einem der Angreifer heftig in die Weichteile, während er sich einen zweiten gekonnt mit dem Schwert vom Leib hielt. Die Söldner bekamen Balians ganze aufgestaute Wut ab – und sie war tödlich. In die Enge getrieben, schlug der junge Mann ohne jede Rücksicht und ohne Erbarmen zu. Als einer seiner Gegner sich zurückzog, setzte Balian ihm mit einem Riesensatz nach und erschlug ihn auf der Flucht. Dann wandte er sich dem verbliebenen Bogenschützen auf dem anderen Ufer zu.
Godfrey sah, dass Nicolas sich aus dem Staub machen wollte, sprang auf sein Pferd und setzte dem Fliehenden nach. Der verbliebene Bogenschütze ließ seinen Pfeil los, der Godfrey in die rechte Seite des Brustkorbs traf. Er stöhnte schmerzvoll auf, hielt sich aber im Sattel und verfolgte weiter Nicolas.
Jean schnappte sich das herrenlose Pferd eines gefallenen Söldners, hängte sich an dessen linke Seite und preschte durch den Fluss, auf dessen anderer Seite er noch einen versteckten Bogenschützen entdeckt hatte, der gerade Balian ins Visier nahm. Aus dem vollen Galopp heraus ließ Jean das Schwert niedersausen, traf den Schützen in der Körpermitte und zerteilte ihn samt seinem Bogen. Noch im Lauf jagte er wieder in den Fluss zurück, wo der Sohn seines Herrn stand und tippte ihm im Vorbeireiten auf den Kopf. Balian drehte sich um und nickte ihm mit einem Lächeln zu. Wäre Jean ein Feind gewesen, hätte er diese Attacke nicht überlebt. Die Warnung hatte er verstanden …
Firuz rang im Nahkampf mit drei Männern von Nicolas. Sie hatten keine Chance gegen den wie einen Berserker kämpfenden Schwarzen, der auch mit zwei Pfeilen im Leib nicht aufgab. Erst der Speerstich eines vierten Mannes setzte dem Kampf ein für Firuz tödliches Ende.
Godfrey hatte Nicolas eingeholt.
„Dankt meinem Bruder für seine Liebe!“, brüllte der Baron, hob das Schwert mit beiden Händen hoch über den Kopf und zog mit voller Kraft nach unten durch, spaltete dem Söldnerführer Kettenkapuze und Hinterhaupt. Dabei zog er das Schwert so tief durch, dass er den aus seiner rechten Seite ragenden Pfeil abbrach und sich nur noch mit Mühe im Sattel halten konnte.
Odo sackte blutüberströmt, von drei Pfeilen tödlich verwundet, zu Boden. Das letzte, was seine weit aufgerissenen, brechenden Augen noch sahen, war Jean, der sich über ihn beugte und ihm sanft die Augen schloss.
Der Kampflärm verebbte, Odo, Philippe und Firuz lagen tot am Boden, Godfrey war schwer verwundet, von den Söldnern des Vizegrafen hatte nur einer überlebt. Er kniete am Boden und sah Godfrey an, räusperte sich und sagte:
„Ich bin der Sohn von Roger de …“
„Setz deinen Helm ab, wenn du mit mir sprichst!“, unterbrach Godfrey den Gefangenen barsch. Der Mann stockte, nahm den Helm ab und machte einen neuen Versuch:
„Ich bin der Sohn von Roger de Cormier.“
Als Godfrey ihn nur abwartend ansah, fuhr er nach einer Pause fort:
„Mir … steht das Recht auf das Privileg des Lösegelds zu.“
Godfrey stützte sich auf einen Stock, weil er sich nur mit Mühe auf den Beinen halten konnte. Der Mann hatte Recht, aber er hatte keine Lust, sich noch damit zu beschäftigen. Es würde zum einen Zeit kosten – und die hatte Godfrey nicht; zum anderen begab sich die Truppe damit erneut in Gefahr, angegriffen zu werden.
„Das ist richtig“, sagte der Baron und drehte sich um. Kevin, der hinter Paul de Cormier stand, begriff die Geste seines Herrn, nahm mit dem Rabenschnabel* Maß und erschlug Paul de Cormier mit der scharfen Spitze der furchtbaren Waffe, die er ihm von hinten in den Schädel hämmerte.
Freude über den Sieg wollte weder bei Balian noch bei den anderen Männern Godfreys aufkommen. Der Sohn des Barons war geschockt von der Brutalität, mit der der Gefangene praktisch hingerichtet worden war. Für die anderen war der Preis zu hoch gewesen, den Balians Rettung vor den Häschern des Vizegrafen gefordert hatte. Er fühlte sich schuldig am Tod der beiden Männer, die ihn kaum gekannt hatten und die doch ihr Leben für ihn geopfert hatten. Sein schuldbewusster Blick, der die Gesichter der anderen streifte, sah dennoch keine Ablehnung. Er gehörte zu diesen Männern, sie hatten ihn in ihre Mitte aufgenommen – vielleicht zunächst als Sohn ihres Herrn, aber nach diesem Kampf auch als Kampfgenossen, denn keinem war entgangen, dass er sich tapfer und geschickt geschlagen hatte.
Nachdem sie die Walstatt aufgeräumt und die Toten bestattet hatten, war es wieder dunkel geworden. Das Lagerfeuer erhellte und wärmte den Lagerplatz der Männer unter dem Banner von Ibelin. Dicht am Feuer lag Godfrey, den Kopf auf seinem Sattel, die Linke um seinen Schwertgriff gekrallt, den rechten Arm aus Bruder Jeans Blickfeld von der Wunde weggehalten. Das Feuer beleuchtete den Pfeilstummel, der aus Godfreys Seite ragte. Ein schmerzvolles Stöhnen entrang sich der Kehle des Barons, als Jean erneut die Zange ansetzte, um die abgebrochene Pfeilspitze aus der Wunde zu ziehen. Viel Fläche hatte er nicht, um zuzugreifen, zu dicht war der Pfeil am Körper abgebrochen worden. Doch so sehr Jean sich bemühte, er bekam die Pfeilspitze nicht heraus.
„Ihr habt den Pfeil abgebrochen, Mylord“, sagte der Johanniter mit leisem Vorwurf und ließ die Zange in eine Schale am Feuer fallen, in der schon diverse andere ärztliche Gerätschaften in blutig-rotem Spülwasser lagen. Godfrey japste erschöpft vor Blutverlust und Schmerz.
„Wenn die Rippen gebrochen sind, könnte das Knochenmark in das Blut eindringen. In dem Fall werdet Ihr Fieber bekommen und sterben. Oder es bildet sich eine Zyste und Ihr werdet leben“, diagnostizierte der Arzt. „Ihr seid in Gottes Hand“, setzte er hinzu. Godfrey winkte unwirsch ab.
„Los, bringt mir Wein!“, befahl er. Jean erhob sich und ging vom Feuer weg, um Godfreys Wunsch zu erfüllen. Leise plätscherte Wein in einen Becher, als der Baron sich umsah und auf der anderen Seite des Feuers Balian neben Kevin entdeckte. Er hatte sich gegen die Kälte von hinten seine Satteldecke umgelegt und genoss die Wärme des Feuers von vorn. Godfrey winkte ihm matt, Balian legte die Decke ab und setzte sich auf den Platz neben seinem Vater, den nur kurz zuvor noch der Johanniter eingenommen hatte.
„Es ging nicht darum, dass sie nicht das Recht hatten, dich mitzunehmen; es ging darum, wie sie danach fragten“, erklärte Godfrey keuchend. Sein Sohn lächelte scheu. Das Feuer beschien sein männlich-schönes Gesicht teilweise an der linken Seite, zeichnete die Schatten eines Grübchens in der linken Wange deutlicher ab. Godfrey sonnte sich in diesem schwachen Abglanz eines Lächelns. Wie schön musste es erst sein, wenn sein Sohn richtig strahlend lächelte oder gar herzlich lachte? Er wünschte sich, das noch erleben zu dürfen und betete innerlich, dass Gott ihm dieses Wunder noch vergönnte. Gleichzeitig verfluchte er sich und seine Saumseligkeit. Er hätte es viel früher haben können, diesen wunderbaren Sohn bei sich zu haben, hätte er sich nur auf den Weg gemacht … Sein Sohn – welch ein Geschenk …
Balian musterte seinen Vater mit eben diesem sanften, scheuen Lächeln. Er und seine Männer hatten aus Prinzip gehandelt – aus Prinzip gegen ein unmögliches, unhöfliches Verhalten; nicht weil es gegen das Recht gewesen wäre, ihn zu verhaften … Balian konnte das nicht so einfach stehen lassen.
„Sie hatten das Recht, mich mitzunehmen“, stellte er klar. Er hatte ein Verbrechen begangen. Er wollte, dass sein Vater wusste, dass er bereit war, dafür einzustehen – auch mit seinem Leben. Godfrey erwiderte das Lächeln seines Sohnes mit einem grimmig-entschlossenen Grinsen.
„Das Recht habe ich auch“, versetzte er. Sein Blick wurde weicher, liebevoller. Um nichts in der Welt hätte er zugelassen, dass jemand seinem Sohn zu nahe trat … Balian schluckte trocken, Wärme umfing ihn, die mit dem Feuer hinter seinem Rücken nur wenig zu tun hatte. Dieser letzte Satz verdeutlichte ihm, dass das Prinzip, nach dem Godfrey und seine Männer gehandelt hatten, das Prinzip der Freundes- und Familientreue war. Balian gehörte dazu. Er hatte wieder eine Familie.
Kapitel 11
Der himmlische Pfad
Dass diese neue Familie aber ganz konkreten Gefahren ausgesetzt war und keineswegs von dauerhaftem Bestand sein musste, zeigte sich schon bald, denn Godfrey erholte sich nicht von der schweren Verwundung. Die Umstände waren für eine Genesung nicht günstig, da sie ihren Weg nach Italien fortsetzten. Godfrey wollte von einem längeren Aufenthalt nichts wissen, stieg jeden Morgen erneut stur in den Sattel. Dass er täglich schwächer wurde, trieb ihn nur zu längeren Reiseabschnitten, um das Heilige Land doch noch zu erreichen.
Etwa einen Monat, nachdem Balian zu Godfreys Truppe hinzugestoßen war, hatten sie das Küstengebirge an der französischen Mittelmeerküste erreicht. Im Sommer hätten sie in Marseille ein Schiff bestiegen und wären von dort aus über das Meer nach Akkon oder Jaffa gesegelt, wären etwa zehn Tage später in einem sicheren Hafen des Königreichs Jerusalem gewesen. Doch es war Winter und die Route westlich um Sizilien wegen der häufigen Stürme und auch sonst ungünstiger Winde ebenso gefährlich wie die Durchfahrt durch die Straße von Messina.
Sie nahmen den Weg an der Küste entlang um den Golf von Genua herum. In Genua trafen sich diverse Pilgerstraßen, die durch die Apenninen nach Neapel weiterführten, von wo sie nach Messina auf Sizilien übergesetzt werden sollten. Die Zugwege der Kreuzfahrer vereinigten sich hier, so dass Godfrey und seine Genossen nicht mehr allein waren. Waren die einzelnen Kreuzfahrergruppen bisher eher einsam ihrer Wege gezogen, wurde hier, jenseits von Genua, ein gemeinsamer, langer Heerzug daraus. Templer, Johanniter, nicht ordensgebundene Ritter wie Godfrey, Herzöge und Grafen mit ihren Gefolgsleuten und auch friedliche Pilger – sie alle bevölkerten die Bergstraße, die nach Neapel führte.
Godfrey hielt sich noch immer im Sattel, zwischenzeitlich aber nur noch mit einem sinnreichen Gestell, das Balian für seinen Vater aus Ästen gefertigt hatte. Balian und Jean waren immer in seiner unmittelbaren Nähe, stets bereit, dem verwundeten Baron zu helfen.
Es war um die Mittagszeit, als sie eine größere Hochfläche erreichten, auf der sich schon viele Kreuzfahrer und Pilger für eine Pause niedergelassen hatten. Balian sah sich besorgt nach seinem Vater um, der schwach im Sattel hing und sich mehr tragen ließ, als dass er dem Pferd bewusste Anweisungen gab. Dort, wo der Bergweg auf die Hochebene traf, stand ein junger Priester auf einer leichten Anhöhe und rief mit engelsgleicher Stimme immer wieder:
„Einen Ungläubigen zu töten, ist kein Mord, hat der Papst gesagt – es ist der Pfad zum Himmel!“
Er wiederholte es wie eine Litanei, erntete aber von Godfrey und Jean eher abweisende Blicke dafür. Dem glückstrahlenden Gesichtsausdruck des Priesters tat das keinen Abbruch, denn er rief es ihnen sogar noch lauter nach. Doch weder der Baron noch der Johanniter würdigten den fanatischen Priester eines weiteren Blickes. Auch Godfreys Männer taten so, als hätten sie ihn nicht gesehen; einzig Balian sah ihn noch einmal an, verblüfft, verstört über solche Worte. Sein Blick, der den seines Vaters suchte, fand darin die Bestätigung, dass sein Vater diesen Worten ganz und gar nicht zustimmte.
Auf einem freien Platz bauten Balian und die Gefolgsleute seines Vaters einen Windschutz auf, hinter dem Godfrey liegen konnte, halfen dem Baron vom Pferd und betteten ihn vorsichtig auf das vorbereitete Lager.
Jean nutzte die Gelegenheit, die friedlichen Pilger näher zu betrachten. Ein alter Mann holte von einer Kochstelle eine Schüssel mit Essen und verteilte Brot.
„Wo wollt Ihr hin?“, fragte Jean freundlich. Der Alte sah den Johanniterbruder offen an.
„Nach Jerusalem, Bruder“, erwiderte er.
„Welchen Weg wollt Ihr gehen?“, erkundigte sich Jean.
„Irgendjemand weiß es. Gott weiß es“, entgegnete der alte Pilger mit einem knappen Blick zum Himmel. Jean nahm dieses grenzenlose Gottvertrauen zur Kenntnis, entledigte sich des Helms und seiner Handschuhe und holte sich heißes Wasser, um Godfreys eiternde Wunde auszuwaschen.
„Wann wird dieser Wahnsinn ein Ende haben?“, murrte er. Die friedlichen Pilger, die nach Jerusalem zogen, um dort ihre Sünden vergeben zu wissen, folgten geradezu blindlings den bewaffneten Truppen, die sich ebenfalls als Pilger verstanden, obwohl Pilgerschaft und Waffengewalt sich per se ausschlossen und diese Bezeichnung für Bewaffnete eine Beleidigung für den Pilgergedanken war – auch wenn gerade der Papst das anders sah … Godfrey machte Platz für Jean, damit der seine Seitenwunde reinigen und neu verbinden konnte.
„Das wird mich schon bald nicht mehr interessieren“, erwiderte er. Jean und er sahen sich an. Godfrey hatte mit dem Leben abgeschlossen.
Nicht weit entfernt rastete ein Trupp Templer, kenntlich an ihren weißen Waffenröcken mit dem blutroten Tatzenkreuz auf der Brust und weißen Umhängen, die auf der linken Brustseite ebenfalls mit dem roten Kreuz der Templer geziert waren. Einer von ihnen bemerkte den Baron von Ibelin und seine Leute und machte einen anderen aufmerksam.
„Godfrey“, sagte er und wies in die Richtung. Der Angesprochene sah sich um und bemerkte die Truppe des Barons von Ibelin. Er stand auf und schlenderte hinüber.
Sein Blick fiel auf Balian, den er noch nie bei Godfrey gesehen hatte. Der neue Mann trug keinen Waffenrock, nicht einmal ein Knappengewand in Ibelins Farben. Der Tempelritter, den ein weißer Umhang mit Pelzbesatz vor den Unbilden des Winters schützte, sah Godfrey geradezu herablassend an.
„Wer ist das?“, fragte er in einem näselnden Ton, der die ganze Überheblichkeit dieses Mannes enthielt und wies mit dem beinahe ausgestreckten Zeigefinger auf Balian. Godfrey erwiderte mit kühlem Grinsen:
„Mein Sohn.“
Der Templer maß den jungen Mann, der so in Godfreys Nähe stand, dass er – falls nötig – jederzeit eingreifen konnte, mit aller Verachtung, lachte kurz auf. Balian sah ihn mit einem misstrauischen Blick an. Etwas an diesem Mann gefiel ihm ganz und gar nicht.
„Ich hätte gern gegen Euch gekämpft, als Ihr noch fähig wart, Bastarde zu zeugen“, ließ der Templer eine spitze Beleidigung fallen, gefolgt von einem höhnischen Lachen. Godfreys Grinsen verbreiterte sich, während Balians Augen dunkler wurden mit der höher steigenden Wut.
„Ich kannte Eure Mutter, als sie ihre empfangen hat. Glücklicherweise seid Ihr zu alt, um einer von meinen zu sein“, versetzte der Baron von Ibelin ungerührt, brach damit der Unverschämtheit des Templers die Spitze ab und gab seinem Sohn recht unverblümt zu verstehen, dass er zumindest in jungen Jahren schier hinter jedem Weiberrock her gewesen war, der sich in sein Blickfeld verirrt hatte … Dem herausgeputzten Lümmel in Rüstung wich das Blut aus dem Gesicht, doch er beherrschte sich. Ein kaltes, verächtliches Lächeln brachte er noch zustande.
„Das werden wir noch klären“, versetzte er in seinem überheblichen Ton und erneut einem höhnischen Lachen, dann trollte er sich. Balian sah ihm mit mühsam verhaltener Wut nach. Es war offensichtlich, dass diesen Mann, der es weder für nötig befand, sich vorzustellen noch wenigstens einen Gruß zu äußern, und seinen Vater eine tiefe Abneigung, ja Feindschaft verband.
Der Weg zog sich weiter. Godfreys Zustand besserte sich nicht; im Gegenteil: Er wurde immer schlimmer. Wie Jean befürchtet hatte, bekam er Fieber. Wenig später konnte Godfrey nicht mehr reiten und wurde in einer Sänfte befördert. Balian wich seinem Vater nicht mehr von der Seite, blieb dicht bei ihm. Beide, Vater und Sohn, hatten das dunkle Gefühl, dass ihnen nicht mehr viel gemeinsame Zeit verblieb – aber diese kurze Zeit wollten sie beisammen sein. So schweigsam Balian auch war, so deutlich erzählten seine Augen von seinem inneren Zustand. Godfrey sah die wachsende Sorge seines Sohnes um ihn, seinen Vater, in dessen Augen. Er machte sich erneut Vorwürfe, viel zu spät gekommen zu sein, um seinen Sohn nicht nur in Trauer und Sorge zu sehen. Er hätte ihn zu gern herzlich lachen sehen, aber die Situation war in keiner Weise dazu angetan, Balian auch nur ein Lächeln abzuringen.
Kapitel 12
Eine bessere Welt
Endlich, gut zwei Monate nach ihrem gemeinsamen Aufbruch, erreichten sie Messina. Die ganze Hafenstadt war ein einziges Heerlager. Es schien keinen Platz mehr zu geben, auf dem nicht ein Kreuzfahrer saß oder zumindest sein Gepäck abgelegt hatte. Babylonisches Sprachgewirr aus Italienisch, Französisch, Englisch in normannischem wie angelsächsischem Dialekt, Deutsch in allen denkbaren Variationen erfüllte die Gassen und Plätze, selbst Arabisch war zu hören.
Jean lotste die Ibeliner zum Johanniterhospital, wo Godfrey im oberen Stockwerk endlich in ein richtiges Bett kam und sich Heilkundige unter besseren Bedingungen als auf der Reise um ihn kümmern konnten.
►Als die Johanniter den Baron in den Krankensaal im ersten Stock tragen wollten, stoppte er die Männer mit einem Handzeichen. Sie setzten ihn kurz ab, und Godfrey wandte sich an Jean:
„Ich will, dass Balian als mein Knappe eingekleidet wird. Er soll nicht in der Küche abgefüttert werden. Sorgt dafür!“
Jean nickte.◄
Kaum entsprechend mit dem von dunklem Rot und hellem Beige gespaltenen Gambeson ausgestattet, besuchte Balian seinen Vater im Hospital. Godfrey lag in einem größeren Saal im Bett, neben sich einen kleinen Nachttisch, auf dem eine Lampe und einige Schalen standen. ►Jean saß am Bett und sprach leise mit ihm, dann segnete er ihn, erhob sich und ging Balian entgegen, der den Saal gerade betrat.
„Lass dich nicht über seine Chancen täuschen“, sagte er leise und legte dem jungen Mann tröstend eine Hand auf die Schulter. „Er ist in Gottes Hand“, setzte er mit gesenktem Kopf hinzu und verließ den Krankensaal.◄
Der Anblick, der sich dem Baron bot, als sein Sohn im Knappengewand in den Raum kam, wärmte ihn. Balian war in der Tat ein stattlicher junger Mann, seine Bewegungen waren weich und geschmeidig, der Gambeson saß wie angegossen und betonte seine ebenso schlanke wie kräftige Gestalt, zeigte den inneren Adel dieses jungen Mannes nun auch nach außen. Schweigend setzte er sich auf den Stuhl, der an Godfreys Lager stand.
„Weißt du, was dich im Heiligen Land erwartet?“, fragte Godfrey keuchend. ►„Nicht, was die Fanatiker oder die Kirche sagen, sondern, was dich wirklich erwartet?“◄
Balian schüttelte den Kopf.
„Eine neue Welt! Ein Mann, der in Frankreich kein Dach über dem Kopf hatte, ist im Heiligen Land der Herr über eine Stadt – und wer einst die Stadt beherrschte, bettelt nun in der Gosse. Dort …, am Ende der Welt, bist du nicht der, als der du geboren wurdest, sondern der, der wirklich in dir steckt“, erklärte Godfrey ächzend. Balian sah ihn an und schüttelte den Kopf. Trauer und Schuldbewusstsein spiegelten sich in seinen ebenmäßigen Zügen.
„Ich hoffe, Vergebung zu finden. Mehr weiß ich nicht“, erwiderte er leise. Godfrey streckte die Hand aus, Balian ergriff sie und ließ sich von seinem Vater heranziehen. Er verließ den Stuhl und setzte sich auf die Bettkante.
„Was immer du auch bist, du bist aus meinem Haus – und das bedeutet, dass du dem König von Jerusalem dienen wirst.“
„Was kann ein König von einem Mann wie mir verlangen?“, wunderte sich Balian.
„►Dieser König?◄ Eine bessere Welt, als man sie jemals gesehen hat. Ein Königreich des Gewissens, ein Königreich der Himmel! Frieden statt Krieg, Liebe statt Hass. Denkst du, das liegt am Ende des Kreuzzuges?“
Wieder nur Kopfschütteln bei Balian.
„Aber das tut es!“, beharrte Godfrey. „Frieden zwischen Christen und Muslimen. Wir leben zusammen. Oder … zwischen Saladin und dem König – wir versuchen es.“
Godfrey hatte nie ein Hehl daraus gemacht, dass die neue Welt im Osten für ihn die einzige Chance gewesen, ein Leben in eigener Verantwortung zu führen. Für Land und Wohlstand war er dorthin gegangen. Doch er hatte dabei die religiöse Bedeutung dieses Landes für sich entdeckt – und erkannt, dass es allen offen sein sollte, die dieses Land für heilig hielten. Frieden, den beide Seiten als Gewinn akzeptieren konnten, war dafür unbedingt notwendig. Er umkrampfte die Hand seines Sohnes hilfesuchend wie ein Ertrinkender.
►„Du wirst dem Frieden dienen und für den König kämpfen. Schwöre es!“, forderte er ächzend.
„Ich schwöre“, versprach Balian sanft.
„Gut. Gib mir eine davon“, sagte Godfrey und wies auf eine Schale mit Orangen, die auf einem kleinen Tisch vor den Arkaden stand. Balian erhob sich, ging zu dem Tisch, nahm eine der ihm fremden Früchte aus der Schale und gab sie seinem Vater. Die Orangen waren frisch gepflückt, wie die noch unverwelkten Blätter bewiesen, die sich an jedem Stängel befanden. Godfrey drehte Stängel samt Blättern ab und pellte gekonnt die Orange, die einen angenehmen, frischen und appetitlichen Duft verströmte. Als er die Schale weit genug entfernt hatte, brach er die Orange auf, nahm eine Spalte und schob sie Balian in den Mund, der die exotische Kostbarkeit auf diese Weise wie die heilige Kommunion entgegennahm. Er biss hinein und hatte ein unerwartetes, aber unglaublich köstliches Geschmackserlebnis.
„Das ist der Osten!“, sagte sein Vater und stellte damit klar, dass für ihn das Land und dessen Früchte für ihn maßgeblich waren, weniger die religiösen Aspekte.◄ „Mein Sohn, du bist alles, was von mir bleibt. Enttäusche mich nicht!“, ächzte er. So viel wollte er seinem Jungen noch sagen, doch das Leben verließ ihn einfach. Godfrey wusste: Er hatte nicht mehr viel Zeit, um seinem Sohn das mitzugeben, was er wissen musste – und was ihm als Erbe zustand. Balian nickte stumm. Er konnte nur hoffen, dass er das Richtige tun würde. Es stand schlecht um seinen Vater, das war ihm völlig klar. Dennoch wollte er die Hoffnung nicht aufgeben, dass sein Vater überleben würde und nach Jerusalem mitkommen würde. Godfreys Klammergriff löste sich, als der Baron erschöpft einschlief. Balian erhob sich leise, um ihn nicht wieder aufzuwecken und verließ das Krankenzimmer.
Kapitel 13
Merk dir mein Gesicht
Kevin passte Balian ab und überredete ihn, etwas essen zu gehen und sich Messina anzusehen. Kevin, der schon einige Jahre in Godfreys Diensten stand, war schon mehrfach in dem pulsierenden Einschiffungshafen gewesen und kannte die Stadt recht gut. Zum einen konnte er Balian damit ein wenig von seinen Sorgen um Godfrey ablenken, zum anderen hatten Jean und Godfreys übrige Männer dann die nötige Zeit, um das vorzubereiten, was Balian an diesem Abend noch erwartete; etwas, wovon der junge Mann noch keine Ahnung hatte. In den Wochen der gemeinsamen Reise waren alle Männer seines Vaters Balians Freunde geworden, aber mit dem etwa gleichaltrigen englischen Sergeanten verstand er sich am besten. Kevin führte ihn zum Fischmarkt und nutzte die Gelegenheit, um dem Sohn seines Herrn weiteres Wissen zu vermitteln.
„Als wir das Heilige Land eroberten, übernahmen wir auch die Handelshäfen. Die italienischen Schiffe befördern Seide und Gewürze – und Pilger …, wenn sie bezahlen können. Und Italien wird reich, so wie es der Erlöser wollte“, erklärte er. Balian kam angesichts der Reihenfolge der transportierten Güter und Passagiere der leise Verdacht, die Religion könnte nur ein Vorwand sein, das Geschäft aber der eigentliche Grund für die Eroberung Palästinas durch die Kreuzritter sein …
An der Hafenmauer hörte er ganz fremdartige Töne, sah hinüber und bemerkte unten am Wassersaum eine Handvoll Leute mit Turbanen, die sich gerade niederknieten und zu beten schienen.
„Was sind das für Leute?“, fragte er seinen Begleiter. Der Sergeant zeigte ein leichtes Lächeln.
„Moslems – Sarazenen“, erwiderte er. Balian sah ihn verblüfft an. Wind zauste ihm die Haare und wehte sie ihm in die Augen.
„Und sie dürfen hier ihre Gebete sprechen?“, wunderte er sich.
„Sofern sie ihre Steuern bezahlen“, entgegnete der Sergeant. „Sapan hapin al assim[1] – Gelobt sei Gott. Es gebührt sich, ihn zu preisen“, gab er einen Teil des Gebets wieder, das von den Männern unterhalb der Hafenmauer gesprochen wurde.
„Klingt wie unsere Gebete“, bemerkte Balian. Kevin lächelte nur sanft. Der junge Schmied hatte in einem Augenblick erfasst und ausgesprochen, was andere erst mühsam hatten begreifen müssen: Dass Christen und Moslems sich religiös sehr viel näher waren, als die Fanatiker unter ihnen je zugegeben hätten … Und in Balian reifte die Erkenntnis, dass es wirklich nur ums Geschäft ging, nicht um die Religion.
Sie wandten sich von der Seemauer ab und setzten ihren Weg fort, bis sie zu einer Fischküche kamen, in der unter freiem Himmel Speisen serviert wurden. Kevin ließ Balian sich setzen und kam nach kurzer Zeit mit drei großen Zinntellern zurück, auf zweien davon lag je eine große, gekochte Königskrabbe in leuchtendem Rot, auf dem dritten ein Fladenbrot, das er mit Balian teilen wollte. Für Balian, der im französischen Binnenland zu Hause gewesen war, waren diese sechsbeinigen Untiere eher Meeresungeheuer – er hatte eigentlich was zu essen erwartet. Kevin bemerkte Balians skeptischen Blick und dessen Zögern, nahm seine Riesenkrabbe und knackte sie mit einem geschickten Griff auf.
„Das ist gut“, sagte er aufmunternd, fingerte das schmackhafte rötlich-weiße Fleisch aus dem aufgebrochenen Panzer und ließ es sich schmecken. Balian sah sich das einen Moment an, probierte dann selbst – und fand Geschmack an der ihm bisher unbekannten Meeresfrucht.
Während die beiden jungen Männer ihr maritimes Mahl einnahmen und zu dem leckeren Krabbenfleisch sizilianischen Wein tranken, schlenderte ein Trupp Templer ebenfalls an diesem Speisestand vorbei. Der Godfrey so feindlich gesonnene Tempelritter bemerkte den Sohn seines Lieblingsfeindes, blieb neben ihm stehen und klopfte mit der Gerte wenig freundlich auf den Tisch, um Balians Aufmerksamkeit zu fordern. Doch der sah nur kurz hoch und widmete sich wieder seinem Wein.
„Wenn der König tot ist, wird Jerusalem keinen Platz mehr haben für … Freunde von Moslems und Verräter am Christentum und wie deinen … Vater“, setzte er mit dem für ihn typischen näselnden, überheblichen Ton an, ohne auch nur einen guten Tag zu wünschen. Balian ignorierte ihn vorsätzlich. Dass er durch die Anwesenheit des Templers irgendwie berührt war, zeigte sich nur darin, dass seine Kaubewegungen heftiger wurden und er den Becher auf einmal leerte. Es kostete ihn alle Beherrschung, nach außen ruhig zu bleiben, während sein Inneres schäumte.
„Ich bin Guy de Lusignan“, ließ sich der Templer doch noch zu einer Vorstellung herab. „Erinnere dich an diesen Namen – und an mich.“
Er schob Balian seinen kurzen Stock unter die Nase, verpasste ihm einen Nasenstüber damit, um ihn endlich dazu zu nötigen, ihn anzusehen, doch der junge Mann griff beherzt zu, entwand dem überraschten de Lusignan den Reitstock und knallte ihn auf den Tisch, immer noch stur geradeaus an Kevin vorbei auf die offene See sehend.
„Behalte ihn“, brummte Guy hilflos-gönnerhaft und entfernte sich, als seine Begleiter ungeduldig nach ihm riefen. Der Junge hatte beachtliche Kraft in den Händen … Balian ließ ihn sich etwa einen Klafter entfernen, dann drehte er sich um.
„Mylord!“, rief er so laut, dass es wirklich jeder im Umkreis von vier Klaftern hören konnte. „Wie wollt Ihr reiten, wenn Ihr keinen Stock habt, um das Pferd zu schlagen?“, setzte er hinzu. De Lusignan blieb wie angewurzelt stehen, drehte sich um, gleichzeitig rot und bleich werdend. Balian warf Guy die Gerte zu, die der Templer wortlos annahm und sich dann trollte.
Kevin sah Balian erschrocken an. Wusste er nicht, wen er sich gerade endgültig zum Feind gemacht hatte?
„Er wird eines Tages König von Jerusalem sein!“, warnte der Sergeant. Balian schwieg, brach sich noch ein Stück Brot ab, schob es in den Mund und zeigte seinem Freund nur ein entschlossen-grimmiges Lächeln, das Kevin sehr an Godfrey erinnerte. Er war seines Vaters Sohn – ohne jeden Zweifel.
[1] Phonetische Wiedergabe, da die korrekte Gebetsformel nicht zugänglich war.
Kapitel 14
Der Eid des Ritters
Später, es war bereits dunkel, waren die beiden jungen Männer längst wieder im Johanniterhospital. Balian hatte nicht nochmals zu seinem Vater gehen dürfen und so hatte er sich in den Innenhof an das Lagerfeuer gesetzt und betete, das kleine Silberkreuz in den eher zu einer Doppelfaust geballten als zum Gebet gefalteten Händen. Er betete für seinen Vater, für seine Frau, für seinen Sohn. Verzweiflung klang durch die geflüsterten Worte des Ave Maria. Er fühlte sich schrecklich hilflos angesichts des Zustandes seines Vaters, der sich keinen Deut verbessert hatte.
Kevin bekam von Jean den Hinweis, dass jetzt alles vorbereitet sei und er Balian holen solle. Der Sergeant musste eine Weile suchen, bis er den Sohn seines Herrn im Innenhof am Feuer sitzend fand.
„Balian!“, rief er und winkte ihm hektisch zu. Balian sah hoch und folgte dann eilig dem Sergeanten. Kevin führte ihn zunächst in einen abgeschlossenen Raum, wo er sich ein knielanges weißes Gewand anziehen sollte. Zwar wunderte sich Balian, wozu das erforderlich war, wenn er einfach nur seinen Vater sehen wollte, aber für lange Erklärungen blieb keine Zeit; Balian tat eilig, wie ihm geheißen, dann führte Kevin ihn weiter zur Kapelle des Hospitals.
„Schnell!“, trieb er ihn an.
Sie betraten die Kapelle, die durch zwei dünne Vorhänge hintereinander vom Flur abgetrennt war. Zwischen den Vorhängen standen Männer in voller Rüstung, über die sie weiße Röcke ohne Abzeichen gezogen hatten. Sie hielten die Schwerter blank in der einen Hand, in der anderen trugen sie brennende Fackeln. Kevin blieb vor dem zweiten Vorhang stehen. Hinter diesen Vorhang durften nur noch Männer im Ritterstand treten – oder jemand, der es werden sollte. Kevin war als Sergeant kein Ritter und war auch nicht zum Ritterschlag ausersehen.
„Ich kann nicht weitergehen“, sagte er und schob den zweiten Vorhang beiseite, damit Balian hindurchgehen konnte.
Balian trat in die Kapelle und sah seinen Vater mit dem Rücken zum Altar und dem darüber an der Wand befestigten Kreuz sitzen, neben ihm standen Jean und ein weiterer Johanniter, allerdings im weißen Ornat mit weißer Kappe – wohl der Prior des Hospitals, mutmaßte Balian. Godfreys Zustand war erschreckend schlechter als noch am Vormittag. Bevor Balian fragen konnte, weshalb er hier saß, statt in seinem Bett zu liegen, wo er zweifelsohne hingehörte, sagte Jean mit einem freundlichen Lächeln:
„Knie nieder.“
Balian kniete sich auf den harten Steinboden und sah seinen Vater eher besorgt als erwartungsvoll an.
Godfrey versuchte aufzustehen, doch gelang es ihm erst, als der Prior und Jean ihn stützten. Schweiß lief ihm in Bächen über das Gesicht, er sah so aus, als würde er jeden Augenblick zusammenbrechen. Mit mühsamen, stolpernden Schritten überwand er die kurze Distanz zu seinem vor ihm knienden Sohn.
„Sei ohne Furcht im Angesicht deiner Feinde! Sei tapfer und aufrecht, auf dass Gott dich lieben möge! Sprich immer die Wahrheit, auch wenn es deinen eigenen Tod bedeutet! Beschütze … die Wehrlosen – und tue kein Unrecht! Das ist dein Eid!“
Der Baron sprach die Formel keuchend und hastig, als ob er die Befürchtung hatte, mitten in der Zeremonie dahingerafft zu werden. Einen kurzen Moment stand er schwankend da, nahm den Siegelring vom kleinen Finger der linken Hand und gab ihn Balian, der ihn langsam entgegennahm. Dann holte Godfrey mit der linken Hand aus – und verpasste dem völlig überraschten Balian mit dem Handrücken eine saftige Backpfeife.
„Und das ist dafür, dass du ihn nicht vergisst!“, keuchte er und ließ sich schwer auf den Stuhl fallen.
Balian hielt sich – verschreckt und gedemütigt – die schmerzende Wange, schaute vorsichtig auf seine Hand, ob der Schlag etwa Nasenbluten verursacht hatte, aber es war nichts dergleichen zu sehen. Nur vorsichtig sah er wieder hoch. Sein Vater ließ sich eben sein Schwert geben, das er blank in beiden Händen hielt, den Griff in der Rechten, die Klinge in der Linken. Dann überreichte er Balian das Schwert mit einer mühsamen Verbeugung. Der junge Mann nahm das kostbare Stück ehrfürchtig entgegen, hatte seinerseits den Griff in der linken Hand und die Klinge in der rechten.
„Erhebt Euch als Ritter und Baron von Ibelin!“, wies Jean ihn an, erstmals die respektvolle Anrede der zweiten Person Plural benutzend.
Wie in Trance stand Balian auf, unschlüssig das Schwert in der rechten Hand behaltend. Während er noch abwartete, was nun geschehen würde, sackte sein Vater auf dem Stuhl zusammen, als ihn die letzten Kräfte verließen. Balian packte sofort zu, stützte ihn, erfüllte augenblicklich seine ritterliche Pflicht, die Hilflosen zu schützen. Godfrey sah ihn an, keuchte vor Anstrengung, erwiderte den festen, verlässlichen Griff seines Sohnes nur schwach und kraftlos. Sein Sohn! Welch ein Geschenk Gottes! Godfrey erfüllte unendlicher Stolz auf diesen Sohn, dem Ritterlichkeit einfach angeboren war, denn niemand hatte ihn zum Ritter erzogen, niemand ihn auf diese nun vor ihm liegende Aufgabe wirklich vorbereitet – die zwei Monate Reise hatten gereicht, Balians gute Anlagen und Vorbildung in kämpferischer Hinsicht zu vervollkommnen und ihn zu einem guten Schwertkämpfer weiterzubilden, aber viel mehr war nicht möglich gewesen. Godfrey wollte ihm noch einen letzten Auftrag mitgeben …
„Verteidige den König!“, beschwor er den jungen Mann. „Wenn der König tot ist, beschütze das Volk!“
Balian nickte schweigend. Seine dunklen Augen füllten sich mit Trauer; ihm wurde in diesem Moment endgültig klar, dass sein Vater ihm sterbend sein Erbe übergeben hatte – unter ritterlichen und geistlichen Zeugen, damit ihm dies niemand nehmen oder es bestreiten konnte. Godfrey fiel zurück in Bruder Jeans Arme, der ihm tröstend über die Schulter strich.
„Mylord, es ist Zeit, dass Ihr Gott beichtet – nicht Eurem Sohn“, mahnte der Johanniter sanftmütig. „Bereut Ihr all Eure Sünden?“
Godfrey lehnte sich an den Johanniterbruder, richtete seinen Blick fest auf Balian. Ja, es war alles richtig so. Er hatte Ibelin einen Erben gegeben; er hatte einen Sohn, auf den er nur stolz sein konnte, den er von Herzen lieb gewonnen hatte. Nochmals bedauerte Godfrey es zutiefst, sich nicht schon vor Jahren – wenn nicht noch besser sofort nach dessen Geburt – um diesen wunderbaren Sohn gekümmert zu haben. In der kurzen Zeit, die sie miteinander noch hatten verbringen dürfen, hatte Godfrey versucht, Balian alles mitzugeben, was er wusste und für richtig erkannt hatte. Ein weises, schon halb jenseitiges Lächeln kräuselte sich um die Lippen des Sterbenden, als er sagte:
„Alle – bis auf eine …“
Die Verbindung mit Balians Mutter war Sünde gewesen, ohne Zweifel, aber eine, für deren ansehnliches Ergebnis Godfrey sich nicht schämen musste. Es hatte so sein sollen. Sein Kopf fiel kraftlos zur Seite, als seine Seele auf den Pfad in den Himmel ging. Godfrey, Baron von Ibelin, war tot.
Jean salbte die Stirn des Toten mit Chrysam, sprach leise das Totengebet in lateinischer Sprache. Alle Anwesenden senkten in ehrlicher Trauer die Köpfe. Balian traf der Tod seines Vaters schwer. Zwar hatte er die Männer seines Vaters, die ihren Treueid auf ihn als Erben Godfreys übertrugen, kaum dass Godfrey die Augen für immer geschlossen hatte, doch ob er der großen Verantwortung für seine Männer und das Lehen gewachsen war, das wusste Balian nicht.
Kapitel 15
Gefährliche Reise
Viel Zeit blieb Balian nicht, um in Ruhe zu trauern. Sein Vater war kaum bestattet, als Jean ihn und Kevin am Kai in Messina verabschiedete.
„Ihr segelt jetzt nach Jerusalem, wie Euer Vater es wünschte. Ich werde in einer Woche folgen. Die Reise birgt viele Gefahren. Wenn Gott dort eine Aufgabe für Euch hat, wird er Euch sicher dorthin geleiten. Wenn nicht … Gott möge Euch segnen.“
Balian nickte leicht. Gegen den scharfen Seewind hatte er sich die Kapuze seines Umhangs übergezogen, während Kevin, der einen Schritt hinter seinem neuen Herrn stand, trotz seines kurzgeschorenen Haars der steifen Brise barhäuptig standhielt. In den Augen des jungen Barons lag erneut Trauer. Zum dritten Mal innerhalb weniger Monate hatte er einen ihm nahe stehenden Menschen verloren. Nachdem er die Trauer um Frau und Sohn noch nicht ganz überwunden hatte, hatte sie ihn nun, nach dem Tod seines Vaters, wieder mit der vollen Wucht gepackt. Dazu kam ein immer noch vorhandenes Schuldgefühl bei Balian, der sich die Schuld an der Verwundung und dem daraus folgenden Tod des Barons Godfrey von Ibelin gab.
Die Überfahrt von Messina nach Akkon, dem Haupthafen des Königreichs Jerusalem, war bei dem stetigen achterlichen* Wind, der den Segler trieb, in sechs bis sieben Tagen möglich. Doch es war Winter – und Winterstürme im Mittelmeer waren eine gefährliche Angelegenheit. Gefährlich vor allem deshalb, weil ein Nordweststurm in der Nähe der Küste Palästinas hohe Wellen auftürmen konnte. Dort, im östlichen Mittelmeer, stieg der Meeresboden des levantinischen Beckens von fast zehntausend Fuß oder knapp zweitausend Faden* Tiefe bei Kreta auf wenige hundert Fuß in den Gewässern vor Akkon an.
Südöstlich von Zypern packte der immer stärker aufblohende Sturm mit seiner ganzen Wucht das Schiff, mit dem Balian und seine Männer reisten. Die Kreuzfahrer hockten hilflos unter Deck, kämpften mit der chronischen Übelkeit, die seeungewohnte Menschen in derart kochender See regelmäßig packt. Sie klammerten sich an Spanten oder Tampen fest – was ihnen gerade als einigermaßen fester Halt unter die in der Dunkelheit des Schiffsrumpfes tastenden Finger geriet. Die Mannschaft des Schiffs kämpfte mit Wellen und Sturm; zwar hatten sie die Segel rechtzeitig reffen können, doch der Sturm war zu stark. Es gelang den Seeleuten nicht mehr, sie ganz zu bergen. Im Lichtschein eines Gewitterblitzes sah Balian, der in der Nähe einer Luke hockte und sich mit aller Kraft an einem Spant festhielt, dass der Großmast brach.
Manövrierunfähig, durch den gebrochenen Mast auch ohne Vortrieb, schaukelte der Segler hilflos in den hoch aufgetürmten Brechern, stellte sich quer zur nächsten Woge und kenterte in einer Sturzsee über Backbord, sank mit Mann und Maus. Das letzte, was Balian noch bewusst wahrnahm, war das rote Kreuz im abgerissenen Großsegel, als sich das Segel im Wasser noch einmal voll aufblähte und von einem Blitz über dem Wasser gespenstisch beleuchtet wurde; dann wurde es dunkel um ihn.
Langsam, ganz langsam kam Balian wieder zu sich, als heller Sonnenschein ihn blendete. Zögernd schlug er die Augen auf. Nein, der Himmel war es wohl nicht und nach Hölle sah es auch nicht wirklich aus – obwohl …
Sein erster Blick sah nur noch die Trümmer des im Untergang geborstenen Schiffes. In diesen Trümmern lagen nur leblose Körper von Menschen und Tieren. Er erinnerte sich dunkel, dass er aus dem Schiff heraus gespült worden war und schnell Boden unter den Füßen gespürt hatte.
Das Schiff musste in unmittelbarer Nähe der Küste gekentert und schließlich an den Strand geworfen worden sein. Wie es aussah, hatte er, Balian, in dem geborstenen Rumpf des Schiffes vor dem immer noch tobenden Unwetter Schutz gesucht, nachdem er an Land gespült worden war; aber es war nur ein Rückschluss, den er aus seiner Lage zog, keine bewusste Erinnerung.
Er fühlte sich elend und zerschlagen, war salzverkrustet und spürte brennenden Durst, was sowohl daran liegen mochte, dass er wohl eine ganze Weile ungeschützt in der Sonne gelegen hatte, als auch daran, dass er in den letzten beiden Tagen eigentlich nichts bei sich behalten hatte – Wasser eingeschlossen. Zudem war die Luft salzig, und er hatte während der Schiffskatastrophe reichlich Salzwasser geschluckt, was den Durst zusätzlich verstärkte.
Balian raffte sich mit Mühe auf, stellte verblüfft fest, dass er noch sein komplettes Bündel im Arm hatte, das aus einem kleinen Rucksack bestand, um den er den Gürtel der Schwertscheide gewickelt hatte. Am linken kleinen Finger spürte er den Druck des noch ungewohnten Siegelringes seines Vaters. Er hatte sein Bündel wohl so krampfhaft festgehalten, dass der Ring auch im aufgewühlten, relativ kalten Wasser nicht hatte vom Finger rutschen können. Aber dann sah er die ganze Katastrophe: Die Trümmer des Wracks hatten sich etwa auf der vierfachen Fläche des ursprünglichen Schiffsdecks verteilt. Zu seinem Entsetzen sah Balian nur noch Leichen. Von der Schiffsmannschaft und den Passagieren hatte augenscheinlich außer ihm selbst niemand überlebt – auch nicht von den Männern seines Vaters, die ihren Treueschwur auf ihn übertragen hatten. Wieder war er völlig allein und auf sich selbst gestellt. Balian begann sich zu fragen, warum alle Menschen, die ihm näher kamen, so schrecklich gestraft wurden. Ob Michels Annahme, Gott habe ihn verlassen, vielleicht doch zutraf? Balian war nahe daran, es nun zu glauben.
Nur mit aller Willenskraft brachte er es fertig, sich über Trümmer und Leichen zum Strand hinunter zu arbeiten. Wenn er leben wollte, musste er dringend etwas trinken – und er musste leben, um noch Vergebung für seine eigenen und Natalies Sünden zu erlangen … Ohne den Beistand eines Priesters, ohne gültige Beichte – mochte sie auch so knapp ausfallen wie bei seinem Vater – durfte er nicht sterben, sonst war Natalie der ewigen Höllenstrafe verfallen. Wie lang war die Ewigkeit? Er erinnerte sich eines Vergleichs, den er in der Burg von Saint-Martin-au-Bois einmal vom Hauslehrer des Vizegrafen gehört hatte, als er in der Burg zu tun gehabt hatte:
„Alle zehntausend Jahre fliegt ein sperlinggroßer Vogel auf die Spitze des Mont Blanc und wetzt das Schnäbelchen einmal hin und einmal her. Und wenn er den ganzen Berg mit seinem Schnabelwetzen abgeschabt hat, dann ist ein Augenblick der Ewigkeit vergangen!“
Die Ewigkeit war sehr lang, folgte daraus … Nein, das durfte nicht sein! Nicht für Natalie! Er musste leben!
Er hatte Glück und fand bei einem der Toten eine noch intakte Tonflasche, die noch Wein enthielt. Durstig leerte er sie bis zur Neige. Es reichte fürs Erste, aber ihm war klar, dass er rasch Wasser finden musste. Er hatte keine Ahnung, wo das Wrack angespült worden war. War er überhaupt schon an der Küste des Königreichs Jerusalem oder war er vielleicht auf einer Insel irgendwo im Mittelmeer gestrandet? Es gab nur eine Möglichkeit, sich Gewissheit zu verschaffen: Er musste den Küstenstreifen verlassen und sehen, ob es weiter im Landesinneren – wie groß es auch sein mochte – andere Menschen gab, die ihm weiterhelfen konnten.
Ein Wiehern machte ihn aufmerksam. Sein suchender Blick fand ein aufrecht auf allen vier Hufen stehendes Pferd, das allerdings im Netz des abgerissenen Klüverbaums* gefangen war. Der Umstand, dass das Pferd dort war, lebte und auch noch aufrecht auf den Beinen stand, war für Balian ein mindestens ebenso großes Wunder wie die Tatsache, dass er offenbar der einzige überlebende Mensch war. Zumindest gab es keine Hinweise darauf, dass es andere Überlebende gab – es sei denn, sie hätten sich vom Schiff entfernt, als das Unwetter noch getobt hatte und alle möglichen Spuren verwischt hatte. Er ließ sein Bündel fallen und sprang zu dem hinderlichen Netz, das das Pferd gefangen hielt. Er packte kräftig zu, das Netz riss aus der Verankerung und flog auch aus dem Sand. Der Rappe spürte, dass er frei war und stob panisch davon. Balian stolperte hinterher, fiel hin, aber das verschreckte Tier floh weiter. Er hatte keine Chance, es in dem weichen Sand einzuholen.
Enttäuscht, müde und verlassen sammelte Godfreys Sohn seine Sachen wieder auf, fand auch noch ein langes, helles Tuch, das er als zusätzlichen Schutz gegen die sengende Sonne, den Wind und den allgegenwärtigen Sand benutzen konnte und machte sich auf den Weg in das Landesinnere, in der Hoffnung, dort Hilfe zu finden.
Kapitel 16
Balian wird herausgefordert
Einsam und verlassen wanderte Balian in das Hinterland. Schon bald verwandelte sich der grüne Küstenstreifen in eine trostlose Wüste. Allein mit sich und der lebensfeindlichen Natur war Balian nahe daran, mit dem Leben abzuschließen. Nur der Umstand, dass er um Natalies Willen nicht ohne Vergebung sterben durfte, hielt ihn aufrecht. Gegen Mittag sah er im Glast der heißen Sonne ein paar Palmen und einige Gräser vor sich. Er ging darauf zu und hatte das Glück, nicht einer Fata Morgana erlegen zu sein – ein Phänomen, dass der junge Franke* nicht kannte und sich deshalb dieser möglichen Gefahr gar nicht bewusst war. Mit letzter Kraft beschleunigte er seine matter werdenden Schritte noch einmal, kniete am Wasserloch nieder, schob mit der Hand einige auf dem Wasser schwimmende Pflanzenreste beiseite und stillte seinen brennenden Durst. Eher unbewusst bemühte er sich, langsam zu trinken.
Während er noch das frische Nass genoss, weckte ein zufriedenes Schnaufen seine Aufmerksamkeit. Er lugte durch den dichten Vorhang seiner fast schwarzen Haare, die ihm beim Trinken ins Gesicht gefallen waren – und sah das ausgerissene Pferd, das ihm gegenüber aus demselben Wasserloch schlürfte. Balian spannte jeden Muskel an, nahm Maß, sprang wie ein Panther über das Wasserloch und bekam gerade noch den Zügel des erschrocken zurückweichenden Tieres zu fassen. Er hielt den Zügel eisern fest, zog den schwarzen Kopf zu sich herunter und beruhigte das immer noch panische Pferd mit sanftem Streicheln und leisem Zureden.
„Hoooh, ganz ruhig, ganz ruhig.“
Sanft, dunkel und ruhig war Balians Stimme, die zusammen mit dem beruhigenden Kraulen Wirkung zeigte. Der Rappe spürte, dass der Mensch, dessen Geruch er auch wiedererkannte, ihm nichts Böses wollte und wurde ruhiger. Balian hatte in seinem Leben Dutzenden von Pferden Hufeisen angepasst. Seine ausgesprochene Tierliebe war ihm dabei stets zugutegekommen. Er konnte von sich behaupten, dass keiner seiner vierbeinigen Kunden je nach ihm gekeilt oder ihn gebissen hatte. Seine leisen Worte und sein begütigendes Kraulen ließen das Pferd Zutrauen fassen. Es wehrte sich nicht mehr gegen den Menschen, der ihm vertraut wurde, sondern kam ihm entgegen, stupste ihn schließlich zutraulich an. Balian band den Zügel dennoch vorsichtshalber an einer Palme fest, damit sein vierbeiniger Gefährte es sich nicht doch noch anders überlegte und wieder das Weite suchte …
Nach einer Weile hatten Mensch und Tier sich sattgetrunken. Das Pferd hatte zudem einige Gräser und Palmblätter gekaut, Balian hatte die Datteln der Palme probiert und sie wohlschmeckend und sättigend gefunden, auch wenn sie ein seltsam stumpfes Gefühl im Mund hinterließen. Dann verstaute er seine wenigen Habseligkeiten in seinem Bündel und wollte gerade aufsteigen, als ihn ein scharfer Ruf aufschreckte, den er nicht verstand und ihn in die Richtung sehen ließ, aus der er gekommen war. Etwa hundert Klafter entfernt sah er zwei Reiter in der Wüste. Der eine, auf einem Schimmel reitend, war dunkel und augenscheinlich bescheiden gekleidet; der andere, der einen Braunen ritt, war mit einem turbanumwickelten Sarazenenhelm und hellerer Kleidung in Creme und Goldgelb deutlich mehr und farbenprächtiger herausgeputzt als sein Begleiter. Der Schimmelreiter kam auf Balian zugeritten.
„Er sagt, das ist sein Pferd!“, rief er schon von weitem in gut verständlichem Fränkisch, auch wenn ein starker Akzent unüberhörbar war. Balian sah ihn verwundert an.
„Warum sollte es sein Pferd sein?“, fragte er.
„Weil es auf seinem Land steht!“, antwortete der Schimmelreiter mit einer weit ausholenden Handbewegung.
„Ich habe dieses Pferd dem Meer entrissen!“, rief Balian zurück, in der Hoffnung, ein Missverständnis aufklären zu können. Der Schimmelreiter sprach mit dem Prächtigen – es klang ähnlich wie die Gebete, die Balian in Messina gehört hatte, war also wahrscheinlich Arabisch. Der junge Franke verstand kein Wort, aber was der Prächtige an zornigem Wortschwall offenbar als Antwort auf die Übersetzung über seinen Begleiter ausschüttete, klang nicht eben freundlich.
„Er sagt, du bist ein großer Lügner. Und er wird mit dir kämpfen, weil du lügst“, dolmetschte der Schimmelreiter.
„Ich habe kein Verlangen nach einem Kampf“, erwiderte Balian. Er wollte den Araber nicht zu einem Kampf provozieren, hoffte, die Situation noch entschärfen zu können.
„Dann musst du ihm das Pferd überlassen“, stellte der Schimmelreiter die Alternative dar.
Balian kam der Verdacht, dass die zwei ihr Mütchen an ihm kühlen wollten – entweder, weil sie ihn als Christen erkannt hatten und ihn damit grundsätzlich als Feind einstuften oder weil sie meinten, er sei nicht in der Lage, sich gegen sie zu wehren. Wenn das zweite zutraf, waren die arabischen Adligen offensichtlich nicht besser als ihre fränkischen Pendants. Es hatte Zeiten gegeben, in denen Balian als gewöhnlicher Hufschmied stets zurückgesteckt hatte, wenn ihn einer dieser hoffärtigen Widerlinge so bedrängt hatte – aber diese Zeiten waren vorbei. Wenn der Prächtige Streit suchte, sollte er wissen, dass Balian von Ibelin dem nicht aus dem Weg ging.
‚Sei ohne Furcht im Angesicht deiner Feinde!’, dachte er an die Worte seines Vaters. Er zog das Schwert und nahm die Falkenwacht ein.
„Nein!“, widersprach er bestimmt.
Der Prächtige zog seinen Speer, gab seinem Pferd die Sporen und griff Balian im vollen Galopp an. Balian wartete, ging im letzten Moment kurz beiseite und zerschlug den Speer des Angreifers mit einem gut gezielten Hieb. Die ergänzende Ausbildung, die ihm Kevin, Jean und die anderen Männer seines Vaters gegeben hatten, war gut gewesen und zeigte jetzt ihre Früchte … Der Prächtige wendete seinen Braunen auf der Hinterhand, riss das Schwert aus der Scheide und griff erneut an. Wieder scheiterte er an Balians hoher Deckung.
„Kämpft fair mit mir!“, rief Balian zornig.
„Wieso? Wieso sollte er?“, erwiderte der Schimmelreiter mit amüsiertem Schulterzucken. „Er ist ein Ritter!“
Balian packte sein Schwert fester. Von dem Berg wehte also der Wind! Faire Behandlung galt nur für Gleichgestellte … Die muslimischen Ritter waren tatsächlich keinen Deut besser als jene, die sich christlich nannten und in ihrer Hoffärtigkeit von der Kirche weiter entfernt waren als jeder, der einem Naturglauben anhing. Vermutlich hielten diese zwei das ebenso für in Ordnung wie die Balian so missfallende Sorte christlicher Krieger … Nun, wenn der Prächtige Krieg haben wollte, konnte er ihn haben, sagte sich Balian.
„Und ich bin der Baron von Ibelin!“, grollte er laut. Zum ersten Mal bediente er sich dieses Titels – und die Wirkung war verblüffend. Dem Schimmelreiter gefror das spöttische Lächeln und wich einem betroffenen Ausdruck, als er sich zu dem Prächtigen umdrehte und ihm übersetzte, was Balian gerade gesagt hatte. Verstehen konnte der junge Franke es nicht, aber zwei Wörter schnappte er auf: Ibelin und Hakim; das eine eindeutig sein Familienname, seit Godfrey ihn als seinen Sohn anerkannt und zu seinem Erben eingesetzt hatte; das andere mochte wohl sein Titel auf Arabisch sein, da der Schimmelreiter es in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Namen gebrauchte. Er sprach sie eher zögernd aus, als könne er nicht glauben, was Balian gerade gesagt hatte. Der Prächtige stutzte auch kurz, dann widersprach er zornig.
„Er sagt, der Baron von Ibelin ist alt. Er kennt ihn – aus Damaskus“, entgegnete der Schimmelreiter.
„Ich bin der Neue!“, versetzte Balian knurrend, verschwieg aber, dass der alte Baron sein Vater gewesen war. Es erschien ihm nicht angeraten, darauf hinzuweisen, dass Baron Godfrey tot war. Wenn überhaupt jemand vom Tod seines Vaters erfahren sollte, dann war es der König von Jerusalem – und vorher sollte es besser keiner wissen, fand der junge Mann.
Der arabische Ritter schien Balian Glauben zu schenken, denn er sprang vom Pferd, riss den behindernden Umhang ab und griff Balian mit dem Sarazenenschwert zu Fuß an. Die geschwungene Damaszenerklinge traf mit metallischem Klirren auf ein geschickt und hart geführtes, langes, gerades Frankenschwert. Balian wehrte die Angriffe des Arabers ab und ging – in Erbitterung geraten – zum Gegenangriff über. Nach heftigen Schlägen flog der Araber in den Sand. Der Schimmelreiter bemerkte, dass der Zorn der Kämpfer immer heftiger wurde – und er spürte eine Gefahr für seinen Landsmann, denn der junge Franke schlug hart und präzise zu, obwohl er nicht so aussah, als ob er im Vollbesitz seiner Kräfte war. Genau genommen hatte erst dieser Umstand dazu geführt, dass der Prächtige und der Schimmelreiter mit dem Franken Streit gesucht hatten. Dem Schimmelreiter wurde klar, dass sie an den Falschen geraten waren …
„Das reicht! Aufhören!“, rief er mahnend. „Ibelin, das reicht!“
Aber die beiden Streithähne hörten nicht auf ihn. Balian hätte wohl gern den Kampf beendet, aber sein Kontrahent wollte nicht nachgeben. Immer heftiger wurde ihr Schlagabtausch. Der Prächtige sah ein, dass er mit dem Schwert allein den Franken nicht besiegen würde und nahm grollend die abgebrochene obere Hälfte seines Speers auf und attackierte Balian damit zusätzlich. Aber der Griff zum Speer war ein tödlicher Fehler. Balian vergaß jede Rücksicht angesichts der tödlichen Drohung.
„Ibelin! Nein!“, schrie der Schimmelreiter verzweifelt, aber es war zu spät. Balian holte aus und schlug aus der Drehung heraus mit voller Wucht zu. Die Deckung seines Gegners wurde davon aufgerissen, die scharfe Klinge traf den Araber im ungeschützten Kehlbereich – und schlitzte den Mann regelrecht auf. Das Blut spritzte durch die heiße Wüstenluft und traf auch den Schimmel des zweiten Arabers, der erschrocken hochstieg, seinen Reiter abwarf und in Panik floh. Der Schimmelreiter fiel auf den Rücken, bekam im ersten Moment keine Luft mehr und lag hilflos wie eine umgedrehte Schildkröte vor den Füßen eines zur Weißglut getriebenen Franken, der mit stoßbereitem Schwert auf ihn zukam. Er schloss mit dem Leben ab.
Balian stieß tatsächlich mit dem Schwert zu – knapp neben dem Kopf des gestürzten Arabers. Der Schimmelreiter sah den Franken aus ruhigen, dunklen Augen an. Wenn er Angst hatte, verstand er hervorragend, das zu verbergen. Balian stützte sich auf das im Sand steckende Schwert. Der Kampf hatte ihm die letzten Kraftreserven abgefordert. Er konnte nur hoffen, dass der Schimmelreiter es nicht bemerkte und dies nicht zu seinem Vorteil nutzte. Einen weiteren Kampf dieser Art, dessen war Balian sicher, konnte er nicht bestehen.
„Du hast es gut aufgenommen, dass ich deinen Herrn getötet habe“, sagte er anerkennend. Der Araber sah ihn direkt an.
„Seine Zeit war gekommen. Alles ist so, wie Gott es will“, erwiderte der Araber fatalistisch. „Und nun beende es“, setzte er dann hinzu, den Blick fest auf den Christen gerichtet.
Balian wusste nicht, was ihn mehr beeindruckte: Die Ruhe des Mannes, der den Tod eines ihm nahe stehenden Menschen – vermutlich seines Herrn – so gottergeben hinnahm oder die Todesverachtung, mit der er Balian aufforderte, sein ihm wohl nutzlos erscheinendes Leben zu beenden. Der junge Franke rang mit sich, das war auch für den Araber erkennbar. Einerseits hatte ihn der augenscheinliche Herr dieses Mannes ohne jeden Grund angegriffen und dieser hier hatte nichts dagegen getan. Andererseits: Wenn dieser dessen Diener gewesen war, was hätte er dagegen tun können? Vermutlich wenig, wenn er dem Anderen hatte gehorchen müssen. Zudem hatte er selbst Balian nichts getan. Nein, das war kein Grund, diesen Mann zu töten. War das Leben des Arabers wirklich so unnütz, wie er Balian glauben machen wollte?
‚Nein’, entschied Balian, ‚kein Leben ist unnütz. Und es ist Unrecht, einen Wehrlosen zu töten. Beschütze die Wehrlosen und tue kein Unrecht!’, dachte er. Der Araber war waffenlos, denn er hatte sein Schwert wohl am Sattel gehabt – und der war samt Pferd verschwunden. Wenn er ihn tötete, war das Sünde. Balian sah das völlig anders als jener Priester in den Abruzzen. Er war in das Heilige Land gekommen, um Nachlass seiner Sünden zu erlangen – gewiss nicht, um neue zu begehen. Selbst, wenn er ihn einfach fortschickte, konnte Balian nicht sicher sein, dass der Mann sicher an einen ihm genehmen Ort ankam. Es war seine Pflicht, diesem Mann Schutz zu gewähren. Balian zog das Schwert aus dem Sand, der von dem Araber erwartete tödliche Stich blieb aus.
„Bring mich nach Jerusalem!“ forderte Balian ihn auf und wandte sich ab. Der Araber sah ihm verwundert nach. Nein, von dieser Sorte Franken gab es nicht viele.
Kapitel 17
Jerusalem
Seite an Seite ritten der Franke und der Araber gen Jerusalem; Balian auf dem hart erkämpften Rappen, der Araber auf dem Braunen des Prächtigen, denn sein Schimmel war nicht wieder aufgetaucht. Der Weg nahm einige Tage in Anspruch, da Balians Schiff durch den Sturm weit vom Kurs abgekommen war und weit entfernt vom nächsten Hafen gestrandet war.
Noch bevor sie gemeinsam aufgebrochen waren, hatten sie sich namentlich bekannt gemacht und so wusste Balian, dass sein Reisegefährte Imad hieß. Mehr hatte er nicht preisgegeben. Balian sah darin kein Manko, hatte er selbst doch auch bis vor kurzem nur einen einzigen Namen gehabt. Imad war ein freundlicher und sympathischer Mann, nur wenig älter als Balian selbst, gebildet und sprachgewandt. Dass die Bildung des Arabers auch für hiesige Verhältnisse ungewöhnlich hoch war, dass Imad für einen Diener viel zu gut gekleidet war, konnte Balian in Ermangelung genaueren Wissens über das Heilige Land nicht ahnen. Aber dass Gut und Böse keine Frage des religiösen Bekenntnisses war, das war dem christlichen Baron mehr als nur klar, kaum dass er mehr als drei Sätze mit Imad gesprochen hatte. Und er begriff, was sein Vater ihm auf dem Sterbebett hatte erklären wollen: Das Königreich der Himmel konnte nur entstehen und überleben, wenn alle, die Jerusalem als heilige Stadt ansahen, sich gegenseitig achteten und sich mit allen Unterschieden respektierten.
‚Verbessere die Welt – und fange bei dir selbst an’, sagte sich der junge Franke.
Imad wusste nun, dass Godfrey von Ibelin einen Sohn mit Namen Balian hatte. Dass er sehr wohl wusste, wer Godfrey war, verschwieg er geflissentlich. Doch auch, wenn er Balian über seine eigene Identität nur halb aufklärte und seine Stellung völlig im Dunkeln ließ, wollte Imad nichts weniger, als Balian jemals im Kampf gegenüber stehen. Zum einen war ihm der junge Christ ebenfalls sympathisch; ein Mann, dessen Freund er gern gewesen wäre, hätten die Zeiten es nur zugelassen. Zum anderen hatte er ihn kämpfen sehen – und das war eine eindringliche Warnung gewesen, diesem Mann möglichst nie im Zorn zu begegnen. Die Chance, dann zu überleben, war nicht besonders groß …
Sie vertrauten sich gegenseitig ihr Leben an, als sie durch die Wüste ritten. Nie schliefen sie beide gleichzeitig, wenn sie lagerten. Einer wachte dann treu über den anderen. Je länger sie unterwegs waren, desto mehr befreundeten sie sich. Dennoch mochte Imad das vertrauliche „Du“ nicht benutzen, betrachtete er sich doch als Balians Gefangenen. In dieser Hinsicht blieb Balians Freundschaftsangebot, das er mit dieser Anrede machte, zunächst unbeantwortet. Von Imad lernte er die ersten Brocken Arabisch, wobei Imad bemerkte, dass er einen interessierten und intelligenten Schüler hatte.
Schließlich erreichten sie Jerusalem über die westliche Pilgerstraße, die am Jaffator, auch Davidstor genannt, der heiligen Stadt dreier Religionen endete. Sie überholten wallfahrende Pilger, die zu Fuß unter Vexillen* mit dem Bild des heiligen Johannes des Täufers nach Jerusalem strebten. Sie kamen an Händlern und Bauern vorbei, die nach Jerusalem gingen, um dort in den Basaren Waren zu kaufen oder zu verkaufen, oder von dort kamen und ihre Geschäfte bereits getätigt hatten.
Schon außerhalb der Stadt war ein buntes Durcheinander von Menschen und Tieren, einfachen Menschen und Rittern in den unterschiedlichsten Waffenröcken. Aber in der Stadt nahm die Enge Balian fast den Atem. Noch nie in seinem Leben – nicht einmal in dem schon von Kreuzfahrern überfüllten Messina – hatte er ein solches Gedränge erlebt. Imad hatte offensichtlich keine Probleme damit, denn irgendwie fand er immer einen recht zügigen Weg durch die Massen. Balian hatte zuweilen Mühe, mit ihm Schritt zu halten, aber Imad nutzte diesen Umstand nicht aus, um zu fliehen.
Der Araber führte Balian zu einem der vielen öffentlichen Brunnen, wo sie ihre Pferde tränken und selbst ihren Durst stillen konnten. Sie stiegen ab und ließen zunächst die Pferde saufen. Imad war selbst ein großer Pferdefreund und ein guter Reiter, aber solch eine Einheit von Reiter und Pferd, so ein blindes Verständnis zwischen Mensch und Tier, hatte er selten gesehen.
‚Balian hat einen guten Geschmack, was Pferde betrifft’, dachte er. ‚Kein Wunder, dass er wie ein Löwe darum gekämpft hat.’
„Ein sehr gutes Pferd“, sagte er mit freundlicher Anerkennung. Balian klopfte seinem Rappen lobend den Hals, der vor Wonne flatterte. Er hatte schon eine Weile überlegt, womit er den treuen Imad für seine Führung belohnen konnte.
„Nimm das Pferd und … zieh deiner Wege“, sagte er wie unter einer plötzlichen Eingebung mit dem ihm eigenen, freundlichen Lächeln.
„Aber … das ist Euer Preis des Kampfes!“, wehrte Imad erschrocken ab. „Ich bin Euer Gefangener, Euer Sklave, wenn Ihr das wünscht.“
Imads stotternder Einwand klang geradezu protestierend. Balian legte ihm freundschaftlich eine Hand auf die Schulter.
„Ich war selbst ein Sklave – oder kam dem sehr nahe“, sagte er. Ein Schatten huschte über sein ebenmäßiges Gesicht und ließ das wunderschöne Lächeln erlöschen. „Ich werde keinen Sklaven besitzen oder jemandem solches Leid zufügen. Geh“, ergänzte er dann. Es klang wie ein Schwur, fand Imad.
‚Allah, welch Wunder hast du nach al-Quds* geführt? Aber was hast du nur mit diesem Mann gemacht, dass er so selten lacht? Er könnte eine Quelle der Freude für jeden sein, der ihn nur sieht’, durchzuckte es ihn. Wenn Balian von Ibelin erst herausgefunden hatte, wer er wirklich war und welchen Einfluss er kraft seiner familiären Zugehörigkeit haben würde, bestand die Hoffnung, dass sich in Palästina vieles zum Besseren aller seiner Bewohner ändern würde, so empfand es der Araber. Nach kurzem Zögern nahm er den Zügel des Rappen und schwang sich in den Sattel. Er wollte schon fortreiten, als er sich noch einmal zu Balian umdrehte.
„Der Mann, den Ihr getötet habt, war ein bedeutender Edelmann unter den Moslems. Sein Name war Mohammed al-Faes“, sagte er. Der christliche Ritter hatte ein Recht zu erfahren, wen er zu Allah in den für Glaubenskrieger reservierten siebenten Himmel befördert hatte. Balian verneigte sich leicht aus Respekt vor dem Toten, der tapfer gekämpft hatte. Er bedauerte nur Mohammeds Aggressivität, die überhaupt zu dem Kampf geführt hatte. Aber waren christliche Ritter besser? Nein, sie waren es nicht, wenn er an seinen Cousin Nicolas dachte oder den Umstand, dass Guy de Lusignan gern gegen seinen Vater gekämpft hätte – einfach so, aus purer Lust am Kampf, nicht aus bitterer Notwendigkeit, um sein Leben zu verteidigen.
„Ich werde für ihn beten“, versprach der fränkische Baron.
Imad war immer verblüffter, obwohl er meinte, Balian auf dem gemeinsamen Weg recht gut kennen gelernt zu haben; aber dieser Mann war voller Überraschungen, wenn er sogar für jemanden beten wollte, der ihn grundlos zu einem Zweikampf provoziert hatte. Imad war mit der christlichen Lehre soweit vertraut, dass ihm klar war, in Balian jemanden gefunden zu haben, der die Regeln seines Glaubens ernst nahm und Güte gegen jedermann zeigte. Viele gab es nicht, die das taten – schon gar nicht Adlige.
‚Godfrey, warum hast du diesen edlen Sohn so lange vor uns verborgen?’ fragte er sich in Gedanken. Der Sohn übertraf den Vater in puncto Edelmut noch weit. Imad verneigte sich im Sattel.
„Eure Güte wird unter Euren Feinden bekannt sein, bevor Ihr ihnen begegnen werdet, mein Freund“, sagte er, dann ritt er fort. Balian sah ihm noch kurz nach, und setzte dann seinen Weg fort. Der junge Mann ahnte nicht im Geringsten, wem er vor einigen Tagen das Leben und eben gerade die Freiheit geschenkt hatte – und welche Folgen seine Großmut für ihn selbst und andere haben würde …
Er bahnte sich seinen Weg durch die unglaubliche Menschenmenge in den Gassen Jerusalems. Ihm war inzwischen eine Idee gekommen, wo er seinen verlorenen Glauben wiederfinden konnte, nur wusste er nicht, wo dieser Ort genau war. Schließlich sah er einen alten Mann am Rand der überlaufenen Straße sitzen, der Gefäße und Korbwaren verkaufte. Balian hockte sich zu ihm, legte ihm sanft eine Hand auf die Schulter und fragte mit einem freundlichen Lächeln:
„Alter Mann, wo ist der Ort, an dem Christus gekreuzigt wurde?“
Der Alte zeigte dem freundlichen Franken den Hügel, der hoch über Jerusalem aufragte: Golgota, die Schädelstätte, wo einst vor mehr als tausend Jahren drei Kreuze gestanden hatten, an deren mittlerem Jesus von Nazareth sein irdisches Leben in Gottes Hände empfohlen hatte. Balian bedankte sich mit einem Kopfnicken und folgte dann – ohne es zu wissen – der Via Dolorosa, dem gleichen Weg, den auch Christus mit seinem Kreuz gegangen war.
Auf den Hügel führte ein Pfad in langen Serpentinen hinauf zur Hügelkuppe, die mit einer Kapelle gekrönt war. Die halbrunde Kuppel der Kapelle schmückte einfaches Kreuz, das weithin sichtbar machte, dass hier eines der christlichen Heiligtümer Jerusalems stand. Den Serpentinenpfad erreichte man über einen steilen Einstieg, der direkt in der Gasse begann und die Fähigkeit erforderte, zumindest Treppen steigen zu können. Gelähmte oder Menschen, die schlecht zu Fuß waren, hatten ohne fremde Hilfe keine Chance, den Serpentinenpfad zu begehen. Der Einstieg selbst war schmal und bot auf den ersten vier bis fünf Klaftern nur einer Person Platz.
Balian hatte gerade die ersten Stufen erklommen, als ihm ein zurückkehrender Pilger begegnete und er dem Mann höflich Platz machte, indem er sich eng an den Felsen zu seiner Linken drückte. Der Pilger stützte sich auf einen für christliche Pilger typischen Wanderstock, der einen kreuzförmigen Kopf hatte. Balian half ihm, die Engstelle zu passieren und erntete ein dankbares:
„As-Salam ’alaykum*.“
Der Gruß war eindeutig arabisch, aber augenscheinlich nicht an das religiöse Bekenntnis gebunden, schließlich war der Mann unübersehbar Christ und kein Moslem. Balian sah dem hinkenden Pilger noch kurz nach und überzeugte sich, dass der Mann heil am Ende des Einstiegs angekommen war, dann setzte er seinen Weg fort und stieg mit anderen Pilgern den in tausend Jahren von ungezählten Pilgerfüßen ausgetretenen Pfad zur Kapelle hinauf.
Während die meisten Pilger in die Kapelle gingen, dort einige Zeit blieben und dann Golgota wieder verließen, setzte Balian sich in der Nähe der Kapelle auf den blanken Boden. Wenn es einen Ort auf dieser Welt gab, an dem Gott zu ihm sprechen würde, dann war dieser Ort hier. Nach einer Weile, die er schweigend so gesessen hatte, betete er in Gedanken:
‚Gott, was verlangst du von mir?’
Er bekam keine Antwort und blieb wartend sitzen. Bald nahm er nicht mehr wahr, dass Menschen kamen und gingen, dass halblaut oder laut gebetet wurde, dass wieder andere andächtig schwiegen. Er bemerkte nicht, dass der Tag sich neigte und über ihm unzählige Sterne sichtbar wurden. Feuer wurden angezündet und erloschen wieder – Balian bekam es nicht mit. Um ihn und in ihm war nur tiefe Stille.
Die Nacht wurde zu einem neuen Morgen. Balian hatte keinen Augenblick geschlafen, nur gelauscht und nichts vernommen. Vielleicht hatte Michel ja doch Recht gehabt, dass Gott ihn verlassen hatte. Aber Balian war sicher, dass dies nur für ihn selbst galt, keinesfalls für Natalie. Er löste sich aus der andächtigen Starre, griff nach dem Kreuz seiner Frau, das er an einem einfachen Lederband um den Hals trug, nahm es langsam ab und streichelte es liebevoll, als wäre es Natalies Gesicht, das er zärtlich liebkoste. Dann schob er mit einer Hand einige Steine beiseite, grub mit bloßen Fingern ein kleines Grab, küsste das Kreuz ein letztes Mal und legte es behutsam in das kleine Grab. Nach kurzem Zögern schob er die kleine Grube wieder zu und legte die größeren Steine sorgsam als Grabsteine darauf. Sein Blick ging zum Himmel.
‚Wie kannst du in der Hölle sein, wenn du in meinem Herzen bist?’, durchfuhr ihn ein liebevoller Gedanke, der alle Zweifel in dieser Hinsicht für immer zum Schweigen brachte: Mochte Gott ihn auch verlassen haben, so war Natalie noch lange nicht in der Hölle! Nicht, solange er noch voller Liebe an sie dachte. Sie war in seinem Herzen und dort, in diesem sicheren Schutz seiner Liebe, würde sie bleiben … Hier hatte Michel sich ganz sicher geirrt, wenn er nicht sogar bewusst gelogen hatte.
Kapitel 18
Freiherr Balian
Noch immer blind vor Trauer um Frau, Kind, Vater und dessen Getreue, kehrte Balian in die ihm fremde Stadt zurück. Er wusste wohl, dass es hier ein Haus seines Vaters gab, aber den genauen Ort kannte er nicht. Er wusste von Jean auch, dass sein Vater noch Briefe nach Jerusalem geschrieben hatte, in denen er Balians Erbenstellung bekannt gemacht hatte; aber ob diese Briefe angekommen waren und wo er die Empfänger finden konnte, das wusste Balian nicht.
Zwar bemerkte er auf einem der ungezählten Basare in der Stadt einige Männer in Ibeliner Waffenröcken, aber einfach auf sie zuzugehen und sich als Erben Godfreys vorzustellen, schien Balian nicht gerade passend. Er besaß nur zwei Stücke, die auf seine Herkunft hinwiesen: Godfreys Schwert und dessen Siegelring. Aber ob das ausreichen würde, ihn gegenüber diesen Leuten als Erben Godfreys auszuweisen, schien ihm mehr als fraglich. Dass die Männer vielleicht auf der Suche nach ihm sein könnten, auf diese Idee kam Balian gar nicht.
Also suchte er nach einer anderen Möglichkeit, die Männer Ibelins davon zu überzeugen, dass er der rechtmäßige Erbe Baron Godfreys war. Raymond von Tiberias, der Statthalter von Jerusalem, war eine solche Möglichkeit. Allerdings hatte Balian auch keine Ahnung, wo er Tiberias finden konnte – und ob der ihn überhaupt empfangen würde, so wenig wie er nach einem Adligen, gar einem Ritter aussah …
Vielleicht war Bruder Jean, der eine Woche später von Messina hatte abreisen wollen, heil durchgekommen. Jean war nach dem Tod God-freys und aller seiner Männer, die den Baron nach Europa begleitet hatten und Balian kannten, der einzige Mensch, der noch bezeugen konnte, dass Balian Godfreys Erbe war. Sohn mochte er sich nach wie vor nicht nennen; zu wenig Zeit hatte er mit seinem leiblichen Vater verbringen dürfen, um sich dieser Verwandtschaft rühmen zu wollen. Er war ein Bastard, daran gab es nichts zu deuteln. Und als unehelicher Sohn blieb man besser bescheiden auf dem Boden. Balian beschloss, herauszufinden, wo ein Johanniterhospital war. Vielleicht konnte er dort Nachricht über Bruder Jean bekommen.
Und dann hatte er das Gefühl, dass ihm jemand folgte …
Almaric, ein gut über sechs Fuß großer Hüne im Wappenrock Ibelins, der die kümmerlichen Reste seines stark gelichteten Haupthaares ganz abgeschoren hatte und eine von wenigen dunkelblonden Stoppeln gezierte Vollglatze trug, war Godfreys Hauptmann und führte in dessen Abwesenheit den Befehl über jene Männer, die Godfrey gegenüber Balian erwähnt hatte. Bruder Jean hatte ihn und die in Jerusalem befindlichen Männer Godfreys in Kenntnis gesetzt, dass ihr Herr tot und sein Sohn Balian sein Erbe war. Ob der Sohn allerdings noch lebte, war sehr fraglich, nachdem sich die Kunde verbreitet hatte, sein Schiff sei gesunken. Erst, als sein Name im Zusammenhang mit dem Tod von Mohammed al-Faes in Jerusalem zu kursieren begann, hatte Jean neue Hoffnung geschöpft, hatte Almaric Balian beschrieben und ihn angewiesen, nach dem neuen Herrn von Ibelin zu suchen, der sich vielleicht schon irgendwo in Jerusalem befand.
Die Männer hatten erwartet, ihren neuen Herrn im Ibelin-Gambeson anzutreffen, aber so etwas fanden sie nicht. Auf dem Gewürzbasar, der buchstäblich den exotischen Duft des Orients verbreitete, nutzte Almaric die Gelegenheit, Gewürze einzukaufen. Als er Safran bezahlte, bemerkte er aus dem Augenwinkel ein ihm gar zu gut bekanntes Schwert. Suchend sah der Hauptmann sich um und fand das Schwert wieder – im Bündelgepäck auf dem Rücken eines jungen Mannes mit knapp schulterlangem dunklem Haar, schwarzer Hose und hellem Leinenhemd. Almaric kam es höchst befremdlich vor, dass jemand ein ritterliches Schwert dergestalt transportierte und fragte sich, ob dieser Mann jener war, den er und seine Begleiter suchten. Er sah sich um, fand seine Begleiter und nickte ihnen zu. Sie kamen rasch zusammen und folgten dem jungen Mann, den Almaric ihnen bezeichnete, in Richtung eines der öffentlichen Brunnen hinter dem nächsten Torbogen.
Balians Gefühl, dass ihm jemand folgte, wurde immer stärker, je näher er dem Brunnen hinter dem nächsten Torbogen kam. Er bemühte sich, sich nichts anmerken zu lassen und ging zielstrebig zu dem Brunnen. Dort nahm er das Bündel ab und zog das Schwert aus der Scheide, als ob er es abwaschen wollte. Dann drehte er sich um und sah sich sechs Männern in den Farben Ibelins gegenüber – Gefolgsleute seines Vaters. Der größte von ihnen, ein glatzköpfiger Hüne in Godfreys Größe, sprach ihn an:
„Du musst ihn gekannt haben.“
„Was?“, fragte Balian und schulterte die blanke Klinge. Es war präzise die Art, wie auch Godfrey von Ibelin das Schwert zu tragen pflegte, wenn er es zwar kampfbereit haben wollte, aber nicht sofort zuschlagen wollte, erkannte Almaric.
„Da du Godfreys Schwert trägst, musst du ihn gekannt haben“, präzisierte der Hauptmann. Balian sah an ihm vorbei und nickte gedankenverloren. Diese Männer waren Godfrey ergeben – und nun war er nicht mehr.
„Das habe ich“, antwortete er leise.
„Ein Mann meiner Größe“, sagte Almaric. Balian trat von der Brunnenstufe herunter, auf der er stand und war damit auf der gleichen Ebene wie der Hüne. Almaric überragte ihn um mehr als einen halben Kopf. Balian nickte.
„Ja“, bestätigte er. Er konnte nur hoffen, dass die Männer ihm glaubten. Obwohl er das Schwert blank in der Hand hatte, rechnete er sich – übernächtigt, hungrig und durstig wie er war – keine allzu großen Chancen aus, lebend davonzukommen, falls sie ihm nicht glaubten.
„Mit grünen Augen?“, fuhr Almaric prüfend fort. Wenn dieser Mann Godfrey wirklich so nahe gewesen war, dass der ihm freiwillig sein Schwert anvertraut hatte, würde er wissen, welche Augenfarbe der Baron von Ibelin tatsächlich hatte …
„Blau!“, sagte Balian bestimmt. Almaric sah seine Gefährten an. Godfrey hatte ihnen beim Abschied gesagt, dass er nach seinem Sohn suchen wolle, und die Beschreibung von Bruder Jean passte etwa. Dieser junge Mann, der rein äußerlich betrachtet eher wenig Ähnlichkeit mit Godfrey hatte – immerhin gut einen halben Kopf kleiner als der Baron, dunkelhaarig und braunäugig – war dennoch zweifelsohne dessen Sohn. Es waren die kleinen Gesten, wie die Art das blanke Schwert zu tragen, die Art, wie er abwartend dastand oder der melancholische Blick, die die Ähnlichkeit ausmachten. Zudem fiel Almaric noch ein kleines Detail auf: Der junge Mann trug Godfreys Siegelring. Sie hatten den Mann gefunden, von dem Bruder Jean ihnen erzählt hatte, auf dessen Überleben und Ankunft er nach wie vor hoffte. Almaric wandte sich Balian wieder zu, neigte das Haupt und sagte:
„Kommt mit uns – Mylord!“
Zunächst war Balian völlig verblüfft, dass die Männer sich mit diesen wenigen Fragen begnügten und sah sie etwas verstört an, dann folgte er ihnen.
►Almaric und seine Männer führten ihren neuen Herrn zu einem Anwesen mitten in Jerusalem, das auf einem der vielen Hügel der im Gebirge liegenden Stadt angelegt war. Eine hohe, ockergelbe Mauer umgab es, über dem massiven, eisenbeschlagenen Holztor war in weißen Stein gemeißelt das Tatzenkreuz von Ibelin eingelassen. Almaric klopfte mit der Faust an das Tor.
„Efta!“, rief er schließlich. Keine Reaktion. Almaric rief erneut:
„Efta!“, diesmal aber lauter, hämmerte mit der Faust heftig an das Portal. Das Tor wurde einen Spalt von einem Mann geöffnet, der mit einem weißen Gewand und einem ebensolchen Turban bekleidet war.
„As-Salam ’alaykum“, grüßte er und öffnete ganz.
„U ’alaykum as-Salam“, erwiderte Almaric. Er ging voran, Balian und der Rest der Männer folgten ihm.
Was der neue Baron hinter dem Tor zu sehen bekam, verschlug ihm die Sprache: Es war ein großer Innenhof, der mit allerlei für ihn exotischen Gewächsen geschmückt war. Nach links führte eine steinerne Treppe hinauf in das Obergeschoss, unten war ein Arkadengang, der um den ganzen Innenhof führte. Außer dem arabisch sprechenden Haushofmeister waren nur wenige Männer in gewöhnlicher Kleidung im Hof, sonst nur Frauen und Kinder. Balian schloss daraus, dass die Frauen vermutlich die Gattinnen seiner Männer waren. Wie zur Bestätigung drehte Almaric sich um, sah seinen neuen Herrn freundlich lächelnd an und legte einem Jungen den Arm um die Schulter. Der Kleine trug arabische Kleidung, war aber offensichtlich Almarics Sohn, lehnte sich stolz an seinen Vater an und schenkte Balian ein fröhliches Lächeln.
„Das Haus Eures Vaters, Euer Haus … Eure Leute, Mylord“, erklärte Almaric. Die wenigen Worte zeigten Balian, dass er hier nicht nur zuhause war, sondern auch in jeder Hinsicht von den Männern seines Vaters akzeptiert war. ◄
Balian erwachte, als zwei Dienerinnen kichernd in sein Schlafgemach hüpften, die Fensterläden öffneten und das strahlende Licht eines neuen Jerusalemer Morgens hereinließen. Die schrägen Sonnenstrahlen fielen auf ein Räucherbecken, in dem noch die letzten Reste des Weihrauchs verdampften und als weiße Rauchkringel aufstiegen, der am Abend zuvor als Willkommensgruß entzündet worden war.
Noch etwas verwirrt sah sich der junge Mann um – und fand sich bereits angekleidet mit einem sauberen, weißen Hemd aus weichem Leinenstoff, einer ebenso sauberen, schwarzen Hose und einer bis zu den Knien reichenden Tunika aus kräftiger Seide, die so tiefblau war, dass sie fast schwarz wirkte. Am Halsausschnitt und der vorderen Mittelnaht war sie mit goldgewirkter Borte besetzt, in den Ecken am Kragen schmückte zusätzlich silberne Stickerei arabischer Prägung die Tunika. Ein breiter Gürtel aus einem starken, etwa einem Klafter langen, doppellagigen, dunkelroten Seidengewebe schlang sich um seinen schlanken Leib und gab der Tunika Form und Halt. Als er das Räucherbecken sah, kam die Erinnerung an den vergangenen Abend wieder zurück:
Er hatte sich gerade halbwegs eingerichtet, als der Haushofmeister ihm mithilfe des dolmetschenden Almaric mitteilte, dass das Bad für den jungen Herrn gerichtet sei. Balian, der so etwas wie ein wirklich warmes Wannenbad nicht kannte, hatte sich von Almaric überzeugen lassen, dass es im Orient Sitte war, täglich zu baden – außer man war Tempelritter und legte Wert darauf, nur gegen den Wind angreifen zu können, weil man sonst unweigerlich schon in meilenweitem Abstand von den Sarazenen im Wortsinne gerochen wurde …
Er hatte sich seiner Kleidung entledigt und war in das vorbereitete Bad gestiegen, hatte es aber abgelehnt, sich waschen zu lassen. Als er fertig gewesen war, hatte ihm Haushofmeister Yussuf auf Arabisch angeboten, dass die Dienerinnen ihm aus der Wanne helfen würden, aber das war Balian nun wirklich zu viel gewesen.
„Nein, nein. Gib mir das Handtuch“, hatte er gebeten. Yussuf hatte auf ihn eingeredet wie ein Wasserfall, aber Balian war hart geblieben.
„Gib mir das Handtuch“, hatte er erneut gebeten. „Gib mir das Handtuch.“
Yussuf hatte schließlich aufgegeben und ein großes Handtuch über den Ausstieg aus der Badewanne gehalten, so dass Balian aus der Wanne steigen konnte, ohne den Dienerinnen seine Blöße zeigen zu müssen. Er hatte sich das große Handtuch um die Hüften gewickelt und war dann lächelnd hinunter gestiegen, hatte sich eher widerstrebend von den Dienerinnen abtrocknen lassen, die von seinem ansehnlichen Oberkörper ganz fasziniert schienen, wehrte die übereifrigen Damen aber ab, als sie ihm auch noch das Gesicht trocknen wollten. Er war es einfach nicht gewöhnt, sich bedienen zu lassen …
Er war schließlich in sein Schlafgemach geflüchtet, doch die Dienerinnen waren ihm gefolgt und hatten ihn auf Weisung des Haushofmeisters angekleidet.
An diesem vorigen Abend hatte Balian nach diesem ersten wirklich warmen Wannenbad seines Lebens, nach einem üppigen Mahl von Früchten, Brot, Fleisch, gutem Wein und frischem Wasser eigentlich nur ein Nickerchen machen wollen. Offenbar war er aber komplett angezogen in dem mit sauberem Leinen bezogenen, weichen Bett eingeschlafen und hatte – völlig erschöpft, wie er gewesen war – bis zum Morgen durchgeschlafen … Abrahams Schoß hätte nicht bequemer sein können, dessen war er sicher. Nach dem reinigenden Bad und der Bequemlichkeit des Lagers wäre der beruhigende Effekt des Weihrauchs im Schlafgemach wohl ebenso wenig nötig gewesen wie die Verbesserung der Luft, aber das Verbrennen des kostbaren Harzes war auch ein Zeichen, dass Balian als neuer Herr dieses Hauses anerkannt wurde.
Noch etwas verwirrt stand er auf und erkundete dann mit staunenden Augen sein Heim. Er hatte gehört, dass es solche Paläste gab, hatte diese Erzählungen aber stets ins Reich der Fabel verwiesen – so etwas konnte es nicht wirklich geben. Und doch stand er mitten drin in einem solchen Wunder an Pracht und Luxus. Er stand nicht nur darin, es gehörte ihm auch noch! Unfassbar! Balians lange, schlanke Finger griffen aus einer Obstschale eine Orange. Er schälte sie im Weitergehen und schob sich Spalte für Spalte der leckeren Frucht als kleines Frühstück in den Mund. Glockengeläut hallte durch die Stadt, aber es schien nicht von den Kirchen zu kommen; es klang eher nach Sturmläuten.
Er ließ sich viel Zeit, sein Heim zu erkunden, das hoch auf einem Berg stand. Der Blick aus dem oberen Stockwerk, wo die Räume des Hausherrn lagen, ging hinüber zu den anderen, dicht bebauten Hügeln. Von der östlichen Arkade ging der Blick des neuen Hausherrn auf den Hügel von Golgota, auf dem er die Nacht zuvor unter freiem Himmel verbracht hatte. In den Gassen darunter herrschte geschäftiges Treiben. Etwas nördlich davon zeigte sich die Kuppel des Felsendoms im Morgenlicht. Balian genoss den warmen Sonnenschein, der durch die Bögen der oberen Arkaden in die Räume fiel. Im Wind wehten leichte Tücher, die oben in den einzelnen Bögen befestigt waren und auch Schatten spendeten, wenn es draußen wirklich heiß wurde. Jetzt, am Morgen, war die Hitze noch nicht voll entwickelt, und die meisten dieser Sonnensegel waren noch zurückgezogen. In nahezu allen Räumen waren die polierten Steinböden mit feingeknüpften Teppichen belegt, die sowohl den Trittschall dämpften als auch nötigenfalls Wärme gaben oder die gar zu große Hitze sonnenbeschienener Steinplatten dämpften.
Der Weg führte den neuen Baron von Ibelin durch seine persönlichen Gemächer. Im Wohnraum fand er einen Stummen Diener, auf dem ein kostbar gearbeitetes Kettenhemd hing. Balians schlanke Finger strichen über die Ketten. Er stellte fest, dass es handwerklich hervorragend war und einen guten Schutz bieten würde. Dann fiel sein Blick auf die Truhe daneben. Neben seinem Schwert lagen goldene Sporen, Zeichen des Ritterstandes.
‚Ein Mann, der in Frankreich kein Dach über dem Kopf hatte, ist im Heiligen Land der Herr über eine Stadt’, hallten die Worte seines Vaters in Balians Erinnerung nach. Er war hier nicht der Herr über die Stadt, aber was er hier vorfand, was nun sein Eigentum sein sollte, ließ ihn immer noch glauben, zu träumen. Daran änderte auch die Orange nichts, die in ihm die Erinnerung an seinen Vater und dessen Vorstellung vom Heiligen Land weckte.
Kapitel 19
Ein guter Mann
Während Balian sein Haus besichtigte, kam Bruder Jean im Hof an. Almaric, der sich gerade in den Arkaden zum zweiten Frühstück aus etwas Brot, Früchten und Wasser setzte, bot dem Johanniterritter mit einem freundlichen Nicken Platz an. Jean entledigte sich der Reithandschuhe, nahm den Helm ab, übergab sein Streitross einem der Stallknechte und setzte sich zu Almaric.
Balian kam nach einem längeren, schweigenden Rundgang durch sein Domizil zu einer Treppe, die aus dem oberen Stockwerk in den Hof hinunterführte. Kostbare Zierteppiche lagen über dem massiv steinernen Treppengeländer und bezeugten den Reichtum dieses Hauses ebenso wie die Teppiche in den Räumen oben. Langsam, immer noch wie in Trance, ging der junge Baron die Treppe hinunter. Bedienstete, die unten an der Treppe beschäftigt waren, grüßten ihn respektvoll auf Arabisch. Balian dankte ihnen mit einem schweigenden, aber freundlichen Kopfnicken.
Schließlich holte ihn ein sehr vertrautes Geräusch auf den Boden der Realität von Jerusalem zurück – und bewies gleichzeitig, dass er das alles keineswegs nur träumte: das nervöse Wiehern eines kurz vor der Panik stehenden Pferdes. In den eben noch traumverloren dahin schlendernden Mann kam Leben. Eilig sprang er die letzten Stufen in den Hof hinunter, wo der junge Sergeant Michel und ein weiterer Diener mit einem temperamentvollen Braunen rangen, der neu beschlagen werden sollte und den beiden Männern überhaupt nicht traute. Michel zog scharf an den Zügeln, um das Tier endlich zur Ruhe zu bringen, aber es nützte nichts. Er rief etwas was wie:
„Ardoc! Ardoc!“, klang, aber der Hengst wich ihm in Panik aus. Balian sah mit dem geübten Blick des gelernten Hufschmieds, dass das Tier leicht lahmte.
„Aufhören!“, befahl er. „Ihr tut ihm weh!“
Mit noch zwei langen Schritten war der Baron bei dem Pferd. Michel und der andere Diener gehorchten augenblicklich und ließen die Zügel locker, als ihr neuer Herr den Braunen erreichte, ihm beruhigend eine Hand an den Hals legte, ihn sanft streichelte und leise auf ihn einredete. Seine ruhigen Bewegungen, die sanfte Hand und die leise, dunkle Stimme ließen das Tier sofort ruhig werden. Balians oft erprobter Pferdeverstand zeigte erneut Wirkung. Das Pferd stand lammfromm und ließ es zu, dass er mit einer Hand das rechte Vorderbein abtastete und sich langsam zum augenscheinlich lahmen Fesselgelenk vorarbeitete.
Er hatte den Huf beinahe erreicht, als vier oder fünf schlanke, große Jagdhunde durch das offene Hoftor hereinstürmten. Den Hunden folgte eine wilde Horde Reiter, die von einer überaus kostbar gekleideten jungen Frau angeführt wurde. Bruder Jean bemerkte sie, schob sich genussvoll eine Weintraube in den Mund und ging aus den Arkaden hinaus. Die junge Frau ritt einen feurigen Schimmel arabischer Zucht, der keine zwei Klafter von Balian schier zum Standbild erstarrte, als die Reiterin ihn zügelte. Balian kam vom Huf des eigenen Pferdes hoch und grüßte die Reiter mit einem leichten Kopfnicken. Die Anführerin nahm den Schleier ab, der sie vor zu viel Sonne, allzu neugierigen Blicken und bis zu einem gewissen Grad auch vor Staub schützte. Sie hatte ein unverkennbar abendländisches Äußeres, grüne Augen blitzten Balian an, ein Lächeln kräuselte sich um volle, rosige Lippen.
„Wo ist dein Herr?“, fragte sie mit hochmütigem Ton. Balian musterte sie einen Moment. Er hatte keine Ahnung, wer ihm dergestalt in den Hof polterte und nicht einmal die Höflichkeit besaß, einen guten Tag zu wünschen und sich vorzustellen.
„Ich habe keinen“, entgegnete er ruhig, aber kühl. Die Frau lächelte breiter.
„Gib mir etwas Wasser!“, forderte sie ihn auf. Im Orient gehörte es zum guten Ton des Gastgebers, einem Besucher Wasser anzubieten. Balian hatte es auf seiner gemeinsamen Reise mit Imad erfahren. Insofern war diese Forderung, so unhöflich sie auch vorgetragen war, nicht mehr als eine Selbstverständlichkeit. Er überging den Mangel eines höflichen „Bitte“, nahm einen Schöpflöffel, der an einem Krug frischen Wassers hing, füllte ihn mit Wasser und reichte ihn der jungen Frau, die durstig trank, wobei ihr Blick wie gebannt an seinen ebenmäßigen, wenn auch durch Sonnenbrand und Schürfungen noch leicht beeinträchtigten Zügen hing. Er kraulte beruhigend den Schimmel, den sie ritt, damit seine Reiterin von dem Wasser auch etwas bekam und nicht alles verschüttete. Er fragte sich, ob sie mit diesem edlen Pferd ebenso unhöflich umging wie mit Menschen. Sie schien zu jener Sorte Adliger zu gehören, die er nicht mochte und von der er sich zu unterscheiden gedachte. Der Teufel sollte ihn holen, wenn er sich je so benahm, dachte er bei sich. Sein Blick kreuzte den ihren, und er fand darin – sehr tief verborgen – Einsamkeit, auch Verletzlichkeit und eine Bitte, die er nicht recht verstand.
„Danke für den Trunk“, sagte sei mit schon sanfterer Stimme. „Solltest du zufällig Balian, den Sohn Godfreys, sehen, richte ihm aus, dass Sibylla hier war“, setzte sie hinzu. Der Dank für das Wasser war ebenso selbstverständlich wie der Anspruch des Reisenden auf den Trunk – und dass sie zumindest dafür dankte, ließ Balians Groll wieder verfliegen. Er schenkte ihr ein leichtes Lächeln und verneigte sich leicht mit einem freundlichen Leuchten in seinen Augen, die im strahlenden Licht des Jerusalemer Vormittags wie transparente, dunkle Bernsteine wirkten. Er ließ den Araber los, trat einen Schritt zurück. Sibylla wendete ihr Pferd.
„Haya bena!“, kommandierte sie, gab dem Schimmel die Sporen und preschte mit ihren Begleitern aus dem Hof, so schnell wie sie gekommen war.
Als der Staub sich wieder legte, sah Balian Bruder Jean mitten im Hof stehen und sich lächelnd vor ihm verneigen. Balian erwiderte sein Lächeln und seine Verbeugung.
Wenig später passte der Zeugmeister des Hauses seinem jungen Herrn in dessen Wohngemach im Obergeschoss seinen Kettenanzug und seinen Wappenrock an. Jean hatte sich unter den großen Leuchter gesetzt, der von der Decke hing. Jetzt, am hellen Vormittag, fiel jedoch genügend natürliches Licht in den Wohnraum, so dass keine Beleuchtung durch Kerzen erforderlich war. Jean bediente sich aus einer der schier allgegenwärtigen Obstschalen. Es schien keinen Raum zu geben, in dem nicht wenigstens eine stets frisch gefüllte Schale mit Obst stand. Jeder durfte sich daraus bedienen, der gerade vorbeikam, so war es Sitte im Hause Ibelin.
„Nun, wie gefällt Euch Jerusalem?“, erkundigte sich der Johanniterbruder interessiert. Balian wusste nicht recht, was er erwidern sollte. Sein wichtigstes Anliegen war es gewesen, auf Gottes Stimme zu hören. In Jerusalem, so hatte er angenommen, musste er mit Gott in Verbindung treten können. Es hatte sich als unzutreffend erwiesen. Er fühlte sich in dieser Hinsicht immer noch verlassen.
„Gott spricht nicht zu mir. Nicht einmal auf dem Hügel, auf dem Christus starb. Ich glaube, Gott hat mich verlassen“, sagte er schließlich mit einem Seufzen. Die ganze Reise schien vergeblich gewesen zu sein. Jean lächelte kauend.
„Das habe ich nicht gehört“, versetzte er mit leisem Vorwurf. Wie konnte Balian nur so etwas annehmen?
„Wie dem auch sei“, seufzte Balian und stand auf. „Es scheint, als hätte ich meine Religion verloren“, erwiderte er dann, nach einer milderen Variante des harten Vorwurfs von eben suchend. Jean sah ihn einen Moment an.
„Ich bin kein Freund von … Religionen“, sagte er langsam. „Ich habe erlebt, wie der Wahn von Fanatikern jeder Konfession als Wille Gottes bezeichnet wurde. Ich habe zu viele Religionen in den Augen von zu vielen Mördern gesehen“, fuhr er fort und stand auf. „Heiligkeit liegt in der gerechten Handlung und dem Mut, dies auch im Namen jener zu tun, die sich nicht selbst verteidigen können – und Güte. Was Gott will, ist hier“, er wies mit zwei Fingern der rechten Hand, ausgestreckt wie zum Segen, auf Balians Kopf, „und hier“, die Finger wanderten zum Herzen. „Das, was Ihr entscheidet zu tun – jeden Tag – macht Euch zu einem guten Menschen. Oder auch nicht“, setzte er mit einem schelmischen Grinsen hinzu. „Kommt“, forderte er Balian dann auf.
Kapitel 20
Der Marschall von Jerusalem
Jean führte Balian durch die pulsierende Stadt zu Pferd zum Davidsturm, dem Amtssitz des Statthalters von Jerusalem. In der Nähe des Turms tobte eine zornige Menschenmenge, alte Männer schüttelten zornig die Fäuste, junge Männer und Frauen riefen wütende Anklagen, soweit Balian es verstehen konnte. Hier klangen auch die Glocken, die er von seinem Haus aus gehört hatte – und es waren keine Warnglocken, sondern Armesünder-Glocken, denn sie verkündeten eine Hinrichtung.
Am Amtssitz des Statthalters angekommen saßen die beiden Ritter ab und überließen die Pferde Stallknechten im kornblumenblauen Jerusalemer Rock mit dem Jerusalemer Wappen auf der Brust.
„Der König war in den vergangenen sechs Jahren um Frieden mit Salahadin bemüht. Er sorgt dafür, dass Jerusalem ein Ort bleibt, an dem alle, gleich welchen Glaubens, willkommen sind – so wie die Moslems es taten, bevor wir kamen“, sagte Jean und stieß Balian sanft an, um dessen Blick nach oben in die gegenüberliegenden Arkaden zu lenken. Balian blieb stehen, nahm den Helm ab, klemmte ihn sich unter den Arm und folgte mit dem Blick dem Hinweis des Johanniters in den zweiten Stock der gegenüberliegenden Arkaden. Dort standen mehrere Männer mit weißen Wappenröcken mit dem roten Kreuz der Templer in der Mitte der Brust. Die Röcke, unter denen offenbar auch kein Kettenhemd war, hingen ohne Schwertgürtel lose über den Körpern. Die Hände der Männer waren auf den Rücken gefesselt, sie trugen Stricke um den Hals. Auf ein scharfes Kommando wurde der Erste aus dem Arkadenfenster gestoßen und so erhängt. Nacheinander folgten die anderen Delinquenten, die in den Nachbararkaden standen.
Jean sah Balians Blick, der sich ihm fragend zuwandte.
„Diese Männer sind Templer. Sie haben Araber getötet“, erklärte er. Balian sah noch einmal nach oben, dann wandte er sich ab und folgte Jean.
„Also sterben sie für das, was ihnen der Papst befohlen hat“, konstatierte der junge Mann.
„Ja“, räumte Jean ein, „aber ich glaube nicht, dass Christus das gewollt hat – so wenig wie dieser König“, erklärte Jean und setzte seinen Weg zum Statthalter fort. Balian folgte ihm und begann sich zu fragen, ob der Papst tatsächlich den Willen Gottes verkündete.
Drinnen im Amtssitz des Statthalters erfolgte zu diesem Zeitpunkt eine Untersuchung durch den Amtsträger, Graf Raymond von Tiberias. Sie richtete sich gegen Reynald de Châtillon, einst Fürst von Antiochia, gegenwärtig belehnt mit der Burg Kerak in Transjordanien – und bekannt als notorischer Unruhestifter. Auch er trug den Wappenrock der Templer, war aber nicht geistliches Mitglied des Ordens, sondern hatte – wie Guy de Lusignan – als großer Gönner* des Ordens und Befürworter der Ziele der Templer das noble Vorrecht erhalten, sich mit dem Rock der Tempelritter zu schmücken.
Im Gegensatz zu den eben gerade draußen in den Arkaden gehängten Templern wurde Reynalds Wappenrock allerdings nach wie vor von einem Schwertgürtel samt seinem Schwert gehalten. Reynald war ein breiter, wenigstens sechs Fuß großer Hüne, dessen deutlich über die Schultern fallendes, kräuselndes Haar unregelmäßig karottenrot und weiß gefärbt war, ebenso war der Bart karottenrot und weiß. Warum er so unterschiedlich farbige Haare hatte, wusste keiner so recht, nicht einmal Reynald selbst. Aber jeder wusste, wessen Markenzeichen diese Haarfarbe war …
„Wer sagt, dass ich plündere?“, fauchte Reynald. Graf Raymond von Tiberias, der hinter seinem Schreibtisch gesessen hatte, sprang auf, hielt mit der Linken sein Schwert fest – weniger, um es am Herunterfallen zu hindern, als sich selbst daran zu hindern, es zu ziehen und es direkt in Reynalds freches Schandmaul zu stoßen. Tiberias trug einen schwarzsamtenen Wappenrock mit dem Jerusalemer Wappen auf der linken Brustseite. Er war groß und hager, eine lange Narbe zog sich über sein rechtes Auge und die rechte Wange. Der Hieb, der ihm diese Narbe beschert hatte, hatte auch sein rechtes Bein getroffen und eine leichte Lähmung des rechten Knies hinterlassen, weshalb der Statthalter ein wenig hinkte. Er wies wütend auf einen sarazenischen Händler, der hinter Reynald am Fenster saß.
„Jener Zeuge!“, fauchte er zurück. „Ganz Jerusalem, Gott der Allmächtige, aber auch ich!“
Reynald drehte sich um. Im ersten Moment schien es, als würde er die Contenance verlieren, erkannte er doch einen Überlebenden des Überfalls. Aber Reynald wäre nicht Reynald de Châtillon gewesen, hätte er sich davon nachhaltig beeindrucken lassen,
„Dieser Zeuge – wenn Ihr ihn so nennen wollt – ist ein Sarazene! Er lügt!“, erwiderte er geringschätzig. Sarazenen waren für Reynald de Châtillon nicht mehr wert als der Dreck unter seinen Fingernägeln…
„Es wird der Tag kommen, Reynald de Châtillon, an dem Euch Euer Titel nicht mehr beschützen wird“, prophezeite der Statthalter. Reynalds Grinsen wurde noch breiter.
„Oh, und wann wird das sein? Gebt mir Bescheid, Tiberias, wenn die Menschen gleich sind und das Königreich der Himmel gekommen ist“, spottete er.
„Jene Templer wurden für einen Überfall gehängt, von dem ich weiß, dass Ihr ihn befohlen habt!“, fuhr Tiberias fort und wies zornig nach draußen. Reynald zuckte mit den Schultern.
„Beweist es“, sagte er. „Ich werde bis dahin in Kerak warten.“
Die Aussage des Sarazenen zählte für ihn nicht und der Wahrheitstreue des Rittereides ohne Not zu folgen, hielt Reynald für naiv. Raymond blieb nur knapp außerhalb von Reynalds Armlänge stehen.
„Der König wird Euch Eure Burg Kerak nehmen, Reynald!“
„Versucht sie mir zu nehmen, Tiberias! Ich werde dort sein“, versetzte Reynald und verließ den Amtssitz des Statthalters. Der Blick, mit dem er den lästigen Zeugen bedachte, verhieß nichts Gutes.
Tiberias sah ihm zornig nach. Er hatte keine Möglichkeit, Reynald festzuhalten. In Momenten wie diesen verfluchte er die Reichsverfassung, die belehnte Adlige allein dem Urteil des Königs unterstellte. Ohne Urteil des Königs konnte und durfte er Reynald nicht festsetzen. Aber er schwor sich, das in dem Augenblick zu tun, in dem ihm der König die geringste Möglichkeit dazu bot … Dennoch hoffte der Statthalter, dass er de Châtillon nicht aus seiner Burg Kerak herausholen musste. Freiwillig würde Reynald seine Burg nicht räumen – und Kerak hatte starke Mauern. Eine Belagerung würde Monate dauern, immense Summen verschlingen und unnötig das Leben von Rittern und Soldaten kosten, die angesichts der immer größeren Bedrohung durch die Sarazenen an anderer Stelle nötiger gebraucht wurden.
Der Sarazene in der Fensternische fuhr den Statthalter von Jerusalem auf Arabisch an:
„Ihr lasst ihn gehen! Warum lasst Ihr ihn gehen?“
Raymond von Tiberias wandte sich seinem Schreibtisch zu. Es war zwecklos, dem sarazenischen Karawanenhändler Nasser die Grundsätze der christlichen Reichverfassung zu erklären. Er hätte es weder akzeptiert noch verstanden.
„Ich kann Eure Karawanen nicht beschützen!“, sagte er stattdessen. „Es sei denn, Ihr willigt ein, von unseren Soldaten eskortiert zu werden.“
Nasser erhob sich grollend.
„Ich betreibe Handel, um Geld zu verdienen“, knurrte er, „nicht, um Gott zu beleidigen, in dem ich mit Christen verkehre.“
Tiberias schüttelte den Kopf. Es war diesen Leuten nicht beizubringen, dass Schutz durch christliche Soldaten kein Missionierungsversuch war.
„Aber Ihr nehmt christliches Gold“, versetzte er und wog eine Börse mit ansehnlichem Inhalt in seiner Hand.
„Gold ist Gold“, erwiderte Nasser, nahm ohne zu zögern die Börse aus Tiberias’ Hand und verließ das Amtszimmer des Statthalters.
„Natürlich“, grunzte Raymond. Pecunia non olet – Geld stinkt nicht. Das hatte offensichtlich nicht nur der römische Kaiser Vespasian gewusst …
Kapitel 21
Seines Vaters Sohn
Reynald de Châtillon und Karawanenführer Nasser war kaum fort, als Bruder Jean und Balian den Amtsraum betraten.
„Mylord Tiberias!“, grüßte Jean. Balian, der hinter dem Johanniter eingetreten war, war sofort fasziniert von einem Modell eines Abschnitts der Jerusalemer Stadtmauer und eines davor platzierten Belagerungsturms. Er nahm den Turm in die Hand und betrachtete ihn von allen Seiten. Technische Geräte waren eine Leidenschaft des jungen Mannes. Hier faszinierte ihn nicht nur das Ding selbst, sondern auch die sehr genaue, detailreiche Ausführung des Modells. Es war lange her, dass er sich zuletzt mit Belagerungstürmen und Wurfmaschinen befasst hatte, aber seine Stellung hatte sich verändert und vielleicht würde er bald damit wieder praktisch zu tun haben. Er ahnte nicht im Geringsten, wie bald – und dass seine Erfahrung und rasche Auffassungsgabe, die ihn die Schwäche speziell dieser Art von Belagerungsgeräten mit einem Blick erkennen ließ, eine gefragte Fähigkeit sein würde …
„Mylord“, hörte er Jean zum zweiten Mal, stellte das Turmmodell wieder an seinen Platz und trat zu Jean, der in seine Richtung wies und den Statthalter Raymond von Tiberias so auf ihn aufmerksam machte. Tiberias musterte Balian kurz.
„Es ist wahr. Du bist deines Vaters Sohn!“, bemerkte Tiberias.
Balian fragte sich zum wiederholten Mal, wie jeder, der Godfrey kannte und dem er vorgestellt wurde, sofort sicher war, dass er God-freys verschollener Sohn war – so viel Ähnlichkeit hatte er mit ihm nun wirklich nicht. Raymond nickte ihm freundlich zu.
„Er war mein Freund, ich bin der deine“, sagte er. „Godfrey ist tot! Ich hätte mir einen besseren Zeitpunkt gewünscht!“, knurrte er dann und wandte sich ab. Der Johanniter sah ihm mit einem hintergründigen Lächeln nach. Egal, wann Godfrey diese Welt verlassen hätte: Der Zeitpunkt wäre immer der falsche gewesen, so lange Raymond von Tiberias Godfrey überlebte. Tiberias und Godfrey waren schon immer so gute Freunde gewesen, dass sich einer auf den anderen blind hatte verlassen können; Freunde, die sich ohne ein Wort verstanden hatten. Sie hatten sich gegenseitig so oft das Leben gerettet, dass eine Aufrechnung nicht möglich gewesen wäre – die beiden Freunde hätten es ohnehin nie versucht …
„In den Straßen wird verkündet, dass du einen großen Fürsten von Syrien getötet hast“, sagte Tiberias und ging zur Fensternische, um Kelche mit Wein zu füllen und den Wein mit einigen Stücken Zimt zu würzen.
„Salahadin persönlich schickte die Nachricht, dass euer Kampf den Frieden nicht beeinflusst, dass du Anlass dazu hattest“, fuhr er fort. Seine Worte klangen lobend und anerkennend, Balian hingegen schätzte Aufmerksamkeit dieser Art nicht wirklich. Raymond drehte sich um und bot den Wein an. Jean nahm den Kelch an, Balian lehnte mit einem leichten Kopfschütteln ab.
„Was weißt du von Salahadin?“, fragte Raymond dann an Balian gewandt.
„Er ist der König der Sarazenen – und er hat dieses Königreich umzingelt“, gab der junge Mann sein Wissen wieder. Tiberias nickte anerkennend. Zum einen sagte dieser junge Baron nicht unnötig viel, zum anderen hatte das, was er sagte, Sinn. Der Statthalter schenkte sich selbst einen Kelch Wein ein und hob ihn zu Jean, der seine Geste erwiderte. Sie tranken einen Schluck von dem guten Wein.
„Er hat alleine in Damaskus zweihunderttausend Mann“, erwiderte Tiberias und ließ die ungeheure Zahl einen Moment wirken. Im ganzen Königreich Jerusalem, einschließlich der mehr oder weniger selbstständigen Kreuzfahrerstaaten Tripolis und Antiochia, gab es kaum so viel waffenfähige Männer auf christlicher Seite, wie der Sultan von Ägypten allein in Damaskus zur Verfügung hatte. Wenn Balian das augenscheinlich nur wenig berührte, mochte es daran liegen, dass er keinen Überblick über die tatsächlichen Kräfteverhältnisse hatte, sagte sich Tiberias, als der Sohn seines Freundes keine erschrockene Reaktion zeigte.
„Er könnte einen Krieg gewinnen, wenn er ihn wollte“, fuhr er fort. „Und ihm wird täglich Anlass dazu gegeben. Durch fanatische Neuankömmlinge aus Europa, durch Templerbastarde … wie … Reynald de Châtillon. Hier von diesem Raum aus bewahre ich den Frieden, soweit es mir möglich ist. Aber … Salahadin und der König, sie gemeinsam würden eine bessere Welt erschaffen.“
Balian erkannte die Worte seines Vaters in Tiberias’ Äußerung wieder. Sie mussten wirklich gute Freunde gewesen sein, wenn sich ihre Äußerungen und Ansichten so glichen, sagte er sich. Jean, der wenig verwöhnte Johanniterbruder, plünderte genüsslich eine Traube Weinbeeren.
„Und wenn sie nur für eine Weile besteht, Tiberias, so hat sie doch gelebt“, gab er in seiner schelmisch–nachdenklich–scharfsinnigen Art zu bedenken.
„Argh!“, grunzte Tiberias mit einer wegwerfenden Handbewegung. Er kannte Jeans Art, die ihm aber letztlich ebenso gefiel wie das zuweilen schroffe Wesen Godfreys.
„Was … hat dir dein Vater über … deine Verpflichtungen … erzählt?“, setzte Raymond die Prüfung des neuen Ritters fort.
„Dass ich ein aufrechter Ritter sein soll“, erwiderte Balian ernsthaft. Ein spöttisches Lächeln kräuselte sich um die Lippen des Statthalters, der erst meinte, sich verhört zu haben, so ungläubig schaute er den Sohn seines Freundes an. Die Aussage klang unendlich grün und unerfahren, aber Balians Gesichtsausdruck zeugte von Ernsthaftigkeit und Reife. Er meinte wirklich, was er sagte; und es waren ohne Zweifel Godfreys Worte, erkannte Tiberias.
„Ich hoffe, dass die Welt … und Jerusalem … Platz hat … für eine solche … Seltenheit … wie einen vollkommenen Ritter“, sagte Tiberias. „Habt ihr schon gespeist?“, fragte er dann. Beide verneinten.
Kapitel 22
Die königliche Tafel
Ein Mahl bei König Balduin IV. von Jerusalem bedingte angemessenere Kleidung als eine Kriegsrüstung aus Wappenrock, Kettenhemd und Schwertgürtel, mochte sie auch von besonderer Güte sein. Zudem geziemte es sich nicht, im Palast des Königs bewaffnet zu erscheinen, war man zu einem Mahl geladen. Jean und Tiberias veranlassten daher, dass Balian Wappenrock, Kettenhemd und Schwert ablegte und stattdessen eine dunkelblaue, sehr dünne Seidentunika anzog, die an den Ärmeln und am Halsausschnitt mit kostbarer, goldgewirkter Borte gesäumt war. Goldenes Rankenwerk mit Blättern war in den Seidenstoff eingewirkt. Ein Gürtel aus dem gleichen Stoff wie die Tunika, ebenfalls mit Goldborte gesäumt, gab der Tunika Form und Halt und betonte die schlanke Gestalt des jungen Barons sehr vorteilhaft. Ein dunkelblaues Hemd mit gestickten Verzierungen an Kragen und Ärmeln, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe ergänzten die edle Ausstattung. Die beiden Älteren gestanden sich ein, selten eine so noble Erscheinung von natürlichem Adel gesehen zu haben wie jetzt, als Balian mit ihnen zum Palast ging.
An einer langen Tafel in einem der zahlreichen Innenhöfe des Jerusalemer Königspalastes erhielten der Statthalter, der Erbe des Barons von Ibelin und der Johanniterbruder Plätze. Außer ihnen waren noch der Lateinische Patriarch Heraclius sowie diverse andere Adlige anwesend. Sie saßen gerade, als der Ausrufer seinen Stab auftippte und laut verkündete:
„Prinzessin Sibylla von Jerusalem und ihr Gemahl Guy de Lusignan!“
Die Gesellschaft erhob sich wieder zu Ehren der Prinzessin und Ihres Gemahls, die gemessenen Schrittes unter den Arkaden hervorkamen. Balian sah in Richtung der Arkaden und hätte sich beinahe verschluckt, obwohl bisher er weder einen Bissen gegessen noch einen Schluck getrunken hatte, als er jene Sibylla erkannte, die ihm am Morgen so heftig in den Hof gepoltert war. Jetzt war ihm auch klar, was Kevin – Godfreys seliger Sergeant – gemeint hatte, als er Balian vor einem künftigen König Guy de Lusignan gewarnt hatte …
Guy geleitete Sibylla zur Tafel. Die junge Frau nahm am Kopfende Platz, ihr Gemahl auf dem ersten Platz zu ihrer Linken, gegenüber von Tiberias. Sibylla sah den sichtlich verblüfften Balian und lächelte ihm freundlich zu. Er runzelte leicht die Stirn, erwiderte dann ihr Nicken.
„Und? Wie viele Ritter habt Ihr in Frankreich gefunden?“, erkundigte sich Tiberias bei de Lusignan. Wie immer war er besorgt um eine ausreichende Stärke der waffenfähigen Männer, die Jerusalem schützen konnten und sollten. Balian schloss aus der Frage, dass sein Vater wohl mit einem ähnlichen Auftrag nach Frankreich gekommen war und dies genutzt hatte, um nach seinem Sohn zu suchen. Er hatte seinen Auftrag nicht erfüllen können, denn statt seiner, der mit ihm gereisten Soldaten und der möglicherweise neu angeworbenen Männer war nur Balian allein gekommen … Ein unvollkommener Ersatz, sagte er sich. Der Gemahl der Prinzessin brach sich ein Stück Brot ab und schenkte sich Wein ein, als er erwiderte:
„Fünfzig!“
Es klang so überheblich wie immer, wenn er sprach.
„Haben sie dem König die Treue geschworen?“, fragte Tiberias weiter.
„Selbstverständlich, Tiberias. Offenkundig …“
De Lusignan brach mitten im Satz ab, als er Balian erkannte, der neben Tiberias saß. Sein zufriedenes Grinsen wich einem missmutigen Ausdruck.
„Du sitzt an meiner Tafel!“, ereiferte sich der Gemahl der Prinzessin affektiert. Balian sah ihn geradeheraus an.
„Ist dies nicht die Tafel des Königs?“, fragte er ruhig und kühl. Dazu hatte man ihn jedenfalls eingeladen, erinnerte er sich. Guy lachte spöttisch auf.
„Ist sie das? Ich habe seit Jahren keinen König mehr an ihr sitzen sehen!“, versetzte er bissig. Keiner widersprach, denn tatsächlich wurde der König bei der Tafel seit einigen Jahren durch seine Schwester Sibylla vertreten.
„Ich … kann nichts essen“, klagte er. „Ich … ich bin wählerisch, was meine Gesellschaft angeht. In Frankreich hätte so einer kein Recht auf ein Erbe, aber hier … hehehe … gibt es keine zivilisierten Regeln …“, nörgelte er näselnd weiter und zeigte mit dem Finger auf Balian. Zwar hatte das Wort Bastard nicht ausgesprochen, aber alle wussten, was Guy meinte. Es war eine schwere Beleidigung unter Adligen, selbst wenn man es nicht direkt aussprach. Alle – von Balian abgesehen, der Guys Blick standhielt – sahen betreten auf ihre Teller. Guy ließ angewidert sein Brot fallen, ohne davon zu essen. Ihm war der Appetit einfach vergangen.
„Ich habe im Osten zu tun“, sagte er dann und erhob sich. Raymond von Tiberias, der einen Angriff auf Balian befürchtete, sprang ebenfalls auf, doch de Lusignan trat zu Sibylla.
„Meine Gemahlin schert sich nicht um meine Abwesenheit“, fuhr er fort, streichelte Besitz ergreifend ihre schmalen Schultern, drückte ihr dann aber einen eher freundschaftlichen Kuss auf die Wange. Sibylla wandte sich geradezu angewidert ab, wie Balian erschrocken feststellte.
„Also ist sie entweder die beste Gemahlin – oder die allerallerschlimmste!“, versetzte Guy, sie in der Öffentlichkeit schwer beleidigend. Dann wandte er sich zum Gehen, trank dabei noch seinen Wein aus und warf den leeren Becher einem Diener zu, der ihn knapp auffangen konnte.
„Werdet Ihr Euch mit Reynald treffen?“, fragte Tiberias listig. De Lusignan drehte sich nochmals um.
„Nein, Mylord! Er ist in Ungnade gefallen!“, entgegnete er. „Ich bin ehrenwertes Mitglied dieses Hofes! Warum sollte ich mich zusammenschließen mit diesem … Unruhestifter?“, vollendete er den Satz und verließ den Innenhof. Tonfall und die Art, wie er tänzelnd den Hof verließ, legten den Verdacht nahe, Guy de Lusignan wäre Männern eher zugetan als Frauen, aber Sibylla hatte in dieser Hinsicht andere Erfahrungen …
Tiberias sah dem Gemahl der Prinzessin nach, dann hob er seinen Becher.
„Auf die allerbeste Gemahlin!“, brachte er einen versöhnlichen Trinkspruch auf die Schwester des Königs aus. Sibylla lächelte den Statthalter freundlich an und erhob ebenfalls ihren Becher.
„Juweriq allah al-Quds![1]“, erwiderte sie Tiberias’ Höflichkeit – und bezog sie auf ihren Bruder Balduin. Die engsten Höflinge wussten, was damit gemeint war, denn Balduin sagte zuweilen von sich, dass er Jerusalem sei …
Ein Diener trat zu Tiberias und flüsterte ihm etwas zu.
„Der König möchte Godfreys Sohn sehen“, sagte er. Tiberias wollte mit dem Erben des Barons fortgehen, als Sibylla ihn leicht am Arm festhielt.
„Ich führe ihn zu ihm“, erwiderte sie. Raymond nickte ergeben.
Balian ging mit der schönen Frau durch die ihm unendlich erscheinenden Flure des königlichen Palastes.
„Heute Morgen sprach ich, ohne zu wissen, wer Ihr seid“, sagte der junge Mann mit um Entschuldigung bittendem Unterton. Sibylla – knapp einen halben Kopf kleiner als Godfreys hochgewachsener Sohn – sah zu ihm auf.
„Ich wusste, wer Ihr seid“, entgegnete sie mit einem verführerischen Ton in ihrer für eine Frau recht dunklen Stimme. „Es ist unverkennbar“, setzte sie dann die Reihe derer fort, die beim ersten Ansehen schon erkannten, dass sie mit Balian Godfreys Sohn vor sich hatten.
„Ich liebte Euren Vater – und ich werde Euch lieben“, setzte sie hinzu. Balian sah sie vorsichtig an und fragte sich, was sie damit genau meinte. Sie blieb stehen, er hielt ebenfalls an.
„Fürchtet Ihr Euch, bei mir zu sein?“, fragte sie direkt. Er erwiderte ihren Blick und schenkte ihr ein sanftes, freundliches Lächeln, wie sie es selten an einem Mann gesehen hatte.
„Nein“, sagte er. Sein Lächeln wurde breiter und gleichzeitig scheuer. „… und ja“, fügte er hinzu. Dieses scheue Lächeln des jungen Ritters weckte das Interesse der Prinzessin in höchstem Maß. Sie kam ihm ein kleines Stück näher, blieb aber eine gute Armlänge von ihm entfernt stehen und lächelte ebenso hoheitsvoll wie gewinnend.
„Eine Frau in meiner Stellung hat zwei Gesichter: Eines, das sie der Welt zeigt und eines, das sie vor ihr verbirgt. Für Euch werde ich nur Sibylla sein“, sagte sie dann. Er begriff, dass ihre hochmütige, herrische Art in der Öffentlichkeit ihr „öffentliches“ Gesicht war, das sie wahren musste, um ihre Stellung und ihre Autorität als königliche Prinzessin zu erhalten. Privat wollte sie offenbar ganz anders sein. Balian konnte dieser Umstand nur recht sein. Sie war eine schöne Frau, faszinierend, verführerisch – allerdings auch verheiratet. Er mahnte sich selbst zur Zurückhaltung.
„Tiberias hält mich für unberechenbar“, flüsterte sie dann im Verschwörerton und sah sich vorsichtig um. Balian folgte dem besorgt erscheinenden Blick der Prinzessin mit einem Gesichtsausdruck, der Entschlossenheit verriet. Sollte es jemand wagen, die Prinzessin anzugreifen, musst der erst an ihm vorbei … Er bemerkte gerade noch, dass sich einer der Palastwächter im Jerusalem-Rock diskret in den Gang zurückzog, aus dem er mit Sibylla gekommen war.
Sie sah Balians Gesicht und war beeindruckt von der Bandbreite der Ausdrücke in seinen schönen Gesichtszügen, die er mit nur geringen Veränderungen der Partie um die Augen bewirken konnte. Zudem konnte er zwischen völliger Entspannung und vollkommener Aufmerksamkeit so rasch wechseln wie kaum ein anderer Höfling in Jerusalem. Im Wesentlichen – das stellte Sibylla verblüfft fest – zeigte sich die Veränderung in seinen Augen selbst: Waren sie im entspannten Zustand von warmem, reinem Braun wie türkische Haselnüsse, zuweilen schimmernd wie transparenter, dunkler Bernstein, wurden sie im Zustand der Entschlossenheit dunkler. Sie hatte einen ähnlichen Schattierungswechsel bereits bei der Konfrontation zwischen Guy und ihm bemerkt. Dieser Mann war nicht leicht einzuschüchtern. Gleichzeitig amüsierte sie sich über ihn, hatte sie doch im Palast wirklich nichts zu befürchten. Sie lächelte schelmisch.
„Ich bin … unberechenbar“, setzte sie hinzu und erntete einen verblüfften Blick ihres Gegenübers. Sie liebte es, mit Menschen ein wenig zu spielen und sie zu necken – vor allem, wenn sie jemanden mochte.
Sie wandte sich zum Gehen, er wollte ihr folgen, doch sie hielt ihn mit einer leichten Handbewegung auf.
„Nein“, sagte sie und zeigte auf die Tür, auf die sie beim Betreten dieses Flurs zugegangen waren.
„Dort“, ergänzte sie und verschwand in der Seitentür, während Balian ihrer Wegweisung folgte und durch die bezeichnete Tür ging.
[1] „Gott segne Jerusalem!“ (Übersetzung gemäß Untertitel im Film.) Phonetische Wiedergabe, da aus den Drehbüchern oder den Originaluntertiteln nicht zu entnehmen.
Kapitel 23
König Lepra
Balian trat auf einen Arkadengang, in dem zwei Leibwächter des Königs postiert waren. Jerusalem schimmerte im Abendlicht vor den nach Westen offenen Arkaden, in denen bereits Fackeln entzündet waren. Von irgendwoher schrie ein Pfau. Die Wächter – offenbar informiert – ließen Balian passieren. Am Ende der Arkaden war wiederum eine Tür, vor der zwei große Kohlebecken Licht gaben. Der neue Baron von Ibelin schritt durch die Tür und gelangte in ein großzügiges Gemach, in dem es angenehm kühl und luftig war. Diverse Vorhänge teilten es, Feuer in Kohlebecken und einige Kerzen auf den Tischen erhellten es. Balian bemerkte eine Gestalt, die mit dem Rücken zur Tür an einem Tisch saß und schrieb. Die Gestalt hatte eine dick bandagierte linke Hand, die rechte steckte in einem weißen Handschuh und führte gleichwohl den Gänsekiel sicher – Zeichen dafür, dass die Gestalt Übung darin hatte, so zu schreiben.
„Kommt näher!“, hörte Balian eine junge, männliche Stimme, die von der vermummten Gestalt kam. „Ich bin froh, Godfreys Sohn zu treffen. Er war einer meiner besten Lehrer. Er war dabei, als ich mir beim Spielen mit anderen Jungs den Arm verletzte und er war es – und nicht die Leibärzte meines Vaters – der bemerkte, dass ich keinen Schmerz empfand. Er weinte, als er meinem Vater die Nachricht überbrachte, dass ich … Lepra … habe.“
Balduin IV., Sohn des Amalrich aus dem Hause Anjou, kinderloser König des heiligen Jerusalem, erhob sich von seinem Schreibtisch und schlug den Schleier zurück, drehte sich um und sah Godfreys Sohn Balian abwartend in der Tür stehen. Der zurückgeschlagene Schleier ließ Balian die silberne Gesichtsmaske des jungen Königs erkennen, der noch etwas jünger war als er selbst. Die Maske hatte sowohl aus dem Metall herausgearbeitete Augenbrauen als auch einen dünnen Oberlippenbart, der in längeren Enden um die ebenfalls sehr naturalistische Mundöffnung mündete und die Maske als das erscheinen ließ, was sie war: Das tatsächliche Gesicht des Königs von Jerusalem, nicht nur eine bloße Abdeckung für sein von Lepra entstelltes Gesicht, das ihn seit Jahren nötigte, seine Mahlzeiten allein in seinen Gemächern einzunehmen, um seinen Gefolgsleuten den grauenhaften Anblick seines leprösen Gesichtes zu ersparen.
„Die Sarazenen sagen, dass diese Krankheit Gottes Rache wider die Eitelkeit unseres Königreichs sei. So elend wie ich bin, glauben die Araber, dass die Qualen, die mich in der Hölle erwarten, weitaus schlimmer und länger sein werden. Wenn das wahr ist, nenne ich es unfair!“, fuhr Balduin fort. So furchtbar seine Worte waren, der Tonfall zeugte durchaus von Galgenhumor. Er kam langsam auf Balian zu, der noch immer abwartend und schweigend an der Tür stand. Eine einladende Handbewegung des Königs wies auf einen bequemen Stuhl.
„Kommt, setzt Euch!“, bot er an. Ein Diener brachte Wein und schenkte an einem Tisch ein. Auf dem Tisch bemerkte der junge Baron ein begonnenes Schachspiel.
„Spielt Ihr Schach?“, fragte Balduin, als sie sich setzten.
„Nein“, erwiderte Balian. Spielen war etwas für Kinder und für erwachsene Leute mit zu viel Zeit, aber nicht für einen Handwerker, der für seinen Lebensunterhalt arbeiten musste. Seit er erwachsen war, hatte Balian nicht mehr gespielt. Balduin machte eine ausholende Handbewegung und wies präsentierend über das Schachbrett.
„Die ganze Welt liegt im Schach“, sagte er. Dieses Strategiespiel galt seit je her als das Spiel der Könige, das aber auch von vielen Adligen erlernt wurde, um den Verstand für Strategie und Taktik zu schärfen.
„Jede Bewegung kann deinen Tod bedeuten. Entferne dich von dem Punkt, an dem du begonnen hast und du kannst dir deines Endes nicht sicher sein“, fuhr der König fort und setzte den Läufer, den er in die Hand genommen hatte, auf dem Brett ab. „Warst du dir deines Endes schon mal sicher?“, erkundigte er sich dann interessiert und mit vertraulicher Anrede bei Balian. Der junge Baron lächelte sanft.
„Das war ich“, sagte er.
„Was für ein Ende war das?“, hakte Balduin nach, dem die Antwort etwas knapp ausfiel.
„Mein Grab lag hundert Schritte von dort, wo ich geboren wurde“, erklärte Balian. Nur wenige Menschen reisten weiter als bis in den nächsten Marktort, wenn überhaupt so weit. Für die meisten Menschen stellte es schon eine Versuchung Gottes dar, wissen zu wollen, was hinter dem Nachbardorf oder auch nur hinter dem Hügel war, auf dem das eigene Haus lag … Bis zu dem Tag, an dem Balian von seiner tatsächlichen Abstammung erfahren hatte, war es bei ihm nicht anders gewesen, sah man davon ab, dass er für seinen Fürsten zwangsweise in den Krieg gezogen war.
„Und jetzt?“, fragte Balduin weiter.
„Jetzt bin ich in Jerusalem und sitze vor einem König“, antwortete Godfreys Sohn. Balduin entnahm daraus, dass beide Tatsachen etwas völlig Unerwartetes für sein Gegenüber waren. Balian hatte sich im Schachspiel des Lebens von dem Punkt entfernt, an dem er begonnen hatte …
„Hmm“, brummte Balduin, Balians Antwort zur Kenntnis nehmend. „Als ich sechzehn Jahre alt war …“, fuhr der junge König dann fort, „errang ich einen großen Sieg. An dem Tag dachte ich, ich würde hundert Jahre alt werden – jetzt weiß ich, dass ich nicht einmal dreißig werde!“, erklärte Balduin dann in einem fatalistischen Ton. Seine behandschuhte rechte Hand griff wieder nach dem weißen Läufer des Schachspiels. Er behielt ihn in der Hand, ohne ihn auf ein neues Feld zu setzen.
„Keiner von uns weiß wirklich, wie sein Ende aussehen wird oder wessen Hand ihn dorthin führen wird. Ein König mag einen Mann fordern, ein Vater mag Anforderungen an seinen Sohn haben“, fuhr er fort. „Und dieser Mann kann auch sich selbst fordern. Und nur dann kann dieser Mann wahrhaftig sein eigenes Spiel spielen. Merkt Euch: Egal wie man mit Euch spielt oder wer: Eure Seele … gehört Euch allein“, sagte er dann mit einer für sein Alter unglaublichen Weisheit. „Selbst wenn jene, die mit Euch spielen, Könige sind oder Männer mit Macht – wenn Ihr vor Gott steht, könnt Ihr nicht sagen, dass man Euch befohlen hätte, so oder so zu handeln oder dass Tugendhaftigkeit gerade nicht angebracht war. Das wird nicht genügen. Denkt immer daran!“, warnte Balduin.
„Das werde ich!“, versprach Balian.
Nach einer Weile nahm Balduin einen großen Papierbogen zu Hand und gab ihn Balian.
„Wisst Ihr, was das ist?“, fragte er. Balian nahm das Papier und warf einen prüfenden Blick darauf.
„Die Befestigungsanlagen“, erwiderte er prompt. Balduin lächelte hinter seiner Maske. Offensichtlich hatte Godfrey in seinem Brief nicht geschwindelt, der ihm seinen Sohn als Fachmann für Belagerungsmaschinen beschrieben hatte …
„Was haltet Ihr davon?“, fragte der König und bemerkte einen etwas unwilligen Blick bei seinem Gegenüber. „Euch gefällt nicht, was Ihr seht“, erkannte er. „Wie würdet Ihr es machen?“
Balian nahm ein Stück Zeichenkohle und legte den Bogen auf den Tisch. Vom Blatt sah er zu seinem König auf.
„Ein Kreuz – oder noch besser: ein Stern. So etwa“, erklärte er und begann schon zu zeichnen. „So kann man die Stadt verteidigen, egal, von welcher Seite der Feind anrückt.“
Balduin betrachtete das Ergebnis, das der junge Baron ihm präsentierte.
„Ja, das gefällt mir“, sagte der König anerkennend. „Denn Mauern sind schwerer zu attackieren. Sehr gut. Begebt Euch zum Haus Eures Vaters in Ibelin – es gehört jetzt Euch – und beschützt von nun an den Pilgerpfad. Achtet besonders auf die Juden und die Moslems“, beauftragte der König seinen neuen Baron. Er beugte sich nach vorn, um seinen weiteren Worten mehr Gewicht zu geben.
„Alle sind willkommen in Jerusalem! Nicht nur, weil es dem Zweck dient, sondern weil es richtig ist. Beschützt die Hilflosen“, stellte der Monarch klar. Balian nickte. Diese Weisung zu befolgen, das war leicht. Balduins Auffassung deckte sich in dieser Hinsicht vollkommen mit seiner eigenen.
„Und dann eines Tages, wenn ich hilflos bin, werdet Ihr kommen, und mich beschützen“, setzte Balduin hinzu. Balian lächelte sanft. Genau das war seine Absicht.
Ein alter Wächter leuchtete Balian mit seiner Fackel, um ihm den Weg zurück durch die unendlichen Flure des Palastes zu zeigen. Der junge Baron folgte ihm und sah sich staunend um. Zwar war der Flur von einigen Kohlebecken erhellt, doch gaben die Becken nur im oberen Teil des Flurs Licht, darunter war auf dem dunklen Mosaikboden nur zu ahnen, wohin die Füße traten. Im Halbdunkel stolperte Balian plötzlich über etwas. Er bückte sich und hob etwas auf, was er hier gewiss nicht erwartet hatte: einen kleinen Spielzeugritter. Es war eine vollkommen aus Metall gefertigte, etwa handgroße, vollplastische Figur auf einem Pferd, deren Sockelplatte mit vier Rädern versehen war. Bewaffnet war der Ritter mit einer Lanze, die bei der Kollision mit Balians Fuß übel verbogen worden war.
Geschickt bog der gelernte Schmied die kleine Lanze wieder gerade und steckte sie dem Ritter wieder in das Loch unter dem rechten Arm. Als er das Spielzeug wieder abstellen wollte, öffnete sich die Tür zu den Gemächern der Prinzessin und ein blondschöpfiger Junge, vielleicht sieben oder acht Jahre alt, lugte durch den Spalt. Balians und sein Blick trafen sich.
Der Junge sah den fremden Mann verblüfft an, sagte aber kein Wort. Balian stellte den Miniritter ab, erhob sich und ging langsam weiter, behielt den Jungen aber im Blick. Der Junge wartete, bis Balian sich ein paar Schritte entfernt hatte, dann trat er aus dem Gemach und nahm seinen Ritter mit glückstrahlenden Augen auf und sah Balian nach. Der junge Baron lächelte sanft und freundlich, der Junge erwiderte sein Lächeln scheu und ging mit seinem Ritter eilig wieder in die Gemächer der Prinzessin. So kostbar, wie er mit einer knielangen, hellen Seidentunika gekleidet war, schien er zur königlichen Familie zu gehören. Doch wer er war, wusste Balian nicht …
Kapitel 24
Ibelin
Die Sonne stand tief, als ein Trupp gerüsteter Reiter, Staub aufwirbelnd, in Zweierreihen eilig auf das kleine Dorf Ibelin westlich von Jerusalem zustrebte. Balian ritt an der Spitze seiner Männer, ihm folgten direkt Almaric und Michel, dann die übrigen Söldner im Dienste Ibelins, die bisher in Jerusalem gewesen waren. Allein Balian war ohne Helm und Kettenkapuze. Irgendwie empfand er den Helm mit dem Nasenschutz und die gefütterte Kettenkapuze in dieser Gegend als beengend und viel zu heiß.
Vor sich sah er ein Dorf, in dem Leben herrschte – und der Tod nahe war, so empfand der junge Baron es beim Anblick der ausgedörrten Felder. Die Kinder des Dorfes sahen die Männer unter dem gelben Banner mit dem dunkelroten Tatzenkreuz kommen, jubelten, rannten lachend und scherzend hinterher. Die Truppe folgte der Straße, die einen Bogen um das erste Haus machte.
Hinter dem Haus hatte Balian einen besseren Blick auf das gesamte kleine Dorf und zwei Burganlagen. Er verlangsamte sein Pferd und sah sich das genauer an. Die eine Burg, ein mächtiges, tief in sich verschachteltes Bauwerk, lag links von ihm und bewachte den Zugang zu dem in einem Tal liegenden Ort, so schien es. Rechts davon lag ein niedriges Haus, weiter rechts daneben, auf einem Hügel gebaut, ein weiteres Haus aus Lehmziegeln. Die andere Burganlage befand sich auf einem kleineren Hügel jenseits des Taleinschnitts, der eigentliche Ort lag noch hinter der zweiten Burganlage jenseits halbverdorrter Palmen und staubiger Felder.
Die zweite Burganlage hatte drei Türme in der Außenmauer: Zwei an der rechten Seite, und den Torturm mit dem weit offenen Tor, der von der Mitte etwas nach links versetzt war. Das eigentliche Herrenhaus schloss sich links von Balians Sichtpunkt an den Torturm an, war augenscheinlich zweistöckig und hatte eine große Terrasse, über die ein Sonnensegel gespannt werden konnte. Der Umstand, dass das Herrenhaus eine offene Terrasse hatte, widersprach jedoch einer regelrechten Burganlage, mochte die Terrasse auch gut fünf Klafter über dem Erdboden sein. Dafür war eine wirkliche Burg hinter der sichtbaren Tormauer mit vier massiven Türmen erkennbar. Für den Fall, dass die Bewohner der Burganlage sich zurückziehen mussten, gab es also eine sichere Zuflucht in der umfriedeten Anlage. Um den gesamten Gebäudekomplex lief eine Mauerkrone, die in ihrer Ausgestaltung die orientalische Provenienz nicht verschweigen wollte. Typisch maurische Steinschnitzereien und kleine Vorsprünge, die einfach nur der Dekoration dienten, ohne einen unmittelbaren praktischen Nutzen zu haben, verschönten die Krone zusätzlich. Almaric bemerkte den Blick seines jungen Herrn und schloss zu ihm auf.
„Dort, Mylord: Ibelin!“, wies er Balian auf seine neue Heimstätte hin. Balian nickte und trieb sein Pferd wieder an.
Wenig später ritten sie durch das offene Hoftor. Das direkt links neben dem Torturm liegende Haus erwies sich als nur teilweise zweistöckig. Ein breites, abgeschrägtes Dach mit halbrunden Dachziegeln überdeckte einen etwa einen Klafter breiten Arkadengang. Darüber befand sich vor dem an den Torturm anschließenden oberen Stockwerk des Herrenhauses, das nur wenig breiter war als das Torhaus, noch eine Dachterrasse. Sie zog sich über die gesamte Länge des Arkadenganges und endete wie das Herrenhaus etwa drei Klafter vor dem nordöstlichen Turm der inneren Burg.
Zwischen Turm und Herrenhaus sicherte nur eine dünne, in der Krone teilweise ausgebrochene Mauer den Zugang in die Herrenhausanlage. Den mittleren Arkadenbogen des Herrenhauses verschloss eine Holztür, die jetzt weit offen stand. In den Bögen rechts und links daneben waren je zwei Spitzbogenfenster, die von innen mit Läden aus luftigem, kunstvollem Holzschnitzwerk verschlossen waren. Ein älterer Mann, dem Äußeren nach ein Araber, bekleidet mit einem Burnus und einem für Muslime typischen Scheitelkäppchen auf dem Kopf, sah Balian zunächst fragend an, dann verbeugte er sich diensteifrig und ließ einen Schwall arabischer Sätze über Balian schwappen, von denen der junge Baron lediglich den letzten halbwegs verstand und daraus entnahm, dass der Verwalter über sein Erscheinen Gott dankte. Balian stieg vom Pferd, das ihm gleich durch eifrige Stallburschen abgenommen wurde, die auch die Tiere seiner Männer mitnahmen.
Die Gesten des Haushofmeisters Latif unterstützten, was Balian mit seinen noch beschränkten Arabischkenntnissen verstand. Daraus war auch abzulesen, dass der junge Herr sich sein Haus doch ansehen möge. Latif eilte voraus, riss die Terrassentür auf, um dem neuen Herrn von Ibelin den grandiosen Blick zu präsentieren, der sich ihm von der Terrasse aus bot. Doch sein neuer Herr blieb mitten im Haus stehen und sah sich um. Er stand in einem großen Raum, der direkt auf die Terrasse hinausführte. Auf der rechten Seite fand sich in der Mitte der Wand ein offener Kamin, rechts davon, vor dem geschnitzten Fensterladen (der von innen eher nach einer Tür aussah) ein mit diversen Kissen bequem ausgestatteter Diwan, davor ein niedriger runder Tisch; links, gegenüber dem Diwan eine Sitzbank, deren schon recht durchgesessene Sitzfläche und Rückenlehne augenscheinlich aus Palmfasern geflochten waren und zwei lehnenlose Scherenstühle. Links neben dem Kamin lehnte ein sarazenisch anmutender runder Buckelschild an der Wand, vielleicht ein Beutestück, das Godfrey von Ibelin einmal zugefallen war.
Das linke Drittel des Raumes war durch zwei gleichzeitig als Regal dienende Raumteiler als Speiseraum abgegrenzt. Ein Vorhang zwischen den beiden Raumteilern, der jetzt zurückgezogen war, diente zusätzlich der Abschirmung gegen den eigentlichen Wohnraum. Balian stockte, als er auf dem Tisch ein Huhn mit fast der gleichen Federzeichnung hocken sah, wie er es auch in Saint-Martin-au-Bois gehabt hatte.
‚Ein Huhn auf dem Tisch – ziemlich rustikal, dieses Gut‘, durchzuckte es ihn. Seine Hühner in Frankreich hatten jedenfalls keinen Zugang zum Haus gehabt. So ungewöhnlich die Anwesenheit eines Huhns in dieser Gegend dem jungen Baron überhaupt schien, war es hier doch eher zuhause als in Frankreich, denn das Haushuhn stammte ursprünglich aus Palästina …
Eine offene Tür in der linken Wand des Speiseraums mochte in die Küche führen, vielleicht auch in einen Vorratsraum oder in das obere Stockwerk. Weiter vorn, Richtung Terrassentür, war in der Wand noch ein zweiflügeliges Fenster, das ebenfalls mit Schnitzwerk verziert war. Der obere Bereich der Außenwand des Essbereiches wurde verziert durch einen Totentanz, eine häufig in reichen Häusern anzutreffende Kunstdarstellung, die daran erinnern sollte, dass der Tod niemanden ausnahm. Die Skelette des Totentanzes waren durch Kleidungsstücke deutlich als männlich oder weiblich gekennzeichnet und in weißem Putz auf den sonst rötlichen Untergrund aufgetragen. Zwischen den Figuren war in wenigen Worten ein lateinischer Sinnspruch aus dem weißen Putz geritzt:
„Quod sumus … hoc eritis“, las Balian leise, „So wie wir sind … so wirst du sein“, übersetzte er murmelnd.
Latifs Ruf machte ihn wieder aufmerksam. Er folgte dem Haushofmeister mit langsamen Schritten, sah sich genau an, was er vorfand. Nahezu das ganze Dorf lag dem auf einem kleinen Hügel gebauten Herrenhaus zu Füßen und war von dort aus zu übersehen. Almaric kam hinter dem Baron ebenfalls auf die Terrasse. Latif dienerte nochmals tief und blieb dann seitlich an dem steinernen Terrassengeländer stehen. Balian ging nach vorn ans Geländer. Ibelin gefiel ihm schon jetzt – obwohl es noch einiges zu tun gab, wie er schnell erkannte. Er stützte sich auf das Geländer und ließ seinen Blick über die verdorrten Felder und matten Palmen gleiten. Almaric stand hinter ihm und sah eher missmutig auf das, was sich seinen Augen bot. Das Strahlen in Balians Augen konnte er nicht sehen. Er selbst sah nur Staub, Trockenheit und Armut.
„Euer Vater war bedeutend“, sagte er schließlich. „Seine Ländereien waren es nicht“, setzte er grummelnd und peinlich berührt hinzu. Almaric konnte nicht verstehen, wie der König einem seiner treuesten Vasallen so minderwertiges Land gegeben hatte. Balian hingegen strahlte Ruhe und Zuversicht aus – nein, er war personifizierte Ruhe und Zuversicht, als er sagte:
„Sie werden zu mir passen!“
Balian und seine Leute entledigten sich ihrer Rüstungen und schlüpften in leichtere, luftige Kleidung; dann erkundete der neue Herr zu Fuß das Dorf. Almaric konnte dem schnell und zielsicher vorangehenden Baron kaum folgen.
„Mylord, Ihr habt tausend Morgen Land. Hier leben an die hundert Familien. Es gibt Christen, Juden, Moslems. Ihr habt fünfzig Ochsengespanne“, erklärte der Hauptmann das Anwesen. „Dies ist ein armseliger und staubiger Ort“, setzte er bedauernd hinzu. Balian blieb unter einer halbverdorrten Palme stehen und scharrte leicht mit einem Fuß in dem staubtrockenen Boden. Er hatte Almaric zugehört, auch wenn es dem Hauptmann zunächst nicht so schien. Als er sich umdrehte, hatte Balian ein Lächeln im Gesicht, wie Almaric es noch nie gesehen hatte: Gleichzeitig glücklich und sehr besorgt.
„Was wir nicht haben … ist – Wasser!“, sagte er schlicht. Almaric nickte anerkennend. Der junge Herr hatte tatsächlich mit einem Blick erkannt, woran es Ibelin am meisten mangelte. Almarics Hochachtung vor seinem neuen Herrn wuchs. Jetzt war nur noch die Frage, wie er auf diesen Mangel reagieren würde …
Er bekam die Antwort sehr schnell. Schon wenig später erfüllte geschäftiges Treiben das eben noch verschlafene Dorf. Männer mit Hacken und Schaufeln gruben an verschiedenen Stellen des Dorfes nebeneinander. Balian lief zwischen den Grabungsorten hin und her und munterte die Leute auf:
„Kommt schon!“, rief er ein ums andere Mal. Nachdem er sich erneut in Erinnerung an seinen Vater mit einer Orange aus eigener Ernte etwas gestärkt hatte, griff er selbst zur Hacke und packte mit an. Der Baron hackte in einer der staubigsten Gruben ebenso hart – wenn nicht gar härter als alle anderen. Sein fleißiges Mittun, seine Kraft und die Tatsache, dass er sich als der neue Herr für solche schmutzigen Arbeiten nicht zu schade war, brachte ihm schon am ersten Tag in Ibelin Wertschätzung und Zuneigung der Dorfbewohner und den Respekt seiner Männer ein.
Das Beispiel des Barons lockte auch den skeptischsten Dörfler hinaus und motivierte jeden einzelnen, bei der Suche nach Wasser zu helfen. Die Grube, in der Balian wie besessen schuftete, war schon mannstief, als ein Junge, vielleicht elf oder zwölf Jahre alt, hineinsprang, ihn antippte. Balian drehte sich um und der Junge bedeutete ihm, dass es Zeit für ihn war, eine Pause zu machen und etwas zu trinken. Er nahm das Tuch ab, das er sich zum Schutz gegen den Staub vor Mund und Nase gebunden hatte und kletterte aus der Grube. Durstig trank er Wasser aus dem ledernen Schlauch, den der Junge ihm gegeben hatte, und sah sich um. An einigen Stellen wurde fleißig gegraben. Staub stieg auf und erfüllte die Luft. Aber überall war neue Zuversicht entstanden, in den von den Anstrengungen gezeichneten Gesichtern stand auch Hoffnung, die Balian einfach glücklich machte.
In seiner Eigenschaft als Baron dieses Lehens hatte er als erste Amtshandlung den Menschen von Ibelin Hoffnung geben können. Einen besseren Anfang hatte er sich nicht wünschen können. Hier, unter den einfachen Menschen und im Kreis der Männer, die ihm Treue geschworen hatten, fühlte er sich zum ersten Mal seit langer Zeit wohl – und er fühlte sich hier zu Hause, obwohl er gerade den ersten Tag hier war. Hier konnte er tun, was er für richtig hielt und was für die Leute, die hier lebten, am besten war. Balian kannte das Leben unter Herren – und er wollte anders sein als jene Herren, die er gekannt hatte, die ihre Dörfler nur geknechtet hatten. Es war sein Wunsch, dass die Menschen, die hier ihr Zuhause hatten, gern hier lebten und gern hierher zurückkehrten, wenn sie zeitweilig abwesend sein mussten. Ibelin sollte ein Ort der Geborgenheit für alle sein, die es Heimstatt nannten.
Wo gegraben wurde, war Balian nicht weit. Verlangte etwas die Entscheidung des Barons, lief einer der Jungen des Dorfes sofort los und alarmierte ihn mit lauten
„Sidi! Sidi!“– Rufen. Die Kinder wussten jedenfalls immer, wo sich der freundliche Baron gerade aufhielt. Für jedes hatte der sonst so schweigsame Balian ein gutes Wort übrig, nahm auch schon mal ein weinendes Kind in den Arm, um es zu trösten. Manche Mutter brauchte nur ein anderes Kind zu fragen, wo Balian gerade war, wenn sie eines ihrer eigenen Kinder vermisste – mit größter Wahrscheinlichkeit war es dort.
Der junge Sergeant Michel grub in dem tiefsten Loch, das nicht weit vom Herrenhaus entstanden war, als der Sand sich plötzlich feucht anfühlte. Die Jungen, die am Rand standen, bekamen große Augen, als er pappigen Sand in den großen Händen rieb. Der Schatz von Ibelin war gefunden! Michel winkte den Läufer fort, der auch sofort losrannte. Almarics Stellvertreter spornte ihn noch mit einem arabischen Zuruf an. Zielsicher fand der Junge zu Balian, der an einem anderen Loch gerade schaute, was dort zu tun war. Der Junge zupfte Balian am verdreckten, roten Leinenhemd, das lose über die ebenfalls verdreckte Hose fiel.
„Sidi! Jallah!“, rief er und winkte ihm hektisch. Almaric, der am benachbarten Loch die Arbeit überwachte, sah verblüfft, dass sein Herr seine Hacke in einen Sandhaufen schlug und dem Läufer eilig folgte.
Die Tage des eifrigen Grabens hatten ausgereicht, um den jungen Franzosen so viel Arabisch lernen zu lassen, dass er ohne weiteres verstand, was der Junge ihm sagte. Arabisch war die allgemeine Umgangssprache in Ibelin, auch die Männer Balians verständigten sich untereinander meist auf Arabisch, so dass es zum einen eine absolute Notwendigkeit war, dass Balian ebenfalls diese Sprache beherrschte. Zum anderen wollte er sich in die bestehende Gemeinschaft einfügen und nicht anderen sagen, wie sie sich zu verständigen hatten. Auch wollte er nicht lange ein Fremder sein – und das bedingte, die Landessprache zu können. Er folgte dem Jungen zu Michels Grube.
Die Leute, die sich darum versammelt hatten, machten dem Baron unaufgefordert Platz. Balian sah Michel grinsen, der inzwischen bis zu den Knien in schlammigem Wasser stand. Sie hatten es geschafft! Balians Lächeln war strahlendes Glück.
„Gut!“, lobte er. „Verstärkt die Wände mit Steinen!“, wies er dann die Leute an, die sich auch gleich daran machten. Sein scherzhaft hinzugefügtes „Jallah! Jallah!“ war nicht nötig. Ibelin hatte endlich eine eigene Quelle und musste nicht länger auf den viel zu seltenen Regen warten.
In den nächsten Tagen fällten die Ibeliner Palmen – Bäume, die ohnehin fast vertrocknet waren – höhlten sie aus und bauten daraus mit vereinten Kräften eine Wasserleitung. Das Wasser aus der neuen Quelle hatten sie zunächst in Handarbeit aufgestaut. Jetzt kam die Probe aufs Exempel, ob die Wasserleitungen funktionierten. Balian ließ mit einem
„Efta! Efta!“, den Schieber öffnen – und das Wasser floss in die vorbereiteten Rinnen, durch die es zu den Feldern geleitet wurde. Die Kinder nutzten die Gelegenheit des fließenden Wassers gleich aus, um die unter Baron Balians Anleitung gebauten kleinen Holzschiffchen schwimmen zu lassen. Jauchzend rannten die Kinder und verfolgten die Schiffchen auf ihrem Weg durch die Rinnen. Die Erwachsenen sahen – völlig verdreckt, aber glücklich – den Erfolg ihrer harten Arbeit und freuten sich sowohl daran als auch an dem Glück der Kinder, die schon lange nicht mehr so ausgelassen gewesen waren.
Kapitel 25
Hausgäste
Balian und die Dorfbewohner arbeiteten fleißig weiter an der Wasserversorgung des Dorfes. Am Brunnen fehlte jetzt nur noch eine bessere Fördermöglichkeit, an der Balian bereits werkelte. Nach dem Prinzip der Wassermühle hatte er eine Förderanlage konstruiert, zu der nur noch das Antriebsrad fehlte, das von Eseln angetrieben werden sollte und ohne weitere Handarbeit Wasser aus der Quelle in die Rinnen fördern sollte. Das Gerüst erforderte die Mithilfe von zehn oder zwölf Männern, die an den Seilen und Trägern hantierten und sich mit dem widerspenstigen, schweren Teil abmühten, als auf der Pilgerstraße in Richtung Jerusalem plötzlich eine große Truppe unter dem Banner von Jerusalem auftauchte.
Einer der Jungen sah die Reiter kommen und eilte zu Balian an das werdende Gerüst, um ihm Bescheid zu sagen. Balian überließ das Seil, mit dem er das neue Rad in die gedachte Richtung dirigierte, einem seiner Männer, folgte dem Jungen und sah zu seiner Verblüffung, dass Prinzessin Sibylla mit großer Begleitung gekommen war. Sie nahm den schützenden Schleier vor dem Gesicht ab und lächelte Balian auf eine Art an, die geradezu verführerisch war – und ziemlich unverschämt …
„Ich bin auf dem Weg nach Kanaan“, sagte sie. „Dort hat Jesus Wasser in Wein verwandelt – aber ein größeres Wunder wäre es, Euch in einen Edelmann zu verwandeln“, spottete sie angesichts des völlig verdreckten Barons in schmutziger Arbeitskleidung. Balian lächelte gewinnend, kraulte ihr Pferd sanft an den Nüstern.
„Das ist gar nicht so schwer. In Frankreich wird man mit ein paar Ellen* Seide zum Edelmann“, konterte er schlagfertig. Sibylla lachte hell. Sein Humor und seine Fähigkeit, über sich selbst lachen zu können, beeindruckte sie ebenso wie sein unkompliziertes, freundliches Wesen und die Tatsache, dass er Menschen nicht nach ihrer Stellung behandelte.
„Ich erwarte Eure Gastfreundschaft“, sagte sie. Balian, inzwischen daran gewöhnt, dass sie nicht um etwas bat, sondern erwartete, lächelte noch breiter. Zum einen war es nicht nur im Orient üblich, Reisenden Unterkunft zu geben, wenn man den entsprechenden Platz und die Bewirtungsmöglichkeit dazu hatte – und Balian hatte beides. Zum anderen: Wenn er die Chance haben wollte, Sibylla in privatem Rahmen, weit vom Jerusalemer Hof entfernt, kennen zu lernen und zu erfahren, ob ihr privates Gesicht tatsächlich anders war als ihr öffentliches Gesicht, war dies die beste Gelegenheit …
„Sie ist gewährt“, erwiderte er mit einer einladenden Handbewegung. „Latif!“, rief er dann.
Sibylla und ihre Begleiter ritten wieder an. Balian ging der Begleitung der Prinzessin aus dem Weg, als Latif nach noch einer eiligen, tiefen Verbeugung zum Herrenhaus voraus rannte. Der Baron sah ihr einen Moment nach, dann arbeiteten er und die Dörfler weiter an dem neuen Wasserrad. Das Wasser aus der neuen Quelle netzte die vertrockneten Felder und gab berechtigte Hoffnung auf eine Ernte, die nicht nur aus Staub bestand.
Latif, der schon früher Besuche des Königshauses auf Ibelin empfangen hatte, war klar, dass die Prinzessin die Herrenwohnung neben dem Torturm beanspruchen würde. Balians Sachen wurden eilig in die Gemächer im oberen Stockwerk gebracht, damit die Gäste sich einrichten konnten. Das Speisezimmer in der Herrenwohnung wurde rasch zum Bad umgestaltet, der Wohnraum gleichzeitig für die Bedürfnisse der Prinzessin auch zum Schlafgemach umgestaltet.
Hinter dem zugezogenen Vorhang des Speisebereichs badete sie genüsslich und wusch sich den Staub der Reise vom Körper. Sie hatte ihre Wanne so stellen lassen, dass sie durch die luftigen Holzschnitzereien in den Fensterläden und Türen hinaussehen konnte. Interessiert beobachtete sie den fleißigen Balian, der überall dort zu finden war, wo es die meiste Arbeit gab. Aber auch er warf immer wieder einen interessierten Blick auf das Herrenhaus, wo sich die Gäste gerade einrichteten. Er schien einfach alles zu können, so erschien es ihr, er packte hart zu und scheute sich nicht, sich schmutzig zu machen. Noch nie – das hätte sie beschworen – hatte sie einen Adligen körperlich so hart arbeiten sehen. Balian von Ibelin war sechs Fuß personifizierter Fleiß …
In der Abenddämmerung kehrten die Ibeliner müde, verdreckt, aber glücklich in ihre Häuser zurück. Balian, Almaric und Michel kamen mit einigen Frauen und Kindern durch das Tor der Herrenhausanlage; Balian, der noch nichts davon wusste, dass die Prinzessin seine Wohnung schier beschlagnahmt hatte, ging nach links in das eigentliche Herrenhaus, Almaric und Michel mit den Frauen und Kindern nach rechts in die Wohnungen der beiden führenden Soldaten Ibelins und ihrer Familien.
Als der Baron sein Haus betrat, bückte sich eine von Sibyllas Dienerinnen, um ihm die Schuhe aufzuschnüren, aber er nahm die junge Frau bei der Hand und zog sie wieder hoch, bedeutete ihr mit sanfter Abwehr, dass sie das unterlassen sollte. Dann lotste Samira, Sibyllas Leibdienerin, ihn gleich auf seine Terrasse und schloss zu seiner Verblüffung die Terrassentür hinter ihm. Verwirrt sah er sich um und entdeckte eine Schüssel mit Wasser, in dem Rosenblüten schwammen. Auf dem kleinen Tisch daneben standen zwei große Flakons mit kostbaren Essenzen, frische Leintücher lagen dabei. ihm wurde klar, dass er sich wohl besser waschen sollte, bevor er sich zum Essen setzte. Ein verlegenes Lächeln breitete sich auf seinem dreckverschmierten Gesicht aus.
Im selben Moment öffnete sich die zweite Tür der Terrasse, die zum Speisezimmer der Herrengemächer führte und eine sanft lächelnde Sibylla trat auf die Terrasse. Sie trug ein strahlend weißes, fließendes Gewand aus plissiertem, weichem Musselin, ihr langes, dunkles Haar war offen, aber zwei dickere Strähnen waren am Hinterkopf zusammengesteckt und hielten ihr Gesicht frei. Er spürte Unsicherheit aufsteigen. Er war komplett verdreckt und verschwitzt, und nun stand auch noch die Prinzessin neben ihm …
Sie nahm mit einem Lächeln seine Hand und zog ihn sanft, aber bestimmt auf den Sitz bei der Wasserschüssel, tauchte ein frisches Leintuch in das parfümierte Wasser und begann, ihm den Dreck aus dem Gesicht zu waschen.
Erschrocken nahm er ihr Handgelenk, um sie an diesem einer Prinzessin unwürdigen Dienst zu hindern, doch sie schüttelte den Kopf.
„Das ist nicht unkeusch. Ich wasche Euch“, stellte sie mit einem eindringlichen Blick klar.
„Und selbst, wenn es unkeusch wäre – was es nicht ist – diese Gebote gelten nicht für Menschen wie uns. Sie wurden für andere geschaffen“, sagte sie dann. Balian sah sie mit zweifelndem Blick an. Was die Gebote betraf, hatte er eine völlig andere Auffassung, aber er gab mit einem Seufzen auf und ließ sie tun, was sie tun wollte. Doch seine Nervosität blieb. Er wusste nicht wohin mit seinen Blicken, die immer wieder von der schönen Frau vor ihm wie magisch angezogen wurden, auch wenn er sich verzweifelt bemühte, ihrem Blick auszuweichen. Dass ihre Berührung schön war und etwas auslöste, was er in der Nähe seines verheirateten Gastes lieber nicht aufkommen lassen wollte, verursachte ihm Unbehagen.
„Hat man Euch zu essen gegeben?“, fragte er, wie um das Thema zu wechseln. Sie grinste.
„Nein, ich sagte, man solle warten, bis der Herr zurückgekehrt ist.“
Er lächelte verlegen. An diese Titulatur hatte er sich noch immer nicht gewöhnt.
„Mein Koch wird etwas zubereiten, während Ihr Euch wascht“, setzte sie hinzu, legte das Leintuch weg und erhob sich. Ergeben nahm er das Waschtuch selbst in die Hand, um sich schon mal oberflächlich zu bereinigen.
Als Sibylla verschwunden war, erschien Latif und gab Balian zu verstehen, dass er ihn, den Hausherrn, wegen des königlichen Besuchs in das Obergeschoss verlegt hatte. Balian nahm es nickend zur Kenntnis. Die Prinzessin war sein Gast und Gästen gab man die besten Räume, die man hatte. Er war mit dem Fingerspitzengefühl seines Haushofmeisters in diesen Dingen durchaus einverstanden.
Später kam der junge Baron frisch gebadet und gekleidet auf die Dachterrasse vor der kleineren Wohnung im Obergeschoss, wo der hohe Gast auf den Hausherrn wartete. Sibyllas Koch hatte ein Mahl aus Früchten, Brot und gebratenem Lammfleisch in appetitlichen Häppchen für seine Herrin und ihren Gastgeber bereitet; Wein, Wasser und Tee standen ebenfalls bereit. Beide griffen zu und ließen sich ein leckeres Mahl schmecken.
Sie aß mit besonderem Genuss, das war der jungen Frau anzusehen. Weltvergessen schleckte sie sich die Finger ab. Dann bemerkte sie Balians amüsierten Blick, der auf ihr ruhte und zuckte hoch. Er war bereits gesättigt und trank noch von dem schmackhaften Früchtetee, während er sie beobachtete. Seine Anspannung hatte sich wieder gelöst, er fühlte sich in ihrer Gegenwart wirklich wohl.
„Was?“, fragte sie mit einem fast schüchternen Lächeln. Er erwiderte ihr Lächeln sanft und freundlich. Seine hübschen, braunen Augen strahlten sie glücklich an.
„Es scheint Jahre her zu sein, dass ich eine Frau essen sah“, erwiderte er. In der Tat erschien ihm sein früheres Leben weiter entfernt zu sein als der Mond. Ibelin schien ihm schon so vertraut, als wäre er hier schon immer gewesen. Er liebte diesen Flecken Erde – und es war sein Flecken Erde …
„Wirklich?“, fragte sie, immer noch schüchtern lächelnd. So, wie sie jetzt war, so gefiel sie ihm – sanft, leise, zurückhaltend. In der Tat war ihr privates Gesicht ganz anders als das, was sie der Welt sonst zeigte. Ihre Nähe tat gut, und er erlaubte sich, sich über ihren Besuch zu freuen.
„Ich … habe Euch heute beobachtet …“, fuhr sie zögernd fort. „Man hat Euch eine Handvoll Staub gegeben – und wie es scheint, habt Ihr vor, ein neues Jerusalem zu bauen.“
Es erschien ihr unglaublich, was er mit den Dörflern in der kurzen Zeit aus dem wohl minderwertigsten Lehen gemacht hatte, das es im Königreich Jerusalem überhaupt gab. Godfrey hatte es einst nicht wegen der Einkünfte erhalten, die es vielleicht im Wege der Abgaben und der Fronleistungen der Bauern abwerfen konnte; Godfreys Aufgabe war allein der Schutz der Pilgerstraße gewesen, wenn er in Ibelin war. Andererseits war Ibelin aber auch immer schon eben jene bessere Welt gewesen, von der Godfrey und Tiberias geträumt hatten, wenn es um das Zusammenleben von Christen, Juden und Moslems ging. Balian führte diese Tradition seines Vaters offensichtlich weiter.
Sein Lächeln wurde noch schöner, strahlender, als er über sein Land sah, um dann mit dem Blick wieder zu ihr zurückzukehren.
„Es ist mein Land“, sagte er ebenso freundlich wie völlig zufrieden. Er war ganz genau dort, wo er hingehörte.
„Wer wäre ich, wenn ich nicht versuchen würde, es zu verbessern?“, fragte er dann, den von seinem Ziehvater ererbten Wahlspruch zitierend. Sibylla sah ihn schweigend an und wurde sich bewusst, dass sie bei einem Mann zu Gast war, der mit seinem Leben zufrieden und glücklich war, wie es jetzt war. Aber er war nicht nur glücklich und zufrieden, er ließ sie an seinem Glück und seiner Zufriedenheit teilhaben. Die Prinzessin wünschte sich im Moment nichts mehr, als hier in Ibelin eine Weile Ruhe zu finden vor den chronischen Intrigen am Jerusalemer Hof, insbesondere den Intrigen ihres Mannes, etwas Abstand zu dem schrecklichen Leiden ihres Bruders zu bekommen – und diesen Mann, den neuen Herrn von Ibelin, näher kennen zu lernen. Seine Furchtlosigkeit in der Konfrontation mit ihrem Gemahl Guy hatte sie sehr beeindruckt. Sie bereute keinen Augenblick, nach Ibelin gekommen zu sein, um Balian außerhalb der gezwungenen Hofatmosphäre zu sehen. Sie stellte mit Zufriedenheit fest, dass er völlig verdreckt und verschwitzt auch nicht schlechter aussah als jetzt, wo er sauber gewaschen und elegant gekleidet ihr gegenüber auf dem Diwan saß. Es drängte sie, ihn wieder zu berühren, doch sie hielt sich zurück, wollte sie ihn doch nicht so überfallen …
Balian stand für gewöhnlich sehr früh auf – meist schon mit dem ersten Ruf des Muezzins, der die Moslems seines Dorfes im ersten Tageslicht zum ersten von fünf täglichen Gebeten rief. Auch an diesem Morgen einige Tage nach der Ankunft der Prinzessin sah er den Muslimen bei der Verrichtung ihres Morgengebetes am Rand der Felder neben dem Herrenhaus zu, während er sich mit einer Schüssel Wasser wusch, den Bart zurechtstutzte und sich auf seine Tagesarbeit vorbereitete.
Sibylla hatte den Ruf des Muezzins ebenfalls gehört, hatte hinausgespäht und den Hausherrn mit einer Schüssel Wasser über den Hof gehen sehen und war ihm leise in den ersten Stock gefolgt, wo er wohnte, solange sie und ihr Hofstaat in Ibelin zu Gast waren. Sie fand ihn bereits draußen auf der Dachterrasse des Herrenhauses, wo er seine Morgentoilette machte. Leise begab sie sich ebenfalls hinaus, nahm einem Diener das Tablett ab, auf dem das Frühstück für den Baron stand, schickte den Diener wieder fort und bereitete dem Hausherrn selbst die erste Mahlzeit aus Früchten, Brot und Tee, das sie auf einem kleinen Intarsientisch unter dem halb aufgespannten Sonnensegel ausbreitete. Der Anblick Balians, der nur eine schwarze Hose trug und die ansehnlichen Proportionen seines von harter Arbeit gestählten, nackten Oberkörpers präsentierte, ließ es der Prinzessin heiß und kalt werden. In diesen Armen zu liegen … Allein der Gedanke ließ sie erröten.
Er trocknete sich den Rest der Feuchtigkeit von der Haut, als die Muslime im Gebet die Erde mit der Stirn berührten und Gottes Größe mit
„Allahu akbar!“, priesen.
„Sie versuchen eins zu sein: Ein Herz, eine Moral“, hörte er Sibyllas Stimme hinter sich. Er drehte sich um, stellte seine Waschschüssel fort und sah sie unter dem Baldachin an dem kleinen Tisch stehen, wo sie Tee in Gläser einschenkte. Für einen Moment dachte Balian an einen Sommermorgen vor – wie es ihm schien – unendlich langer Zeit in Saint-Martin-au-Bois, dem kleinen Dorf bei Chartres, als er und Natalie gerade ein paar Wochen verheiratet gewesen waren und Natalie nach einer wundervollen Nacht morgens ein Frühstück im Obstgarten hinter der Schmiede hergerichtet hatte. Sibylla sah ihn lächelnd an. Balian nickte ihr zu, kam unter den Baldachin und zog sich sein dunkelgraues Arbeitshemd über. Mit einem weiteren Nicken bedankte er sich bei ihr für den gereichten Tee.
„Ihr Prophet sagt: Unterwerfe dich! Jesus sagt: Entscheide dich!“, fuhr sie in der Erklärung der unterschiedlichen Auffassungen der christlichen und der islamischen Lehre fort. Doch in diesen Worten lag noch mehr: ihre eigene Entscheidung. Sie hatte sich an diesem Morgen endgültig in Balian verliebt und sich für ihn entschieden …
Er wies mit dem Kinn in Richtung Jerusalem, als er den ersten Schluck Tee nahm.
„Habt Ihr Euch für Guy entschieden?“, nutzte er ihre Erklärung für eine Frage, die ihm schon seit dem Königsmahl in Jerusalem durch den Kopf ging. Dass sie gerade ihn gemeint haben könnte, kam ihm nicht in den Sinn. Sie sah ihn an. Es war ehrliches, sympathisches Interesse, ohne jede Neugier, das spürte sie. Sie biss sich auf die Lippe. Bemerkte er nicht, was sie ihm hatte sagen wollen? Musste er sie ausgerechnet jetzt an diesen Klotz am Bein erinnern? Sie hatte endlich einmal nicht beständig an ihren ungeliebten Gatten denken wollen. Sie schüttelte leicht den Kopf.
„Guy war die Wahl meiner Mutter“, seufzte sie. „Mein erster Gemahl starb, bevor unser Sohn geboren wurde. Ich war erst fünfzehn.“
Er lächelte sanft und trank einen Schluck von dem Tee.
„Ich traf Euren Sohn“, sagte er. Sein Lächeln intensivierte sich, da ihm in diesem Moment bewusst wurde, über wessen Spielzeug er im Palast gestolpert war. Sie sah ihn verblüfft an, von einer solchen Begegnung wusste sie nichts. Balian verspürte den Wunsch, sie tröstend in den Arm zu nehmen, so hilflos und verletzlich wirkte sie im Augenblick, so einsam und verlassen. Er kannte dieses furchtbare Gefühl – und er wünschte es niemandem. Dennoch versagte er sich die Freiheit, um sie nicht zu erschrecken und um sie nicht glauben zu machen, er begehre sie wegen ihrer Stellung.
Nach dem Frühstück inspizierte der junge Mann die Felder und überzeugte sich von den guten Fortschritten, die die Landwirtschaft von Ibelin mit der neuen Wasserleitung machte. In einem der künstlichen Wasserläufe fand er eins von den Spielzeugschiffen. Es war gekentert und halb vom Schlamm vergraben. Dass er mit den Kindern diese kleinen Schiffe gebaut hatte, war nicht reiner Spieltrieb des jungen Barons, sie erfüllten durchaus einen ernsthaften Zweck, wenngleich damit viel Spaß für die Kinder verbunden war. Diese kleinen Schiffe folgten dem fließenden Wasser. So konnte der Weg des Wassers besser verfolgt werden. Balian barg das kleine Schiff, spülte es kurz ab und ließ es dann wieder in dem fließenden Wasser fahren. Er folgte dem Minisegler, kreuzte dabei immer wieder einmal den Kanal. Das Schifflein fuhr ordentlich in der Mitte der Rinne und präsentierte dem erfinderischen Baron, dass er sich mit dem Gefälle nicht verschätzt hatte. Ja, es lief buchstäblich so, wie er es geplant hatte.
Mit einem zufriedenen Lächeln sah er sich um. Sein Blick streifte die Dörfler, die ihm freundlich und dankbar zunickten. Auf allen Feldern wurde gearbeitet, das Wasser in den Boden eingearbeitet, wo es nicht freiwillig versickern wollte. Die Dämme erfüllten ebenso ihren Zweck und stauten das Wasser oder hielten es fern, wo es im Moment unerwünscht war. An jedem Feld konnte der Zufluss aus der Rinne mit einem Holzbrettchen reguliert werden. Balians Blick traf eine Karawane, die von der Karawanserei an der Pilgerstraße kam und durch Ibelin selbst in Richtung Gaza weiterzog. Sorgsam mieden die Kameltreiber die frisch bewässerten Felder und lenkten ihre Lasttiere auf den trockenen Dämmen. Der Baron schmunzelte. Als er hergekommen war, waren die Karawanen rücksichtslos über die Felder getrampelt, hatten die karge Saat auch noch zerstört. Das war jetzt vorbei. Ibelin würde in wenigen Tagen grün sein, wenn die ersten Saaten aufgingen. Balian freute sich darauf.
Er war den ganzen Tag unterwegs, mied das Herrenhaus, soweit es ging, um seinen königlichen Gast nicht zu weiteren Vertraulichkeiten zu ermutigen. Er hatte seine Überraschung über ihre Anwesenheit auf der Dachterrasse am Morgen nur schwer verbergen können. Es war nicht gut, dass er mit ihr buchstäblich unter einem Dach lebte. Sie war verheiratet, und es gehörte sich einfach nicht, dass er ihr so nahe war – zumal die Diener über Tag nur im Herrenhaus waren, wenn sie dort zu tun hatten, während sich in der Nacht außer ihm und Sibylla wirklich niemand im Herrenhaus aufhielt. Nein, er musste sich etwas einfallen lassen, um sie nicht zu kompromittieren …
Sibylla verbrachte den Tag unter dem Sonnensegel auf der Terrasse, etwas enttäuscht, dass Balian nicht so reagiert hatte, wie sie gehofft hatte. Ihre Leibdienerin erneuerte die Hennaverzierungen auf den schmalen Händen ihrer Herrin, während diese Balian beobachtete. Ihr interessierter Blick fand ihn bald hier im Gespräch mit einem Bauern, dann wieder am Wasserrad, dann bei den jungen Pflanzen, die die ersten grünen Spuren auf den ehedem staubgrauen Feldern Ibelins zeigten.
Kapitel 26
Das Licht der Liebe
Weitere Tage waren vergangen. Sibylla war inzwischen gut zwei Wochen Balians Gast. Er hatte das eigentliche Herrenhaus ganz räumen wollen und in das Obergeschoss des Stalles an der Südseite der großen Anlage neben der inneren Burg ziehen wollen. Es erschien ihm besser, sich auch räumlich deutlich von der verheirateten Frau fernzuhalten, nicht nur durch ein Stockwerk getrennt.
Doch Sibylla hatte nichts davon wissen wollen, dass er sein Heim räumte und hatte darauf bestanden, dass er im Herrenhaus blieb. Sie wollte nach einigen Tagen auch nicht mehr, dass er bescheiden die obere Wohnung an der Dachterrasse belegte, und ihr die eigentliche Herrenwohnung im Erdgeschoss überließ. Es wunderte sie selbst, dass sie, die königliche Prinzessin, bereit war, die ihr eingeräumte Ehre nicht anzunehmen und dem Hausherrn die guten Räume wieder zurückzugeben.
Die Lösung war pragmatisch, zumal die kleinere Wohnung im Obergeschoss einen eigenen Zugang über den Arkadengang durch das Treppenhaus neben dem neuen Arbeitszimmer hatte. Der Arbeitsbereich des verstorbenen Barons Godfrey hatte in der kleineren Wohnung im Obergeschoss gelegen, wo sich auch sein Schlafgemach befunden hatte. Beide Räume waren nun durch Sibylla und ihre Dienerinnen belegt. So hatte Balian den Wohnbereich der Herrenwohnung zum Schlafraum umgestaltet, um auch das breite Bett unterzubringen, der Speiseraum war nun sein Wohnraum und den ursprünglich als Anrichteraum neben dem Speisebereich dienenden Raum hatte er zu seinem Arbeitszimmer umfunktioniert, in dem er ungestört war. Allerdings hatte sein jetziges Arbeitszimmer auch einen Zugang zum Treppenhaus. Um sicher zu gehen, dass er nicht in Versuchung geraten konnte, sie zu kompromittieren, hatte er die Tür von seinem Arbeitszimmer zum Treppenhaus abgeschlossen und den Schlüssel Sibyllas Leibdienerin Samira gegeben.
Sibyllas Verzicht enthob Balian zwar der Notwendigkeit, die über dem Stall an der Südseite der Herrenhausanlage gelegene, leer stehende Wohnung bewohnbar zu machen, aber es war nicht einfach für ihn, mit Sibylla unter einem Dach zu leben. Ihre Nähe machte ihm die Zurückhaltung allmählich schwer …
Die Mittagshitze lastete schwer auf Ibelin. Balian hatte sich in das gefangene Arbeitszimmer des Herrenhauses zurückgezogen, das kein Fenster hatte und deshalb kühler war, als die übrigen Gemächer. Doch auf den stets mehr oder weniger leicht wehenden Wind wollte er nicht ganz verzichten. Die Arkadentüren zum Innenhof und zur Terrasse standen offen, waren aber durch Vorhänge abgeschirmt und ließen zwar die Luft herein, nicht jedoch die direkte Hitze der Mittagssonne. Balian hatte nach der Vormittagsarbeit gebadet und saß nun sauber gekleidet schweigsam im Arbeitsbereich seines Hauses. Draußen zirpten die Zikaden, drinnen suchte sich ein neugieriges Mäuschen den Weg über Balians ausgezogene, leichte Schuhe.
Der junge Baron hatte einige Bogen Papier vor sich – etwas, das man in Europa noch nicht recht kannte, weil diese fernöstliche Erfindung von Schreibmaterial noch nicht bis dorthin gedrungen war. Sein Vater war dem Erfindungsgeist und der Klugheit der muslimischen Herren dieses Landes sehr zugetan gewesen, was sich nicht nur in der Ausstattung seines Arbeitszimmers ausdrückte, sondern auch in den verwendeten Materialien. Mit einem Stück Zeichenkohle skizzierte Balian eine neue Mauerführung der Jerusalemer Stadtmauer. Tiberias hatte ihm die Pläne mitgegeben, als Balian nach Ibelin geritten war und hatte ihm den ergänzenden Auftrag des Königs gegeben, die Mauern nach den Vorstellungen zu verbessern, die er im Gespräch mit dem König dargelegt hatte. Ab und zu trank er einen Schluck von dem Durst löschenden Früchtetee, den einer der Hausdiener bereitet hatte. Seine schlanken Finger führten die Kohle mit sicheren Strichen über das Papier.
Das Geräusch einer klappenden Tür ließ ihn aufsehen. In der Annahme, es sei der Diener, der kam, um ihm nachzuschenken, nahm er sein Teeglas und sah sich um, stellte das Glas aber verblüfft wieder weg, als er im Schein einer Kerze Sibylla durch den Wohnraum kommen sah. Vor der Tür des Arbeitszimmers blieb sie stehen.
„Ich könnte für immer hier bleiben“, sagte sie. Er sah sie einen Moment an.
„Dieses Haus ist das Eure“, erwiderte er freundlich. Sie war jetzt schon zwei Wochen bei ihm; er hatte sich an ihre Anwesenheit gewöhnt, an die Gespräche mit ihr. Je länger sie bei ihm war, desto mehr hoffte er, sie würde noch länger bleiben, auch wenn ihre Anwesenheit ihn zuweilen arg in Versuchung führte.
„Warum, glaubt Ihr, bin ich hier?“, fragte sie. Ihr Tonfall – recht provozierend – überraschte ihn. Er stand auf und ging zur Tür.
„Ich weiß, dass Ibelin nicht auf dem Weg nach Kanaan liegt“, erwiderte er und zog die Augenbrauen leicht hoch. Die Prinzessin durfte gern wissen, dass er ihr das vorgebliche Reiseziel nicht abgenommen hatte. Kanaan lag weit nördlich von Jerusalem, während Ibelin etwa vierzig Meilen westlich der heiligen Stadt lag. Nach Kanaan über Ibelin zu wollen – das ging nur, wenn entweder ihr Turkopolenführer* vom Kartenlesen nichts verstand – oder Sibylla nicht ganz die Wahrheit gesagt hatte, was ihr Reiseziel betraf … Balian nahm eher Letzteres an.
„Und was wisst Ihr sonst noch, Mylord?“, fragte sie weiter. Ein verführerischer Unterton lag in ihrer Stimme. War er denn blind? Bemerkte er nicht, dass er es selbst war, der sie hergetrieben hatte? Balian senkte leicht den Kopf zu ihr, stützte sich in der Türfüllung ab.
„Ich weiß, dass Ihr eine Prinzessin seid – und ich bin kein Fürst“, erwiderte er und hoffte, dass die Prinzessin seine Mahnung erkennen würde. Er hatte sich in den letzten Tagen schon einige Male sehr zusammenreißen müssen, sich daran zu erinnern, dass sie eine verheiratete Frau war. Doch sie sah ihn verblüfft an.
„Ihr seid ein Ritter!“, entfuhr es ihr. Glaubte er das etwa nicht? Musste man ihm das wirklich erst sagen?
„Weder verdientermaßen noch ist es erwiesen“, wehrte er ab. Ja, sein Vater hatte ihn zum Ritter geschlagen; er war der Baron von Ibelin, so hatte man ihm nach dem Ritterschlag gesagt. Was sein Erbe betraf, war Balian noch immer unsicher, ob er die Anforderungen erfüllte, die dieses Erbe an ihn stellte. Und den Ritterschlag hatte er sich nicht verdient. Ein Knappe musste viele Jahre lernen, er musste an Kämpfen mit dem Feind beteiligt gewesen sein, bevor er für würdig befunden wurde, in den Ritterstand erhoben zu werden. Balian hingegen hatte seiner eigenen Meinung nach nichts geleistet, was den Ritterschlag rechtfertigen würde.
Sibylla sah zu Boden. Bescheidenheit, Zurückhaltung, selbstkritische Betrachtung – das alles passte nicht zu den Adligen, die sie kannte. Jene putzten sich wie die Pfauen, stolzierten in Prachtgewändern und ließen jeden spüren, was für unglaublich wichtige Personen sie waren – beinahe zu fein, um das Essen selbst zu kauen … Balian war völlig anders. Dabei hatte er einen so natürlichen Adel, dass der gesamte Hof von Jerusalem vor Neid blass wurde. Seine Erscheinung war einfach nobel. Sibylla hatte zudem feststellen dürfen, dass es im Falle Balian von Ibelin weder eines reinigenden Bades noch der von ihm selbst spöttisch angesprochenen Seide bedurfte, um den Edelmann zum Vorschein zu bringen. Balian war edel, und das bis ins Mark. Warum glaubte er das nur nicht? Langsam hob sich der Blick der Prinzessin wieder. Tief in seinen warmen, braunen Augen sah sie Einsamkeit – die gleiche Einsamkeit, die auch sie selbst quälte.
„Ich … bin nicht hierhergekommen, … weil … weil ich gelang-weilt wäre oder … unkeusch“, sagte sie stockend. „Ich bin hier, weil … weil es … im Osten heißt, dass … zwischen einer Person und einer anderen nur ein Licht ist.“
Noch bevor er ihre mysteriösen Worte ganz verstanden hatte, sah sie ihm direkt in die Augen, blies die Kerze aus, ließ sie einfach fallen und trat nahe zu ihm. Er wich verblüfft zurück, doch der Türrahmen hinderte ihn. Sie kam ihm ganz nahe, legte beide Hände auf seine Brust und streifte mit einer sanften Bewegung den Kaftan von seinen Schultern. Balian gab auf. Es hatte keinen Sinn, vor einer neuen Liebe länger davonzulaufen und dieses kostbare Gastgeschenk abzulehnen, das sie ihm machen wollte …
Er schlüpfte aus dem Obergewand, umarmte sie und zog sie fest an sich, als sich ihre Lippen zu einem Kuss fanden – zunächst vorsichtig, doch dann brach sich bei beiden das viel zu lang aufgestaute Begehren Bahn. Sie küssten sich wild und verlangend. Balian hob Sibylla hoch. Seine starken Arme trugen sie wie eine Feder zu dem breiten Diwan in seinem Wohnzimmer, der nur wenige Schritte vom Arbeitszimmer vor dem Raumteiler am Fenster stand. Sie schob währenddessen sein helles, leinenes Hemd hoch, liebkoste seinen muskulösen, warmen Oberkörper und seufzte lustvoll, als er sie auf dem Diwan ablegte. Sie streifte sein Hemd ganz ab, warf es achtlos fort und zog ihn mit sich herunter. Er folgte ihr, dem Drängen seiner ausgehungerten Männlichkeit genüsslich nachgebend. Zwei hungrige, junge Menschen gaben sich alles, was sie zu geben vermochten.
Als sie Balian tief in sich spürte, mit ihm vor Lust verging, wollte Sibylla nie wieder woanders sein als hier in Ibelin. Sie war endlich dort, wo sie sein wollte. Balian erlebte die Liebe neu, geschenkt aus freiem Willen und vollem Herzen. Nach einem ersten Akt hob er sie vom Diwan hoch, hielt sie fest und drehte sich um, so dass sie auf ihm saß. Wieder versanken sie ineinander. Er strich ihr mit einem zärtlichen Lächeln das Haar aus dem Gesicht und nahm sich viel Zeit, ihr Gesicht, ihre Schultern zu liebkosen und ihr die Zärtlichkeit zu schenken, die sie verdiente.
Sibylla gab ihm ein neues Lebensgefühl; etwas das er nicht erwartet hatte: Sie, die königliche Prinzessin, schenkte sich ihm, einem einfachen Mann, der zufällig Ritter war …
Kapitel 27
Gottes Wille
Während Sibylla und Balian in Ibelin zärtlicher Liebe frönten, galoppierten Guy de Lusignan, Reynald de Châtillon und die Templer unter ihrem Großmeister Gérard de Ridefort in breiter Front über einen der ungezählten Sandhügel der großen Wüste östlich von Jerusalem. In der Ebene unter ihnen zog eine große Karawane nordwärts in Richtung Damaskus.
Die Templer und ihre größten Gönner de Lusignan und de Châtillon sahen es als ihre heilige Verpflichtung an, die Heiden, die sich selbst Muslime nannten, entweder zum rechten Glauben an Jesus Christus, Gottes Sohn, zu bekehren – oder jene zu töten, die sich dem verschlossen, was sie als die wahre Lehre betrachteten. In den letzten Jahren hatten sie nur noch getötet, denn die Araber islamischen Glaubens waren ebenso von der Richtigkeit ihrer Glaubensausübung überzeugt wie diese fanatischen Christen, waren ebenfalls der Ansicht, den richtigen Glauben und die wahre Lehre zu verbreiten.
Guy bemerkte schnell, dass zahlreiche Soldaten die Karawane schützten.
„Diese Karawane ist bewaffnet, Reynald!“, rief er. Reynald grinste, dass sein zweifarbiger Bart sich sträubte.
„Gut! Anderenfalls wäre es langweilig!“, kicherte er. Reynald de Châtillon hatte überhaupt kein Problem damit, Waffenlose anzugreifen … Aber es machte ihm einfach noch mehr Spaß, wenn die Angegriffenen sich auch wehrten und sich nicht nur widerstandslos abschlachten ließen.
Die Templer auf dem Hügel blieben nicht unbemerkt. Einer der Reiter, die an den Flanken der Karawane ritten, stoppte, als er die Reiter auf dem Hügelkamm entdeckte. Nicht weit von ihm war Nasser, der Karawanenhändler. Nasser, durch den Reiter aufmerksam geworden, war klar, dass diese Karawane ebenso hingeschlachtet werden würde wie alle zuvor, die das Pech gehabt hatten, den Templern über den Weg zu laufen. Nasser hatte es zwar abgelehnt, christliche Soldaten als Begleitschutz zu akzeptieren, aber in einem solchen Notfall unmittelbare Hilfe zu erbitten, erschien ihm nicht so beleidigend gegenüber Allah, als sich ständig begleiten zu lassen. Jerusalem war nahe genug, dass ein Bote es vielleicht rechtzeitig erreichen konnte, um Hilfe des Konstablers von Jerusalem zu erbitten. Wenn Tiberias schon Begleitung angeboten hatte, würde er doch eine angegriffene Karawane nicht im Stich lassen … Nasser gab dem Mann einen Wink, er drehte um und jagte in Richtung Jerusalem davon.
„Sie haben uns gesehen“, murmelte Guy, als ihm der in die entgegengesetzte Richtung galoppierende Reiter auffiel. Er winkte einem der Templer. „Verfolgt sie!“, befahl er. „Ein Reiter versucht zu fliehen!“
„Das ist eine große Wüste! Hier wird nichts fliehen, gar nichts!“, widersprach Reynald. Guy sah ihn hochmütig an.
„Ich ziehe es vor, nicht gehängt zu werden, bevor mein Weib Königin ist“, erklärte er seine übergroße Vorsicht.
„Keine Sorge! ‚Wer außer Reynald?’, werden sie sagen! Ich bin es immer! Ich versichere Euch, in Jerusalem glauben sie es. Ihr wart in Nazareth – beten!“, lieferte Reynald Guy das Alibi.
„Ihr seid ein gefährlicher Mann, Reynald!“, grinste de Lusignan anerkennend und zog sein Schwert.
„Wenn es darum geht, wann wir Krieg führen, will ich ihn jetzt!“, versetzte de Châtillon. „Wie lange kann er gegen die Lepra noch kämpfen?“, fragte er dann auf Balduin bezogen. Großmeister de Ridefort zog sein Schwert.
„Gott will es!“, rief er. Der Ruf wurde von den Templern aufgenommen, allein Reynald brüllte:
„Jerusalem!“
Die Templer hatten den Hügelkamm in voller Breite eingenommen und jagten nun den Hügel in breit auseinander gezogener Front hinunter. Sie griffen die Karawane in der linken Flanke an und sprengten sie auseinander. Die Karawanenreisenden flohen vor den heran preschenden Panzerreitern nach rechts, aber sie hatten keine Chance. Nicht nur, dass viele der Kamelführer zu Fuß neben den Lasttieren gingen und schon deshalb nicht schnell genug waren, um den Reitern zu entkommen; die Wucht der Attacke warf sogar Kamele um. Die christlichen Ritter hatten mit ihrer schweren Panzerung von Mensch und Tier ein erheblich höheres Kampfgewicht als die nur leicht gerüsteten sarazenischen Reiter, weshalb in der Regel ein Kräfteverhältnis von zehn Sarazenen zu einem christlichen Ritter erforderlich war, wenn die Sarazenen siegreich bleiben wollten. Aber Nasser hatte keine zehnfache Überzahl an Soldaten zum Schutz seiner Karawane …
Die Templer machten alles nieder, was sich irgendwie bewegte. Aus dem rasenden Galopp heraus spießte einer der Templer einen sarazenischen Fußsoldaten auf. Andere Templer gingen mit eingelegten Lanzen auf die Fliehenden los, als wollten sie im Gestech* gegen einen ebenso gepanzerten und berittenen Gegner antreten, doch die Karawanenreisenden waren weder gepanzert noch waren sie nur ansatzweise ebenbürtige Gegner.
Dennoch gelang es dem einen oder anderen Sarazenen, einen der Templer aus dem Sattel zu reißen; doch die Templer galten nicht umsonst als die Ersten beim Angriff und die Letzten beim Rückzug. Auch zu Fuß war ein Templer durchaus in der Lage zu kämpfen. Einer von ihnen demonstrierte diese Fähigkeit und ging zu Fuß auf zwei Kamelreiter los, die sich nur durch eilige Flucht in die entgegengesetzte Richtung vorläufig dem Schicksal entziehen konnten.
Guy steckte mitten im Getümmel, holte mit dem beidhändig geführten Schwert aus und schlitzte einen der Reisenden glatt auf. Das Blut des Mannes spritzte einen halben Klafter weit und bedeckte seinen Mörder nicht nur auf der Rüstung und dem Wappenrock, sondern auch im Gesicht.
Reynald fand unter den Überfallenen auch den Händler Nasser. Mit dem hatte er noch eine Rechnung offen wegen der Untersuchung, die Tiberias gegen ihn auf Anzeige von Nasser geführt hatte. Reynald nahm Maß, küsste seine Schwertklinge und ließ sie aus dem vollen Galopp auf den unglücklichen Nasser niederfahren, den er regelrecht in zwei Teile spaltete.
Guy nagelte einen der Unglücklichen mit der Lanze an den Boden, ein weiterer Schwall Blut und auch Dreck benetzten ihn, dass vom Weiß des Templerrocks und seiner Haut fast nichts mehr zu sehen war. Und der Blutrausch der Templer wollte kein Ende nehmen, solange auch nur einer der Überfallenen noch lebte. Nicht einer war unter ihnen, der an diesem Tag nicht zum mehrfachen Mörder geworden war.
Kapitel 28
Das Liebesnest
Sibylla erwachte aus den Träumen einer wundervollen Liebesnacht in Balians Schlafgemach, zu dem er seinen eigentlichen Wohnraum umgestaltet hatte. Der Ruf des Muezzins unten vor dem Fenster und die Antwort der moslemischen Bewohner Ibelins hatte sie geweckt. Sie brauchte einen Moment, um sich zu erinnern, wo sie war, obwohl sie wahrlich nicht zum ersten Mal neben Balian von Ibelin erwachte. Seit jenem Abend, an dem sie sich auf dem Diwan im nebenan befindlichen jetzigen Wohnraum zum ersten Mal geliebt hatten, hatten sie jede Nacht gemeinsam in diesem Schlafgemach verbracht – mit zärtlichem Lieben, mit ungeahnter Lust, mit ruhigem Schlaf. In Balians Armen spürte sie eine Geborgenheit, die sie noch nie vorher empfunden hatte. Es war für sie beide einfach selbstverständlich geworden, dass sie sich am Abend gemeinsam hierher zurückzogen und sich einander liebevoll widmeten.
Ihr Blick, der durch den hellen Raum glitt, hakte sich an dem Totentanz fest, den der selige Godfrey im früheren Speisebereich hatte anbringen lassen. Sibylla schauderte jedes Mal, wenn sie diesen Totentanz betrachtete. Zu sehr gemahnte er an das nahe Schicksal ihres geliebten Bruders. Balduin würde bald sterben, das wusste sie. Ihr Sohn Balduin würde den Thron erben. Dass Balian ihr von der Begegnung mit ihrem Sohn mit einem so unendlich freundlichen Lächeln erzählt hatte, dass er ihr Liebe schenkte, die sie bisher nie erfahren hatte, ließ sie hoffen, dass er ihr ein liebevoller Ehemann und ihrem Sohn ein guter Stiefvater sein könnte. Balian ahnte nicht einmal, dass ihr Besuch und ihr verlängerter Aufenthalt nicht nur purer Zufall oder eine Laune Sibyllas war, sondern Teil eines Plans der königlichen Geschwister war. Sie hatte ihn prüfen wollen – und die Prüfung war durchaus zu seinen Gunsten ausgefallen.
Sie sah zu Balian, der entspannt schlafend neben ihr lag. Seit sie die Nächte gemeinsam verbrachten, stand er auch nicht mehr vor dem ersten Hahnenschrei auf, sondern gönnte sich etwas mehr Ruhe und genoss das Leben in diesem kleinen Paradies – was nicht hieß, dass er die harte Arbeit für dieses Paradies nun anderen überließ. Er lag auf der Seite, ihr zugewandt, hatte den rechten Arm unter das Kopfkissen geschoben. Das dünne Laken, das ihnen beiden jeweils als Zudeck diente, bedeckte seinen ansehnlichen Oberkörper nur teilweise, doch reichte es in der Wärme Ibelins vollkommen aus. Die Augen hatte der junge Mann noch geschlossen. Lange, dunkle Wimpern verschönten neben dem sorgfältig gestutzten, kurzen Vollbart sein ebenmäßiges, von der Sonne gebräuntes Gesicht.
Es reizte Sibylla, ihn zärtlich zu streicheln. Doch als sie ihre linke Hand unter dem Laken hochnahm, fiel ihr Blick auf ihre beringten Finger. Keiner der Finger der linken Hand war ohne Ringschmuck. Dabei berührte ihre Hand Balian sacht an der linken Schulter, und er blinzelte noch recht verschlafen auf ihre Hand. In dem frühen Licht wirkten seine braunen Augen fast schwarz, doch es war kein Ärger, der sie so dunkel erscheinen ließ; er war einfach nur gerade aufgewacht …
Ihr rechter Zeigefinger wies auf den Ring, den sie am linken Zeigefinger trug.
„Dieser hier ist aus Frankreich. Ich bin nie dort gewesen“, sagte sie, und es klang bedauernd, wie sie es sagte. Ihr Großvater war Franzose gewesen, ihr Vater Amalrich schon im Heiligen Land geboren wie sie und ihr Bruder auch. Schon Balduin hatte es immer bedauert, das Land seiner Ahnen nie gesehen zu haben – und ihr ging es nicht besser.
„Dieser hier ist von meinem Bruder – damit wir den Tod nicht vergessen“, fuhr sie fort und wies auf den am Mittelfinger der linken Hand befindlichen Ring.
„Und diesen … hab’ ich gekauft, als ich Euch sah“, ergänzte sie und zog den Ring mit einem rechteckigen roten Stein in Goldfassung vom Ringfinger der linken Hand und gab ihn Balian als verspätete kleine Morgengabe. Eigentlich gab der Mann der Frau nach der ersten gemeinsamen Nacht eine solche Gabe – als Entschädigung für die verlorene Jungfräulichkeit. Doch in diesem Fall hatte Sibylla die Initiative ergriffen und mit Balian angebandelt und nicht er mit ihr. Insofern gehörte es sich auch, dass sie ihm dafür etwas gab, weniger als Entschädigung – schließlich war er schon verheiratet gewesen und sie war es jetzt noch – sondern aus Dankbarkeit. Es war ihre Art, sich für die schöne Zeit bei ihm zu bedanken.
„Ihr lügt“, erwiderte er neckend mit einem verschmitzten Grinsen und fröhlichem Blitzen in seinen hübschen, braunen Augen. Er spürte unbändiges Glück, sie schon morgens neben sich liegen zu sehen. Ganz vorsichtig nahm er den kostbaren Ring aus ihrer Hand.
Sibylla stand auf, wickelte sich in die seidene Überdecke und ging barfuß zu einem kleinen Tisch, auf dem neben aufgeschnittenen Granatäpfeln und frisch gepflückten Orangen in einem Schälchen die Kerne eines weiteren Granatapfels lagen. Granatäpfel waren in Palästina heimische Früchte, die nicht nur vielseitig verwendbar waren – aus der ganzen Frucht ließ sich eine tiefschwarze Tinte herstellen, die Schale diente zum Färben der Wolle in Gelb-, tiefen Blau- und Schwarztönen für im Orient hergestellte Teppiche, die Kerne waren schmackhaft und gesund, aus dem Fleisch ließ sich roter Saft gewinnen, der in der Küche gut zu Wildfleisch und Geflügel passte – sie waren auch eng mit der Symbolik verknüpft.
In der christlichen Symbolik stellten sie die Gemeinschaft der Glaubenden in der Kirche selbst dar, waren aber auch ein Gleichnis für den Priesterstand. Im letzteren Fall stellte die harte Schale die priesterliche Askese dar, die unzähligen Kerne, die sich in jeder Frucht fanden, die reiche Frucht, die das Priestertum haben sollte. Weiter im Osten, in Cathay*, verband man den Granatapfel allerdings mit der Fruchtbarkeit der Frau, zuweilen auch mit der Kraft des Mannes und damit mit reichem Kindersegen …
Sibylla, die um die Symbolik dieser Frucht sehr wohl wusste, hatte sie eher wegen der fernöstlichen Betrachtungsweise in dem mit Balian geteilten Schlafgemach. Granatapfelkerne nach einer Liebesnacht zu essen machte Lust auf mehr am Morgen. Und von Balian konnte sie gar nicht genug bekommen … Ganz abgesehen davon, dass sie auch gut schmeckten und den ersten Hunger am Morgen etwas dämpften …
Mit einer Silbernadel pickte sie einen Kern auf und schob ihn als ersten Happen in den Mund. Balian richtete sich halb auf und sah die Prinzessin sehnsüchtig an. Er war nach Natalies Tod innerlich schon selbst fast gestorben, hatte nicht mehr gewusst, wie es war, zu lieben oder sanfte Frauenhände über seinen Körper gleiten zu spüren, war etwas aus der Übung gekommen, eine Frau glücklich zu machen. Aber Sibylla hatte seine verschütteten Kenntnisse ebenso sicher geweckt, wie der Angriff seines Cousins Nicolas auf seinen Vater und dessen Gefolgsleute Balians verloren geglaubte Kampftüchtigkeit wieder hervorgebracht hatte. Ihre Nähe machte süchtig nach mehr. Er wollte sie wieder spüren, ihre Sanftheit genießen und mit ihr vor Wonne vergehen.
Sie spießte einen zweiten Granatapfelkern auf die Nadel und schlenderte auf Zehenspitzen und mit verführerischem Drehen ihres Körpers wieder zum Bett zurück. Die aufgespießte Frucht ließ sie ein paar Mal um Balians Mund kreisen, der zunächst vergeblich danach schnappte. Mit einem verspielten Lächeln fütterte sie ihn schließlich mit der Süßigkeit und erntete einen liebevollen, glücklichen Blick von ihm. Balians Lächeln wurde breiter und zärtlicher. Er hob den Arm und zog sie wieder zu sich. Sie schlüpfte wieder unter die Decke, umarmte ihn und versank mit Balian in einem ebenso zärtlichen wie verlangenden Kuss. Granatapfelkerne verfehlten eben nie ihre Wirkung …
Ibelin war keinen ganzen Tagesritt von Jerusalem entfernt, aber doch weit genug, um ungestört von allen, die etwas dagegen haben konnten, die Freuden einer neuen Liebe zu genießen.
Kapitel 29
Gotteslästerung
Die Untat der Templer blieb nicht unentdeckt. Zwar hatten sie sich große Mühe gegeben, ihre Spuren zu verwischen, hatten eigene Tote verschwinden lassen und ihren eigenen toten Pferden die Brandzeichen herausgeschnitten, aber den Kampf als solchen bestritten sie nicht. Letztlich betrachteten sie sich doch als in Gottes Auftrag tätig, und der befahl ihnen, Ungläubige zu bekehren oder zu töten. Es kam nur darauf an, die Überfallenen als die eigentlichen Schuldigen hinzustellen …
Raymond von Tiberias klagte Guy de Lusignan und den abwesenden Reynald de Châtillon vor dem Gericht des Königs des vorsätzlichen Friedensbruchs an. Allein König Balduin konnte Richter über die belehnten Adligen sein. Im Hof des Palastes, wo die öffentliche Verhandlung stattfand, waren sämtliche Templer zur moralischen Unterstützung ihrer größten Gönner außerhalb des Ordens aufmarschiert und saßen oder standen von König Balduins Thron aus gesehen auf der linken Seite des Innenhofes. Auf der rechten Seite hatten sich die Johanniter und die Jerusalem-Ritter versammelt und unterstützten Tiberias’ Anklage.
„Guy de Lusignan und Reynald de Châtillon haben mit den Templern eine Sarazenenkarawane angegriffen!“, rief Tiberias. Augenblicklich erhob sich tumultartig Widerspruch von Seiten der Templer.
„Das ist eine Lüge! Lüge! Wie wollt Ihr das beweisen?“, röhrte es von der linken Seite des Gerichtshofes. Auf der anderen Seite hoben die Johanniter wütend die Fäuste und wetterten gegen die Templer.
Großmeister de Ridefort erhob sich und übernahm es, die beiden Angeklagten zu verteidigen.
„Es war keine Karawane! Es war ein Heer auf dem Weg nach Bethlehem, um den Geburtsort unseres Herrn zu entweihen!“, behauptete er. Die Karawane war in Richtung Norden gezogen. Ob sie Damaskus als Ziel hatte, wie Tiberias vermutete oder Bethlehem, wie Großmeister die Ridefort behauptete, war unklar. Grundsätzlich war keine Unterscheidung des tatsächlichen Zielortes möglich, denn von dem Ort aus, an dem der Überfall stattgefunden hatte, lagen sowohl Damaskus als auch Bethlehem an derselben Route, so dass diese Straße in jedem Fall zu benutzen war, wollte man einen dieser Orte erreichen.
Tiberias und den meisten Anwesenden außerhalb des Templerordens war zwar völlig klar, dass de Rideforts Behauptung eine faustdicke Lüge war, eines Ritters, noch dazu eines Mönchs in Rüstung absolut unwürdig, doch einen handfesten Gegenbeweis konnte Tiberias mangels überlebender Reisender der Karawane nicht präsentieren. Allein die Tatsache, dass Kamele bei der Karawane gewesen waren, der Händler Nasser und auch Frauen unter den Toten waren, wären zwar Indizien für die friedlichen Absichten der Karawane gewesen, aber kein wirklicher Beweis. Schließlich führten auch die Moslems eine Art Tross in ihren Armeen mit, in dem sowohl Händler als auch Frauen reisten. So beschränkte der Statthalter sich darauf, die Fakten festzuhalten und die Konsequenzen darzustellen:
„Reynald hat mit den Templern das Friedensgelöbnis unseres Königs gebrochen. Salahadin wird in dieses Königreich kommen!“
Guy sah den Konstabler* hochmütig an. Er spürte, dass Tiberias nichts wirklich Greifbares gegen ihn und Reynald in der Hand hatte. Zwar hatte auch Guy einst geschworen, stets die Wahrheit zu sagen, auch wenn es seinen Tod bedeutete, doch hatte er diesen Teil des Rittereides schneller vergessen, als er ihn gesprochen hatte. Guy wollte es nicht dabei belassen, dass Raymond einfach ohne Strafe davonkam. Tiberias brauchte einen gehörigen Dämpfer, eine richtige Demütigung …
„Tiberias weiß für einen Christen erstaunlich gut Bescheid über die Absichten Salahadins“, stellte er süffisant fest. Wenn es seine Absicht war, Tiberias damit der Kollaboration mit Saladin zu bezichtigen, hatte er damit nicht den gewünschten Erfolg. Der König, der den Disput aufmerksam verfolgte, nahm den Vorwurf seines Schwagers offenbar nicht zur Kenntnis.
Tiberias hinkte mit schnellen Schritten auf Guy zu, der von der Geschwindigkeit des leicht gehbehinderten Konstablers nun doch überrascht war.
„Dass ich es vorziehe, mit Menschen zu leben, anstatt sie umzubringen, ist der einzige Grund, weshalb Ihr noch am Leben seid!“, grollte er. Guy zog spöttisch eine Augenbraue hoch.
„Diese Art von Christentum hat seinen Nutzen, nehme ich an“, versetzte er ätzend.
„Es darf keinen Krieg mit Salahadin geben!“, warnte Raymond von Tiberias eindringlich und humpelte auf seinen Platz rechts vom König zurück. „Wir wollen keinen Krieg – und es ist möglich, dass wir ihn verlieren“, prophezeite er finster.
„Blasphemie!“, protestierte Großmeister de Ridefort. Seine Ritter stimmten in den Protestruf ein.
„Ein Heer, das das Kreuz Jesu Christi vor sich herträgt, kann nicht besiegt werden“, verkündete Gérard de Ridefort überzeugt. „Stellt der Graf von Tiberias diese Tatsache in Frage?“ stieß er hervor, die Linke fest um den Schwertgriff gekrallt.
Raymond von Tiberias zog sich zurück. Jede Antwort auf diese rein rhetorische Frage hätte auf die eine oder andere Weise als Gotteslästerung ausgelegt werden können. Nicht, dass Tiberias um sein eigenes Leben fürchtete; er fürchtete vielmehr Uneinigkeit unter den Christen, im Extremfall ein Zerreißen des Königreichs Jerusalem, was nur Saladin in die Hände spielen würde. Das Gleichgewicht der Kräfte im Heiligen Land war empfindlich, und Raymond wollte für eine entsprechend heftige Verschiebung nicht verantwortlich sein.
„Es muss Krieg geben!“, forderte Großmeister de Ridefort entschlossen und hob die geballte Faust. „Gott will es!“, bekräftigte er. Sämtliche Templer fielen in den Ruf ein und auch Guy de Lusignan stieß ein unüberhörbares
„Gott will es!“, hervor.
Dass für eine von Raymond von Tiberias befürchtete Kräfteverschiebung schon die Rivalität unter den bewaffneten Mönchsorden sorgen konnte, zeigte sich augenblicklich, als Templer auf der einen Seite und Johanniter – unterstützt von den rein weltlichen Jerusalem-Rittern – auf der anderen Seite aufeinander losgingen – einstweilen noch hitzig diskutierend, aber solche hitzigen Diskussionen konnten durchaus in handfesten Prügeleien enden. Tiberias hatte buchstäblich einschlägige Erfahrungen …
Aus dem Augenwinkel bemerkte Raymond, dass ein Diener dem König eine Nachricht überbrachte. Balduin riss das Siegel auf, las die Nachricht und hob die Hand, um dem Tumult Einhalt zu gebieten. Als die Streithähne nicht sofort reagierten, brüllte der Konstabler mit wahrer Stentorstimme:
„Rrruuheee!“
Erschrocken von der Lautstärke, die das Getümmel ohne weiteres übertönte, schwiegen die eben noch heftig streitenden Kontrahenten.
„Salahadin hat den Jordan überschritten – mit zweihunderttausend Mann!“, verkündete König Balduin mit unüberhörbarem Seufzen. Alle sahen sich betroffen an.
„Zuerst marschiert er gegen … Kerak … und Reynald de Châtillon!“, prophezeite Tiberias. Eilig ging er zu König Balduin.
„Mylord …“, setzte er an, aber Balduin stoppte ihn mit einer leichten Handbewegung.
„Wir müssen ihn treffen, bevor er Kerak erreicht“, entschied der König. „Ich … werde unser Heer anführen.“
„Mein König, wenn Ihr … reist … werdet Ihr sterben!“, warnte Raymond entsetzt. Balduin nahm ihn an den Schultern.
„Schickt Nachricht an Balian! Er soll das Volk beschützen“, wies er den Statthalter an. Tiberias senkte den Kopf.
„Versammelt das Heer!“, rief König Balduin dann. Tosender Jubel erhob sich – nicht nur unter den Templern …
Sibylla ging schweigend neben Balian über den Hof des Herrenhauses. Sie hatten eine wunderschöne Zeit voller Liebe und Zärtlichkeit miteinander verbracht. Tage voller Freude und Nächte, erfüllt mit liebevoller Leidenschaft lagen hinter ihnen. Jetzt war der Tag des Abschieds gekommen. Sie mochte sich noch nicht losreißen von dem erholsamen Aufenthalt in Ibelin, aber wenn sie weiter ausblieb, würde das zu Suchaktionen führen – die würden schnell ergeben, dass sie nicht in Kanaan gewesen war, was sie bei Hofe als Ziel ihrer Reise angegeben hatte. Außer Balduin wusste nur Tiberias, wo die Schwester des Königs sich aufhielt. Die königlichen Geschwister wollten möglichst genau wissen, wer Balian von Ibelin wirklich war und welche Ziele er hatte. Balduin wusste, wie unglücklich seine Schwester in ihrer Ehe mit Guy de Lusignan war – und er wusste um die Gefahr, die Guy eines Tages darstellen würde, wenn sein Sibyllas Sohn die Krone erbte. Beide sahen in Balian eine Alternative, die sich nun als möglich erwiesen hatte. Sie würde ihrem Bruder einen bestimmten Vorschlag machen …
Balian erging es ähnlich wie der Prinzessin, auch wenn er von den Plänen der königlichen Geschwister keine Ahnung hatte. Sibylla hatte diesen gewissen Umstand geflissentlich verschwiegen. Er hatte sich an ihre Gegenwart gewöhnt und festgestellt, dass sie privat tatsächlich völlig anders war als ihr öffentliches Gesicht vermuten ließ. Privat war sie eine fröhliche, freundliche, stets zu Neckereien aufgelegte junge Frau, die ebenso unkompliziert war wie Balian selbst. Sie war eine ebenso zärtliche wie leidenschaftliche Frau, die sich – wenn sie wollte – ganz und gar verschenken konnte. Balians von Verlusten gequälte Seele hatte bei ihr Heilung gefunden. Er hatte über seinen Kummer reden können, was unendlich viel wert war; er hatte in ihr eine Frau gefunden, für die körperliche Begegnung nicht eheliche Pflicht, sondern zärtliches Vergnügen war. Aber sie war die Frau eines anderen … Was sie ihm von Guy erzählt hatte, war alles Mögliche, aber ganz sicher keine glückliche Ehe. Dennoch wussten sie beide, dass Sibylla in den goldenen Käfig in Jerusalem zurückkehren musste, sollte ihre Liebe vorerst unentdeckt bleiben.
Stallknechte brachten die Pferde der Prinzessin und ihres Gefolges. Balian half der Geliebten ritterlich in den Sattel. Sie beugte sich zu ihm, war versucht, ihn zu küssen. Im letzten Moment besann sie sich und nahm den Ring, den sie ihm als Zeichen ihrer Liebe geschenkt hatte, den er an einer einfachen Kette um den Hals trug. Sie drückte den eigentlich seinen Lippen zugedachten Kuss auf den roten Stein in der Fassung des Rings.
„Was wird aus uns werden?“, fragte sie voller Wehmut. Balian rang sich ein tapferes Lächeln ab.
„Das wird die Welt entscheiden – so wie die Welt immer entscheidet“, erwiderte er fatalistisch. Nichts in seinem Leben hatte bisher Bestand gehabt. Wie konnte er auch nur ansatzweise hoffen, dass diese verbotene Liebe eine Zukunft hatte, die er selbst beeinflussen konnte?
Hufschläge forderten die Aufmerksamkeit aller, die im Torbogen des Herrenhauses standen. Ein Reiter im blauen Jerusalemer Rock hetzte den Weg zum Herrenhaus hinauf. Der Mann wirkte mindestens so erschöpft wie sein Pferd. Almaric rannte hinaus, hielt das scheuende Pferd, zwei Wächter stützten gerade noch den Boten, bevor er aus dem Sattel kippte. Der Mann konnte nur noch leise flüstern – doch was er sagte, war alarmierend genug. Almaric drehte sich um.
„Mylord! Der König ist auf dem Weg nach Kerak!“, rief er.
Kapitel 30
Die Verteidigung von Kerak
Balian und vielleicht dreißig seiner Männer begleiteten Sibylla – eigentlich nach Jerusalem, das auf dem Weg nach Kerak lag. Sie waren recht verblüfft, als die Prinzessin darauf bestand, nach Kerak mitzukommen. Balian konnte ihr nicht befehlen, nach Jerusalem zu gehen – hier, außerhalb von Ibelin, hatte sie das Sagen …
Als sie Kerak erreichten, war von Balduins Heer noch nichts zu sehen. Allerdings hatte Balduin einen großen Teil Fußtruppen bei sich. So war die rein berittene Truppe um Balian und Sibylla erheblich schneller gewesen.
Panische Menschen rannten in Richtung der Burg Kerak, kamen auf Kamelen, mit Kindern und Alten, trugen, was sie hatten retten können.
„Schnell! Schnell!“,
war ein verzweifelter Ruf, der immer wieder zu hören war.
Im Sonnenglast erkannte Almaric in der Ferne eine dünne, dunkle Linie.
„Reiter der Sarazenen!“, meldete Almaric seine Beobachtung an Balian. „Sie kommen um Reynald einzuschließen. Außerhalb der Mauern sind die Menschen in Gefahr. Salahadin wird diesem Trupp mit Sicherheit folgen.“
Balian nahm die Warnung auf und traf seine Entscheidung. Er beugte sich zu Sibylla hinüber.
„Begebt Euch jetzt in die Festung“, sagte er. Sibylla nickte.
„Haya bena!“, kommandierte sie. Sie selbst, ihre Leibdienerin und ihre Turkopolen im Jerusalemrock gaben ihren Pferden eilig die Sporen und galoppierten in die noch immer offene Burg, während Balian sein Pferd anspornte und mit seinen Männern den Sarazenen entgegen ritt.
Sibylla und ihre Zofe jagten samt ihren Begleitern in die Burg hinein. Von oben, vom Söller her, begrüßte Reynald sie mit einem Weinkelch in der einen und Trauben in der anderen Hand.
„Besucher!“, jauchzte er spöttisch. Reynald sah in seinem karottenroten Festtagsgewand nicht danach aus, als bereite er sich auf einen Kampf, gar eine Belagerung seiner Burg vor.
Bei Balians Truppe, die sich zu einer Linie formiert hatte und auf den Befehl ihres Anführers wartete, erschien ein junger Tempelritter.
„Mylord Balian! Mylord Balian!“ rief er. Balian ließ sein Pferd einige Schritte aus der Reihe vortreten, um sich dem Templer zu zeigen.
„Mylord, Reynald bittet Euch, Euer Heer nach Kerak zu führen.“
„Danke, aber nein!“, wehrte Balian ab. „Wenn wir das tun, werden diese Menschen sterben. Wir halten die Sarazenen so lange auf, bis der König eintrifft.“
„Wie Ihr meint“, entgegnete der Templer und jagte zurück. Almaric sah seinen jungen Herrn an.
„Wir können sie nicht angreifen … und überleben“, gab er zu bedenken, als er die große Zahl der sarazenischen Reiter richtig übersah.
Die Prinzessin eilte gleich nach oben auf die Festungsmauer, um nach Balian und seinen Männern Ausschau zu halten. Als sie dort ankam, verbeugte sich einer von de Châtillons Dienern ehrerbietig vor der Prinzessin.
„Mylady …“
Auch Reynald entging ihr forschender Blick nicht. Er räusperte sich, um ihre Aufmerksamkeit zu erhalten, doch Sibylla beachtete ihn nicht.
„Was betrachtet Ihr da?“, fragte er grob und grußlos. Sibylla sah hinaus zu dem kleinen Häuflein Soldaten im Ibelin-Rock, die sich einer vielfachen Übermacht entgegenstellten, um den fliehenden Bauern Gelegenheit zu geben, Keraks sichere Mauern zu erreichen.
„Einen Ritter … seine Männer“, sagte sie leise. Es kostete sie unendliche Mühe, ihr öffentliches Gesicht zu wahren und nicht zu zeigen, welch furchtbare Angst sie um den Geliebten hatte, der sich in ein aussichtsloses Gefecht begab …
Balian sah seinen Hauptmann verstehend an und sah sich dann unter seinen Männern um. Nein, er konnte ihnen nicht einfach befehlen, ihm in den Tod zu folgen, aber er konnte diese Bauern auch nicht ohne Schutz lassen.
‚Beschütze die Wehrlosen!’, hallte der Schwur in seinem Inneren nach. Wenn diese Bauern nicht wehrlos waren, wer dann?
►„Es gibt sicher eine Legende, wie viele Sarazenen einer von uns aufwiegt …“, mutmaßte Balian und sah Almaric an. So stolz, wie sich die christlichen Adligen üblicherweise gaben, wären sie von einem Verhältnis eins zu eins, ja auch von drei zu eins tief beleidigt gewesen, dessen war Balian sicher.
„Meistens sagt man zehn“, erwiderte Almaric. Balian nickte. So in der Art hatte er es ihnen auch zugetraut. In gewissen Grenzen stimmte dieses Gerücht sogar – jedenfalls bei einem Reiterangriff, was auf die wesentliche schwerere Panzerung der christlichen Ritter zurückzuführen war. Balian nickte. Er hatte etwa dreißig Mann; was sich da am Horizont zeigte, waren nach seiner Schätzung nicht mehr als dreihundert; vielleicht würde das Gerücht seinen Männern etwas Vertrauen zu ihm einflößen – oder noch besser: ihnen zu sich selbst.◄
„Steht ihr mir bei?“, fragte er in die Runde. Almaric nickte mit einem Lächeln. Wortlos senkten die übrigen Männer ihre Visiere, zogen die Schwerter, machten die Lanzen zum Angriff bereit. Balian im Stich zu lassen, kam für keinen von ihnen in Frage, ob es diese Legende von der Stärke der Kreuzritter gab oder nicht. Auch Balian zog sein Schwert, küsste ehrfürchtig die Klinge, die sein Vater ihm eben für diesen Zweck übergeben hatte, für den er sie jetzt erstmals benutzen wollte. Dann streckte er es gerade nach vorn.
„Vorwärts!“, kommandierte er.
Die ganze lange Reihe nebeneinander stehender Reiter ritt an, sortierte sich zu einer Zweierreihe und stürmte den herannahenden Sarazenen entgegen.
„Aufteilen!“, kommandierte Balian. Die kleine Truppe von allenfalls dreißig Reitern teilte sich aus der Zweierreihe wie ein sich entfaltender Vorhang und attackierte in voller Breite und rasendem Galopp die ihnen entgegenkommenden Sarazenen. Die Sarazenen ihrerseits gaben ihren Pferden ebenfalls die Sporen, wichen zu beiden Seiten hin aus – und überflügelten die christlichen Ritter, kreisten sie ein.
Der Zusammenprall aus dem vollen Galopp war fürchterlich. Es schepperte metallisch, als Schwerter und Speere auf Rüstungen und Schilde prallten; dumpf, wenn Pferdeleiber zusammenstießen. Innerhalb von Augenblicken war ein unübersichtliches Getümmel auf der weiten Ebene vor Kerak.
Ein Axthieb warf Balian aus dem Sattel. Er verlor den Helm, behielt aber Schwert und Schild in den Händen. Ein Sarazene wollte den Moment nutzen und Balian mit dem Speer aufspießen, doch warf sich der junge Baron geistesgegenwärtig beiseite. Der tödliche Speerstich traf sein Pferd und tötete den Rappen. Sofort stürzten sich drei oder vier Sarazenen auf ihn, aber Balian wusste sich zu wehren – rechts mit dem langen Schwert, links teilte er mit dem Schild aus, einem verpasste er einen Tritt in die Weichteile.
Es war ein wildes Gemetzel; Blut spritzte aus aufgeschlitzten Leibern, Sarazenen und Kreuzritter sanken auf den heißen Wüstenboden. Balian wurde es in dem hitzigen Kampf, in dem er schon einige Sarazenen außer Gefecht gesetzt hatte, unter der ledergefütterten Kettenkapuze zu heiß. Er zog sie ab, um mehr Luft zu bekommen. Drei Sarazenen wollten den kurzen Moment nutzen, in dem der Baron nicht wie ein Berserker um sich schlug. Sie stürzten sich auf ihn und rangen im Nahkampf mit ihm. Er hielt sie sich vom Leib, aber ein vierter kam von hinten an ihn heran und zog ihm eine Art Keule mit einer kinderfaustgroßen Verdickung am Ende des Schaftes über den Kopf. Balian sackte zusammen und blieb bewusstlos liegen.
Von der Festung aus war es trotz des aufgewirbelten Staubs unübersehbar, dass der Kampf verebbte – und dass von den Ibelinern keiner mehr auf den Füßen stand oder gar noch im Sattel saß. Sibylla spürte einen tiefen Stich im Herzen. Erschüttert schloss sie die Augen und presste die Lippen zusammen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Balian noch lebte, war nicht groß. Die Tat war heldenhaft gewesen, denn die fliehenden Bauern hatten die Burg erreichen können, weil die Männer Ibelins die Sarazenen beschäftigten und sie aufhielten.
‚Balian! War der Preis nicht zu hoch, den diese Tat von dir gefordert hat?‘, durchzuckte es die junge Frau. Ihrem Geliebten offenbar nicht, sonst hätte er sein Leben nicht für diese Menschen aufs Spiel gesetzt. Er hatte den Rittereid hinsichtlich des Schutzes Wehrloser absolut ernst genommen. Er war wirklich der vollkommene Ritter. Sie fürchtete nur, dass er der beste Ritter Jerusalems gewesen war …
Kapitel 31
Freundlicher Feind
Der Staub des wilden Kampfes legte sich. Die Sarazenen trieben die Überlebenden als Gefangene zusammen, suchten dann unter den Liegengebliebenen nach verwundeten Überlebenden, sonderten die definitiv Toten ab. Michel und Almaric saßen erschöpft auf dem Boden. Es war vorhersehbar gewesen – aber Almaric hatte auch gesehen, dass die Flüchtlinge die Burg erreicht hatten und den Sarazenen vollzählig entwischt waren. So gesehen war die Attacke ein Erfolg gewesen – aber um welchen Preis? Das letzte, was Almaric von Balian gesehen hatte, war, dass er gegen drei oder vier Sarazenen gerungen hatte und leblos zu Boden gegangen war. Almaric trauerte schon um seinen jungen Herrn, als vier Sarazenen ihn herantrugen. Jeder hatte sich ein Arm oder ein Bein des Herrn von Ibelin gegriffen. Balians Kopf hing reglos herunter.
Die Soldaten brachten den leblos scheinenden Anführer der Franken vor ihren prächtig gerüsteten Kommandeur, ließen ihn zu dessen Füßen unsanft bäuchlings auf den Boden fallen. Balian blieb liegen und rührte sich nicht. Ein fünfter Soldat ließ das Schwert von Ibelin neben seinem Eigentümer achtlos fallen.
Almaric und Michel sahen sich betroffen an, als der Anführer der sarazenischen Vorhut sein nur wenig gebogenes Schwert zog und es vor sich herunterstieß, nachdem er zunächst eher vorsichtig mit der Spitze Balians Haar sondiert hatte. Doch er hatte nicht etwa Balian den Gnadenstoß gegeben, sondern die Klinge gut zwei Handbreit von dessen Gesicht entfernt in den Boden gerammt.
Die tiefstehende Sonne spiegelte sich über einen polierten Schild in der ebenso blanken Klinge des Sarazenenführers. Der Strahl fiel genau auf Balians linkes Auge. Der Anführer wartete geduldig, bis der Gefangene von sich aus eine Regung zeigte.
Helles Licht blendete Balian. Nur mühsam fand er mit brummendem Schädel in die Wirklichkeit der Wüste vor Kerak zurück. Er blinzelte, bemerkte, dass er auf dem Bauch lag. Immerhin – er lebte, auch wenn sein Kopf sich anfühlte, als wäre er unter den eigenen Schmiedehammer geraten … Langsam drehte er den Kopf und sah hoch. Sein Blick fiel auf zwei kostbar geschmückte Reitstiefel, die keine ganze Elle von seiner Nase entfernt waren.
„Eure Güte wird unter Euren Feinden bekannt sein, bevor Ihr ihnen begegnen werdet, mein Freund“, drangen bekannte Worte an Balians Ohr. Er stützte er sich stöhnend auf den Armen hoch und brachte es fertig, weiter nach oben zu sehen. Er fand das lächelnde Gesicht eines ihm gut bekannten Sarazenen: Imad! Noch immer halb auf dem Bauch liegend, presste Balian heraus:
„Ihr wart nicht der Diener dieses Mannes!“
Imad schüttelte mit einem geradezu schelmischen Grinsen den Kopf.
„Nein“, lachte er unterdrückt, „er war mein Diener!“
Balian rappelte sich mit einiger Mühe auf die Knie auf. Gerupft, das Gesicht in der rechten Hälfte mit Schweiß und Sand verklebt, auf der linken Seite noch die Blutspur der Platzwunde, die der Hieb mit der Keule verursacht hatte, bemühte Balian sich, nicht gleich wieder umzukippen. Die Welt drehte sich immer noch leicht um ihn. Er sah Imad an.
„Was … wird aus uns werden?“, fragte er, unbewusst Sibyllas Worte zitierend. Imads Lächeln war pure Güte.
„Das, was Ihr verdient. Man erntet, was man sät. Das habt Ihr doch schon gehört, nicht wahr?“
Balian nickte ergeben. Man hatte ihm erzählt, dass die Sarazenen gefangene Kreuzritter in der Regel töteten. Der junge Baron schloss mit dem Leben ab und erwartete den tödlichen Hieb. Er wollte nicht darauf hoffen, dass Imad ihm aus Dankbarkeit für seine eigene Großmut das Leben schenken würde – erst recht nicht, wenn er vielleicht mit ansehen musste, wie seine treuen Gefolgsleute an seiner Statt geköpft wurden.
Doch so drohend, wie diese Worte zunächst klangen, waren sie nicht gemeint. Imad winkte leicht mit der Hand.
„Steht auf“, setzte er freundlich hinzu. Balian nahm sein Schwert und stützte sich damit vollends auf. Als er stand, schien die Welt sich wieder heftiger zu drehen, aber der durchdringende Ton, den er hörte hatte nichts mit seinem Brummschädel zu tun. Es war ein Signalhorn der Armee Salahadins …
Kapitel 32
Jerusalem erwacht
Imad wies mit dem Kopf zur Festung. Das Signal war für ihn das Zeichen, dass er nun nicht mehr allein über das Schicksal dieser Kreuzritter zu entscheiden hatte.
„Ihr dürft Euch nach Kerak zurückziehen – aber Ihr werdet dort sterben“, erklärte er weiter. In seiner Stimme klang hörbares Bedauern mit.
„Mein Herr ist hier“, setzte er hinzu, was wohl heißen sollte:
‚Ginge es nach mir, wären du und deine Männer ab sofort frei.’
Tatsächlich marschierte hinter Imad ein großes Heer auf, das von Sultan Saladin geführt wurde – dem einzigen Mann, dem Imad ad-Din, so sein voller Name, Rechenschaft schuldig war.
Balian spürte ein leichtes Dröhnen im Boden; ein Dröhnen von vielen Füßen und Hufen. Er sah sich halb um und bemerkte im Sonnenglast das goldbeschlagene Heilige Kreuz, das Truppen des Königs von Jerusalem mit sich zu tragen pflegten. Noch bevor er sagen konnte:
‚Und da kommt meiner!’,
hatte Imad die Zeichen ebenfalls erkannt.
„Sagt Salahadin, dass Jerusalem gekommen ist!“, befahl er einem reitenden Boten, der augenblicklich kehrt machte und zu Saladin jagte.
Balian und Imad standen nahe beieinander und sahen sich zwischen den sich von beiden Seiten nähernden Truppen Balduins und Saladins. Der christliche Baron schwieg müde und erschöpft. Immerhin – die Bauern hatten entkommen können, denn er fand nicht einen einzigen getöteten Bauern unter den Opfern dieses harten Kampfes …
Die Heere näherten sich. Aus den Reihen beider Seiten löste sich je eine kleine Gruppe von allenfalls acht bis zehn Reitern, angeführt von ihren Königen. Balduin, abgesehen von dem blauen Jerusalem-Wappenrock ganz in Weiß gekleidet, trug seine Ausgehmaske aus kunstvoll damasziertem Silber, jedoch ohne naturalistische Augenbrauen und Bart, die seiner sonst täglich getragenen Maske ihr Leben verliehen. Er ritt einen Araberschimmel.
Saladin war völlig in Schwarz gekleidet – wenn die Stoffe auch kostbar mit Gold durchwirkt waren – und ritt einen Rappen edelster arabischer Zucht, der vor Temperament eine volle Drehung machte, bevor er sich vor dem Schimmel zügeln ließ.
Oben, auf dem Söller der Burg Kerak, sah Sibylla zu ihrem ebenso großen Entsetzen wie zu ihrer großen Freude, dass ihr Bruder selbst gekommen war – und sie sah Saladin.
„Salahadin!“ entfuhr es ihr leise. Dann wurde sie gewahr, dass Balian ihr direkt gegenüberstand, wenn auch eine gute Meile entfernt. Die Erleichterung, die sie spürte, durfte sie nicht zeigen, aber einen stummen Dank an Gott konnte sie sich erlauben. Balian lebte!
Saladin und Balduin begrüßten einander in der Mitte zwischen ihren Heeren.
„Ich bitte Euch, mit Eurem Heer abzuziehen und mir diese Angelegenheit zu überlassen“, forderte Saladin den König von Jerusalem auf. Er sprach gutes Überseefranzösisch, wenngleich mit unüberhörbarem Akzent.
„Ich bitte Euch, Euch wohlbehalten nach Damaskus zurückzuziehen“, erwiderte Balduin. Saladin sah den jungen Christenkönig einen Moment an. Er wusste, wie krank der junge Monarch war, dass dessen Leben an einem seidenen Faden hing – auch ohne die islamische Tradition, Todesurteile in Form einer seidenen Schnur zu verkünden … Wenn Balduin sich in seinem Zustand herbemühte, hatte das einen Grund, das war dem Sultan klar.
„Reynald de Châtillon wird bestraft werden, das schwöre ich!“, sprach Balduin Saladins Hoffnung aus. „Zieht Euch zurück, oder wir werden hier alle sterben“, setzte er hinzu. Der Sultan überlegte eine Weile, ob er es sich leisten konnte, Reynald nicht selbst für seine fortdauernden Provokationen zu strafen. Balduin würde sein Wort halten, daran zweifelte er keinen Augenblick. Der Wortlaut des christlichen Rittereides war ihm bekannt, und er wusste, dass Balduin IV. diesen Eid für sich ernst nahm. Was er versprach, würde er halten. Das Problem waren nur jene, die sich an die Zusagen des Königs oder des Sultans nicht hielten …
Es waren quälend lange Momente, in denen alle, die die beiden Könige von fern beobachteten, gespannt warteten, was nun geschehen würde; Balian von Ibelin und Imad ad-Din ebenso wie Sibylla auf dem Söller von Kerak oder die Ritter und Soldaten beider Heere.
„Kommen wir überein?“, fragte Balduin schließlich, um das Verhandelte abzuriegeln. Saladin nickte.
„Wir kommen überein“, erwiderte er langsam. „Ich werde Euch meine Leibärzte schicken“, setzte er hinzu, als Balduin leise stöhnte. Der König von Jerusalem hob die Hand zum Gruß.
„As-Salam ’alaykum“, grüßte der Christ.
„U ’alaykum as-Salam“, erwiderte der Moslem, wendete sein Pferd und ritt zurück. wendete. Saladin lag am Frieden ebenso viel wie dem jungen König von Jerusalem, aber dafür musste Balduin leben, doch es stand schlecht um ihn, das wusste Saladin nur zu genau. Auch sarazenische Ärzte konnten die Lepra nicht heilen, an der Balduin litt, aber sie konnten sie lindern und sein Leben damit verlängern – und damit den Frieden. Balduin nahm es nickend zur Kenntnis und drehte dann nach Kerak ab.
Kapitel 33
Der Kuss des Friedens
Der König von Jerusalem ritt durch ein Spalier seiner Ritter im kornblumenblauen Wappenrock bis in den Burghof hinein.
Reynald hatte den König bereits kommen sehen. Er war ein Lump, aber gewiss kein Feigling. Ihm war – eingedenk der Worte Tiberias’ – völlig klar, dass seine Herrlichkeit in Kerak beendet war. Doch er schlich nicht etwa wie ein geprügelter Hund in den Hof, nein, er rauschte im vollen Festtagsornat in den Hof, laut verkündend:
„Ich bin Reynald de Châtillon!“
Doch dann verneigte er sich ehrerbietig vor König Balduin.
Balian und seine überlebenden Männer waren inzwischen in der Burg angekommen und standen in der Nähe des Tores, als Balduin hereinkam. Ein Stallknecht nahm den Hengst des Königs am Zügel und gab ihm eine bestimmte Hilfe. Das gut dressierte Pferd kniete im Burghof nieder und ermöglichte es seinem durch die Lepra schon schwer behinderten Herrn Balduin, sein noch beweglicheres rechtes Bein über den Widerrist zu schwingen und nahezu ebenerdig abzusteigen. Der König zog mit der rechten Hand seine Reitgerte aus der Halterung neben dem Schwert
„Auf Eure Knie!“, zischte Balduin zornig. Reynald ging gehorsam in die Knie.
„Tiefer!“, forderte Balduin scharf und wies mit der Reitgerte weiter nach unten. Reynald folgte brav der Bewegung bis knapp vor den Kotau*. Balduin zog seinen linken Handschuh aus. Seine linke Hand hatte keinen vollständigen Finger mehr; mindestens das obere Glied war bereits infolge der Lepra weggefault. Schwärende Wunden überzogen die Hand, ein Ekel erregender Gestank ging von dem faulenden Fleisch aus. Aber mitten in dieser verfallenden Hand steckte der königliche Siegelring am Rest von Balduins linkem Ringfinger.
„Ich … bin Jerusalem!“, fauchte der König zornig. Er bemerkte nicht, dass Guy de Lusignan nicht weit entfernt stand und diese Worte mit leicht gesenktem Kopf und tückischem Blick aufnahm.
„Und Ihr … Reynald … werdet mir den Friedenskuss geben!“, befahl er dann und hielt de Châtillon die lepröse Hand hin. Reynald zögerte einen Moment, dann griff er zu und bedeckte die verwesende Hand über und über mit Küssen, bis Balduin sie ihm entzog und er Reynald links und rechts mehrfach die Reitpeitsche ins Gesicht schlug, dass de Châtillon schließlich zu Boden ging.
Ächzend wandte sich der König nach Vollzug der ersten Strafe ab; er hatte seine Kräfte überschätzt. Balduin taumelte und knickte ein.
„Wache!“, befahl Tiberias. Die Wachen griffen rasch zu und bewahrten den König davor, ganz zu Boden zu gehen. Sie stützten ihn und geleiteten ihn zu einer auf Tiberias’ Befehl vorsorglich mitgenommenen Liegesänfte. Balduin hatte sich, wie von Raymond befürchtet, einfach übernommen.
Reynald sah auf, zerschunden und zerschlagen, und blickte in Tiberias’ grimmiges Gesicht.
„Was gibt’s hier zu sehen?“, knurrte er. Der Konstabler zog spöttisch eine Augenbraue hoch.
„Einen toten Mann!“, versetzte er. „Reynald de Châtillon, Ihr seid verhaftet – und verurteilt!“, verkündete der Statthalter dann. Wachen packten Reynald und brachten ihn fort.
Balduin lag in der Sänfte, sah sich um und fand den vom Kampf gezeichneten Balian unter dessen Männern bescheiden am Tor stehen. Der König winkte ihn zu sich. Es dauerte einem Moment, bis Balian begriff, dass er selbst gemeint war. Unsicher ging er zu der Sänfte und kniete daneben nieder.
„Wenn Ihr so weitermacht, werde ich eine Aufgabe für Euch finden müssen“, sagte Balduin anerkennend. Er hatte Balian noch unterschätzt, das gestand sich der König ohne Schande ein. Balian von Ibelin war eine Zierde der christlichen Ritter im Heiligen Land. Es wurde Zeit, ihm die entsprechende Anerkennung dafür zu geben.
„Das heißt … wenn Gott Euch entbehren kann!“, setzte er hinzu. Was Sibylla ihm eben kurz berichtet hatte, klang nach Todessehnsucht des jungen Herrn von Ibelin. Das Grinsen konnte Balian unter der silbernen Maske nicht sehen, aber es klang durch die Worte des Königs hindurch. Doch er war noch nicht soweit, diese Bemerkung als lockeren Scherz hinzunehmen.
„Gott kennt mich nicht!“, wehrte er ab. Wenn Gott nicht zu ihm sprach, nahm er ihn einfach nicht wahr, sagte er sich. Balduin hob begütigend die rechte Hand.
„Aber ich … kenne Euch!“, erwiderte er mit einem leisen Lachen.
Balian verstand nicht die ganze Tragweite dessen, was Balduin eben gerade gesagt hatte. Balduin war König von Gottes Gnaden, so verstanden sich alle christlichen Könige. Wenn ein König einen Mann kannte, spätestens dann kannte auch Gott diesen Mann, der dem König schließlich besonders nahe war. Balduin spürte die Demut und die Bescheidenheit des jungen Barons, der seiner eigenen Meinung nach nur seine ritterliche Pflicht erfüllt hatte. Dass er sich gerade dadurch deutlich von der überwiegenden Zahl der christlichen Ritter abhob, war Balian überhaupt nicht bewusst. Balduin schätzte genau diese Haltung – und Balian ganz persönlich. Der wortkarge, zurückhaltende Baron, der sich nicht vordrängte, lieber im Hintergrund blieb, der lieber handelte, war ein leuchtendes Vorbild als treuer Diener des Königs und Beschützer der wehrlosen Bauern. Doch während Balian dies als selbstverständliche Pflicht betrachtete, löste dies bei anderen ätzenden Neid aus – bei Guy zum Beispiel, der ihn mit kaum verhohlenem Hass ansah.
Tiberias trat an die Sänfte, Balduin gab ihm ein Zeichen.
„Haya bena!“, befahl der Statthalter. Vier dunkelhäutige Diener in muslimischer Kleidung hoben die Sänfte auf und trugen den todkranken König aus der Burg Kerak fort. Balian stand unschlüssig dort, wo er neben der Sänfte des Königs gekniet hatte. Tiberias klopfte ihm anerkennend auf die Schulter und stieg dann in den Sattel seines Pferdes.
„Ich brauche dich in Jerusalem“, sagte er zu ihm und verließ dann ebenfalls die Burg.
Reynald sah völlig verblüfft auf Balian, der den ganzen Ruhm erntete, obwohl er danach nicht strebte, bis ihn die Wachen abführten. Balian sah ihm nach, griff am Halsausschnitt in sein Kettenhemd und zog Sibyllas Ring heraus, als er die Prinzessin auf halbem Weg zum Tor des Palas stehen sah und bedachte ihr Geschenk mit einem zärtlichen Kuss der Dankbarkeit. Dieser Ring war sein Talisman, sein Schutz.
Doch nicht nur Sibylla bemerkte die liebevolle Geste, auch Guy nahm sie wahr und zog die richtige Schlussfolgerung, als sein Blick dem des Barons folgte – zu seiner Gemahlin Sibylla … Das würde dieser Bastard büßen!
Kapitel 34
Erzittern im Angesicht des Islam
Saladin und Imad kehrten in ihr Zeltlager zurück, nachdem die Armee des Sultans sich wie vereinbart von Kerak zurückgezogen hatte. Saladin wusch sich die Hände und saß gerade, als der Wachtposten Khaled ibn Jubayr, einen jungen Mullah*, einließ. Khaled ging eilig zu Sultan Saladin.
„As-Salam ’alaykum“, grüßte er.
„U ’alaykum as-Salam“, erwiderte der Sultan. Khaled sah sich auffordernd um. Die Leute, die bei Saladin im Zelt waren, erhoben sich und verließen abgesehen von Imad den überdachten Platz.
„Wieso haben wir uns zurückgezogen? Wieso?“, fragte der junge Geistliche. „Gott war nicht mit ihnen!“, setzte er mit gewisser Schärfe hinzu. „Gott allein bestimmt den Ausgang einer Schlacht.“
„Der Ausgang einer Schlacht wird von Gott bestimmt“, bestätigte Saladin. „Aber auch von der Vorbereitung, Anzahl der Männer, dem Ausbleiben von Krankheiten und der Verfügbarkeit von Wasser“, versetzte er. „Man kann eine Belagerung nicht aufrechterhalten mit dem Feind im Rücken“, fuhr er fort. „Wie viele Schlachten hat Gott für die Moslems gewonnen, bevor ich kam … oder sagen wir … bevor Gott bestimmte, dass ich kommen sollte?“, fragte er dann.
„Wenige genug“, räumte Khaled ein. „Weil wir gesündigt haben“, fügte er dann seine religiöse Begründung hinzu.
„Es lag daran, dass sie nicht gut vorbereitet waren!“, entgegnete Saladin scharf.
„Wenn Ihr so denkt, werdet Ihr nicht lange König sein“, drohte der Mullah. Saladin erhob sich und ging auf den jungen Geistlichen zu, der knapp einen halben Kopf kleiner war als er.
„Wenn ich meine Krone verliere, fürchte ich um den Islam!“, erwiderte er. Saladins oberstes Ziel war die Einheit der islamischen Welt. Er wusste nur zu gut, dass es gegenwärtig keinen ernst zu nehmenden Rivalen für ihn gab. Damit hing aber auch die von ihm mühsam zustande gebrachte Einigkeit der islamischen Völker an seiner eigenen Person. Nur die Einigkeit der Menschen islamischen Glaubens ließ sie gegen die Kreuzritter überhaupt bestehen, mochten die christlichen Kreuzfahrerstaaten in letzter Zeit auch immer schwächer geworden sein – durchaus eine Folge der krankheitsbedingten Schwäche König Balduins, den Sultan Saladin persönlich sehr schätzte.
„Danke für deinen Besuch“, sagte Saladin, hielt dem Mullah die Hand zum Abschied hin und stellte damit klar, dass die Unterredung für ihn beendet war, doch Khaled reagierte nicht.
„Danke für deinen Besuch!“, wiederholte Saladin, allerdings lauter.
Khaled trat nah an den Sultan heran.
„Ihr habt es versprochen!“, erinnerte er ihn. „Ihr habt versprochen, Jerusalem zurückzuerobern! Vergesst das nicht!“, sagte er eindringlich, wandte sich ab und verließ das Zelt.
Saladin und Imad sahen sich verstehend an. In mancher Hinsicht hatte Saladin die gleichen Probleme innerhalb seiner Gefolgschaft, gegen die auch Balduin zu kämpfen hatte. Religiöse Radikale wie Khaled ibn Jubayr waren eines dieser Probleme. Nur hatte Saladin den Vorteil, bei bester Gesundheit zu sein … Dennoch wurde es auch für ihn immer schwieriger, die Radikalen unter Kontrolle zu halten und ihnen die Rückeroberung Jerusalems als eines der wichtigsten Heiligtümer des Islam für die Zeit nach Balduins Tod in Aussicht zu stellen. Balduin würde nicht mehr lange leben, das war Saladin klar; auch seine Ärzte konnten dem jungen Christenkönig nicht mehr helfen. Zu weit war die Lepra bereits fortgeschritten.
Saladin ließ sich seufzend in seinen Sessel fallen.
„Wenn ich keinen Krieg führe, werde ich keinen Frieden haben“, seufzte er mit einem Anflug von Resignation. Seine Aussage war doppeldeutig, aber sie meinte auch beides: Dass ihm die Radikalen in den eigenen Reihen keine Ruhe lassen würden und dass er deshalb den Frieden mit den Christen nicht mehr lange erhalten konnte. Imad sah seinen Herrn einen Moment nachdenklich an.
„Der König von Jerusalem wird bald sterben. Wenn er tot ist, wird der Junge König eines Königreichs, das er nicht kontrollieren kann. Die Christen werden den Krieg bringen, den Ihr braucht“, sagte er. Wer sollte Leute wie Reynald de Châtillon wirksam unter Kontrolle halten? Imad ad-Din nahm nicht an, dass ein Baron wie Balian von Ibelin dazu in der Lage sein könnte – er war tapfer, aber unerfahren …
Kapitel 35
Macht
s ►Balian folgte dem Statthalter nach Jerusalem. Dort erhielt er den Auftrag, die Stadtmauer nach seinen Skizzen zu verbessern und machte sich sogleich daran, Material zu beschaffen und seine Männer für die Arbeiten zu instruieren und sie einzuteilen. Weder er selbst noch seine Männer waren in die Wappenröcke Ibelins gekleidet, sie alle trugen einfache Kleidung wie Handwerker. Der Wundverband, der Balians im Kampf um Kerak erlittene Kopfplatzwunde bedeckte, verschwand unter einem schwarzen Turban, der dem jungen Mann gut stand. Von der Sonne gebräunt, in ein dunkles Wams über einem dunklen Hemd gekleidet, das er statt Rüstung und Wappenrock trug, hätte er mit diesem Turban auch für einen Moslem durchgehen können.
Balian machte seinen Rundgang auf der Mauer und stockte plötzlich, als er an der Zinne eine Frau mit einer weißen Haube sitzen sah, wie Natalie sie getragen hatte. Von Größe und Gestalt hätte es ebenfalls Natalie sein können, die dort mit einem Korb Orangen saß und jedem, der vorbeikam, eine in die Hand drückte. Er spürte trotz Sibyllas Liebe wieder Sehnsucht nach Natalie. Er hatte sie nicht vergessen. Nach wie vor lebte sie in seinem Herzen weiter, in diesem sicheren Schutz vor der Hölle, als seine geliebte Frau, der er seine Liebe ohne schlechtes Gewissen hatte schenken dürfen. Er liebte Sibylla, das konnte er nicht bestreiten, aber ihn biss auch das schlechte Gewissen, schließlich war die Prinzessin eine verheiratete Frau …
Die Frau an der Mauer gab auch ihm eine Orange, und erst in diesem Moment gewahrte er, dass die Frau nicht Natalie war. Aber das Lächeln, das sie ihm schenkte, ließ auch den jungen Baron lächeln. Als er weiterging, blieb er nochmals stehen und drehte sich halb zu ihr um. Die Orange erinnerte ihn an seinen Vater, die Frau mit der weißen Haube an Natalie, die ihren Schwiegervater nie gekannt hatte. Diese Verbindung beider Erinnerungen an Menschen, die ihn geliebt hatten, ließen die Erkenntnis in Balian reifen, dass alles so gehörte, wie es war – auch, dass er nun ein Ritter und Baron Jerusalems war …
Mit der Orange in der Hand ging er weiter und sah sich die fortschreitenden Arbeiten an. Nach wenigen Klaftern, die er in Richtung Tormauer gegangen war, kam mit eiligen Schritten Almaric zu ihm.
„Mylord!“, sprach sein Hauptmann ihn an. Balian drehte sich um. Diese Anrede war immer noch ungewohnt für ihn.
„Ja?“
„Es ist schon schlimm genug, dass Ihr Soldaten Steine schieben und sie graben lasst. Aber es wäre noch schlimmer, sie Tag und Nacht damit zu beschäftigen“, hielt Almaric ihm vor. Balian sah den Hauptmann einen Moment an.
„Wir haben einen sterbenden König. Wir brauchen starke Mauern“, sagte der Baron. Seine Männer waren die einzigen, die ihm für seinen Auftrag zur Verfügung standen. Über die Jerusalem-Ritter hatte er keinen Befehl, ebenso wenig über Andere, die dem König Frondienste schuldeten. Mit wem also hätte er diesen Auftrag ausführen sollen, wenn nicht mit seinen Männern? Zudem fand Balian, dass es Soldaten nicht schadete, wenn sie etwas aufbauten. Mochten andere Adlige ihre Soldaten dafür missbrauchen, etwas zu zerstören; er, Balian, würde es lieber sehen, wenn er und seine Männer als Helfer geschätzt wurden …
„Und ebenso, wie sie hier arbeiten, will ich, dass jeder Soldat ein Handwerk lernt“, ergänzte er. Almaric sah ihn verständnislos an.
„Ein Handwerk?“, fragte er verblüfft nach.
„Ein Handwerk“, bestätigte Balian. „Schumacher, Gerber, Zimmermann, Bäcker, Schmied“, zählte er auf. Almaric schüttelte den Kopf. Ihm kam es unvernünftig vor, die Energien der Soldaten so zu verschwenden.
„Das ist unter ihrer Würde“, versetzte er. Balian lächelte. Almarics Reaktion war typisch für den Großteil jener, die sich für den Kriegsdienst entschieden hatten oder in den Adelsstand erhoben worden waren. Handwerker und Bauern waren für sie minderwertige Menschen, nur gut dazu, ihnen Nahrung, Kleidung und Obdach zu schaffen, am besten noch ohne Gegenleistung oder um sie einfach zu drangsalieren. Balian sah das anders. Für ihn waren Ritter und Soldaten dazu da, die Menschen zu beschützen, die die lebensnotwendigen Dinge produzierten oder friedlich Handel und Gewerbe nachgingen.
„Den ersten Mann, der mir ein Paar anständige Schuhe macht, mache ich zum Ritter“, sagte er und stieß Almaric scherzhaft mit der Orange an. In diesem Moment wurde Almaric klar, was Balian meinte.
„Jesus war ein Handwerker. Natürlich, nichts könnte edler sein!“
Innerlich schalt Almaric sich einen Esel. Balian hatte als Baron und Ritter selbst an der Wasserversorgung von Ibelin mit gegraben. Nein, dieser Mann hatte nicht vergessen, woher er kam und was wirklich die Aufgabe eines Ritters war …
Almarics Stellvertreter Michel überwachte die Arbeiten an der Außenmauer über dem Tor. Jetzt drehte er sich um.
„Mylord“, wandte er sich an seinen Herrn und wies nach unten. Balian und Almaric traten zu ihm.◄
Gerade kamen die Tempelritter unter der Führung Guy de Lusignans in die Stadt zurück. Sie eskortierten offenbar die Ärzte, die Saladin zu Balduins Behandlung schickte. Guy sah hoch und erkannte den Rivalen oben auf der Mauer. Ein Blick traf Balian, der geeignet war, Wasser zu Eis erstarren zu lassen, so tödlich kalt und voller Hass war er. Der Blick, mit dem Balian Guy bedachte, war nur mühsam neutral, nachdem, was er über Guys Aktivitäten mit den Templern erfahren hatte. Er mochte Guy nicht, aber er hätte von sich aus keine Konfrontation gesucht. Was er Guy wirklich übel nahm, war dessen mangelnde Wertschätzung Sibyllas. Warum schätzte er sich nicht auch persönlich glücklich, mit dieser wundervollen Frau verheiratet zu sein, statt in ihr und ihrem Sohn nur ein Instrument zur Erlangung der Macht zu sehen?
Guy und ein Teil seiner Männer geleiteten die sarazenischen Ärzte in den Palast. De Lusignan blieb vor den Gemächern des Königs und wartete, bis die Türen sich geschlossen hatten und er im Korridor allein war. Dann zog er sein Schwert und machte einsame Kampfübungen, wobei er sich vorstellte, er würde gegen Balian kämpfen. Anders konnte er seine Wut auf den Rivalen im Moment nicht abreagieren. Mit einem geschickten Stich spießte er eine Traube Weinbeeren auf, die ganz oben auf dem Früchteberg in einer Obstschale lag, warf die Traube mit dem Schwert hoch sah ihr nach und versetzte ihr dann, als sie herunterfiel, einen herzhaften Fußtritt, dass die Traube an die mosaikgeschmückte Wand klatschte. Am liebsten hätte er es gesehen, es wäre nicht eine Traube Weinbeeren gewesen, sondern Balian, den er so an die Wand schleuderte.
Während Guy seinen Frust abreagierte, haderte Reynald unten im Kerker mit seinem Schicksal. Ein ums andere Mal schreiend:
„Ich bin Reynald de Châtillon!“
lief er im Kreis durch seine knapp bemessene Zelle, stieg sogar die massiven Eisengitter hoch, dass der Wächter entnervt die dicke Holztür zuschlug, um dem irren Treiben in der Zelle nicht zusehen zu müssen.
Weit oben im Palast hatten sich Saladins Ärzte der offenen Leprageschwüre des jungen Königs angenommen. Balduin saß hinter dünnen Seidenvorhängen in seinen Gemächern, die arabischen Ärzte betupften die schwärenden Fäulnisstellen mit diversen Tinkturen, um dem Todkranken Linderung zu verschaffen. Balduin ließ die Behandlung ebenso geduldig über sich ergehen wie alle anderen Behandlungsversuche christlicher Ärzte seit seinem dreizehnten Lebensjahr, die nichts bewirkt hatten.
Außer Balduin war nur ein Christ anwesend: Heraclius, der Lateinische Patriarch von Jerusalem. Er saß mit dem Rücken zu dem Vorhang.
„Die Dinge, die wir nicht zu Ende gebracht haben, plagen uns, wenn der Tod kommt. Deshalb gibt es für die Sterbenden nichts, was ihnen Trost bringt – abgesehen von Gott“, sagte Heraclius salbungsvoll.
„Erspart mir Eure Predigt!“, wehrte Balduin brüsk ab. Er konnte diese hohlen Worte nicht mehr hören. Balduin von Jerusalem war sehr wohl bewusst, dass er nicht mehr lange zu leben hatte, aber diesem Heuchler konnte und wollte er nicht länger zuhören.
„Geht und bereitet Eure Leute auf die Krönung meines Neffen vor!“, wies er ihn dann an. Doch Heraclius wollte nicht gehen.
„Eure … Beichte, Mylord“, erwiderte er.
„Ich werde vor Gott meine Beichte ablegen, wenn ich ihn sehe, nicht vor Euch!“, knurrte Balduin. Er war sicher, dass er mit einer Beichte unmittelbar vor dem Herrn mehr Vergebung erlangen würde, als wenn er ausgerechnet diesem wenig heiligen Vertreter der Kirche beichten würde – abgesehen von dem Umstand, dass in Gestalt der arabischen Ärzte in diesem Raum einige Ohren zu viel waren …
Seufzend verließ Heraclius die königlichen Gemächer, als ihn der nächste Schreck erwartete. Guy de Lusignan trat hinter einer im Korridor befindlichen Palme hervor und hielt dem erschrockenen Patriarchen die Schwertklinge an die Kehle. Nach einem kurzen Blickwechsel zog er das Schwert wieder zurück und ließ Heraclius passieren. Der Patriarch hatte die Warnung verstanden.
Kaum war das Kirchenoberhaupt aus dem Korridor verschwunden, als Guy sein Schwert in der Scheide versenkte und heftig an die zweite Tür auf diesem Korridor hämmerte. Nach kurzem Zögern öffnete Samira, Sibyllas Leibdienerin, die Tür und wich zunächst erschrocken zurück, dass der Gemahl ihrer Herrin deren Räume betrat. Sie wusste nicht, wie sie ihm erklären sollte, dass seine Gemahlin nicht hier war. Guy begriff, kam herein und blickte die junge Frau unverhohlen lüstern an. Dass Sibylla nicht anwesend war, kam ihm sogar entgegen.
„Manchmal träumst du davon, meine Gemahlin zu sein …“, sagte er und kam auf sie zu. Samira zog sich bis zur Wand zurück, aber Guy folgte ihr.
„Gehen wir davon aus, es wäre so“, setzte er hinzu und Samira verstand. Der Herr hatte Sehnsucht … Sie lehnte sich gegen die Wand und hob ihr Gewand hoch, Guy kam ganz nahe zu ihr, lupfte sein eigenes Gewand und hob sie dann hoch, um sie zu nehmen.
Kapitel 36
Die Übereinkunft
In einem anderen Haus in Jerusalem, im Stadthaus des Barons von Ibelin, waren die Ereignisse in dieser Nacht deutlich liebevoller und zärtlicher gewesen. Nun, im Morgengrauen, flammte ein Fidibus auf, mit dem Sibylla die Kerze auf dem Nachtschrank neben Balians Bett entzündete. Dann setzte sie sich wieder auf das Bett, das sie in dieser Nacht mit Balian ebenso geteilt hatte, wie sie es in Ibelin getan hatte. Voller Liebe küsste sie den noch schlafenden Balian auf die Stirn und streichelte zärtlich durch sein Haar. Langsam erwachte er und blinzelte sie verschlafen an.
„Ich muss gehen“, flüsterte sie. „Wir dürfen uns in der Stadt nicht treffen“, setzte sie hinzu. Es tat ihr weh, ihn jetzt zu verlassen. Und noch größer war für sie der Schmerz, zu wissen, sich zu ihm in Jerusalem nicht bekennen zu können, das sah er in ihrem Gesicht. Er erlaubte sich, ihr liebevolles Streicheln einfach zu genießen.
„Dann werden wir sie verlassen“, erwiderte er ebenso leise.
„Wie sollen wir dann leben? Und wo?“, fragte sie. Balian kam nicht dazu, sie auf Ibelin hinzuweisen, wo sie ungestört ihre Liebe würden genießen können, denn sie fuhr fort:
„Balian … mein Bruder wird sterben. Mein Sohn wird König sein und ich werde seine Regentin. Ich muss für ihn herrschen – und nicht nur über Jerusalem, sondern auch über Akkon, Askalon, Beirut.“
„Und Guy?“ fragte Balian. Sibylla biss sich auf die Lippe. Warum musste er sie immer wieder an diesen Klotz am Bein erinnern? Außerdem würde sie Guy nie freiwillig die Herrschaft über dieses Land überlassen, das musste Balian doch wissen …
Der, über den Balian sprach, hatte seine Sehnsucht bei Samira gestillt und kam nun in die Räume seines Stiefsohns. Balduin junior spielte mit seinen Rittern auf dem Boden. Guy sah das Spiel des Jungen mit Wohlgefallen. Er würde bestimmt eines Tages ein guter König sein und er als dessen Stiefvater in einer Position, an der im Königreich Jerusalem niemand vorbeikam. Guy hockte sich zu Balduin und strich ihm sacht über den Kopf. Interessiert sah der Junge hoch.
„Umgib deine Ritter stets mit Fußtruppen“, gab Guy ihm einen Tipp. Das Spiel würde eines Tages Ernst sein und dann würde der Junge als Balduin V. richtige Truppen befehligen. Die Ausbildung konnte nicht früh genug beginnen, sagte sich Guy.
Sibylla kam herein und gewahrte ihren ungeliebten Gemahl nach ihrem Geschmack viel zu nah bei ihrem geliebten Sohn.
„Diese Gemächer sind nicht die Euren!“, fauchte sie Guy an. Ihr Gemahl erhob sich vom Spielplatz seines Stiefsohnes und sah sie direkt an.
„Eines Tages werde ich der Gemahl sein, zu dem ich bestimmt wurde“, sagte er mit leisem Knurren.
„Aber vielleicht auch nicht, mein Liebster“, versetzte Sibylla eisig, spie das letzte Wort wie Gift und Galle aus. Guy wusste, dass seine Gemahlin ihm nicht gerade in Liebe zugetan war, dass sie die Liebe, die ihm rechtens zustand, dem Bastard von Ibelin nur allzu freigebig schenkte. Samira hatte ihm nicht nur erzählt, wo Sibylla in der Nacht zuvor gewesen war, sie hatte ihm auch von Ibelin berichtet – und von Balians Vergangenheit als Hufschmied in Frankreich. Die über ihren neuen Herrn glücklichen Ibeliner waren sehr mitteilsam gewesen …
„Euer … Liebhaber … hat hundert Männer unter Waffen – und die Liebe des Königs. Ich habe die größte Streitmacht im Königreich und die Unterstützung der Templer. Ich kann auf die Unterstützung des Königs verzichten“, entgegnete er spöttisch.
Sibylla sah ihn erschrocken an. Er wusste also von Balian und ihr … Sie drängte sich an ihm vorbei und hockte sich zu Balduin, den sie liebevoll in den Arm nahm, wie um ihn vor Guy zu schützen.
„Aber … was Eure Liebe betrifft …“, fuhr er fort und drehte sich zu ihr um. „Dann müssen wir zu einer Übereinkunft gelangen“, sagte er, trat nahe zu ihr und Balduin junior, packte sie am Kinn, das er unnachgiebig zu sich hochzog und zwang sie, ihn anzusehen.
„Ihr braucht meine Ritter – oder seine Herrschaft wird blutig und nicht von langer Dauer!“ drohte er. Sibyllas Gesicht verriet die Panik, in die Guys unverhohlene Drohung mit Bruderkrieg unter den Christen sie versetzt hatte. Wenn sie sich bisher noch zurückgehalten hatte, waren diese Worte der letzte Anstoß, dass sie ihrem Bruder nicht nur empfehlen würde, Balian den Befehl über das Heer zu übertragen. Hier brauchte jemand einen gehörigen Dämpfer …
Kaum war Guy fort, verließ die Prinzessin wieder ihre Gemächer und eilte in den Stall, um sofort alles Nötige in die Wege zu leiten.
Kapitel 37
Eine Gewissensfrage
Balian war dem Ruf des Königs in den Palast gefolgt. Balduin hatte sich wieder etwas erholt und nach Balian geschickt. Nun, einige Zeit nach den Ereignissen von Kerak stand Balian in Rüstung und Wappenrock in den persönlichen Gemächern des Königs. Außer dem König und Balian war noch Tiberias anwesend, der mit gewisser Nervosität mit einer Kette von roten Perlen spielte. Es mochte ein Rosenkranz sein, konnte aber auch eine islamische Gebetskette sein, so genau konnte Balian das im ungewissen Licht der Kohlebecken und Kerzen nicht erkennen.
Balduin ließ den Blick wohlgefällig über den stattlichen, jungen Baron gleiten. Oh ja, er konnte Sibylla verstehen, dass sie sich auf der Stelle in diesen Mann verliebt hatte. Aber Balian war nicht nur ein gut aussehender Mann, der seiner Schwester die Liebe schenkte, die sie ihr ganzes Leben lang so schmerzlich vermisst hatte; er hatte vor Kerak auch Mut, Entschlossenheit, Führungskraft und Treue bewiesen.
„Nun, mein Freund, die Zeit ist gekommen, um meine Angelegenheiten zu regeln“, eröffnete der König, der auch wieder in einem bequemen Sessel sitzen konnte. Tiberias saß weiter rechts, Balian stand abwartend dazwischen.
„Wenn ich das Heer Guy überlasse, wird er durch meine Schwester die Macht erlangen und Krieg gegen die Moslems führen. Wir haben daher beschlossen, Euch das Kommando über die Truppen von Jerusalem zu übergeben“, erklärte Balduin. „Wirst du meinen Neffen beschützen, wenn er König ist?“, fragte er dann vertraulich und freundschaftlich. Balian war ebenso erstaunt wie erfreut über das große Vertrauen, das der König ihm entgegenbrachte. Balduin zu dienen, war ihm eine Freude.
„Was Ihr auch verlangt, ich werde es tun“, versprach er. Tiberias’ leichtes Schmunzeln konnte der junge Baron nicht recht deuten. Erst, als Balduin abwehrend die Hand hob, meldete sich erstes Misstrauen bei Balian.
„Nein, hört erst alles, bevor Ihr antwortet“, bremste der König. „Würdet Ihr meine Schwester Sibylla ehelichen, wenn sie von Guy de Lusignan befreit wäre?“, fragte er dann. Balian spürte einen dicker werdenden Kloß im Hals.
„Und Guy?“, fragte er vorsichtig. Tiberias’ Spiel mit der Kette wurde schwungvoller.
„Man würde ihn hinrichten“, erklärte er mit genussvollem Ton. „Gemeinsam mit seinen Rittern, die dir nicht die Treue schwören“, ergänzte er, die Katze aus dem Sack lassend.
Balian war entsetzt. Einen solchen Winkelzug hatte er weder von Tiberias – Freund seines Vaters – und erst recht nicht von Balduin, dem gerechten König, erwartet. Nein, das durfte nicht sein! Sein Gewissen zwickte ihn heftig. Er schüttelte mit nur knapp verborgener Abscheu den Kopf.
„Ich kann für so etwas unmöglich der Anlass sein“, erwiderte er. Tiberias grinste.
„Was Ihr auch verlangt, ich werde es tun“, wiederholte er genüsslich Balians Worte. Der ärgerte sich über seine unbedachte Wortwahl, die er aus Treue und aufrichtiger Bereitschaft, Jerusalem und seinem König bestmöglich zu dienen, gebraucht hatte. Aber wenn Tiberias ihn schon an seine naiv scheinenden Worte erinnerte, konnte er das auch tun … Er sah Balduin offen an.
„Ein König mag einen Mann fordern, habt Ihr gesagt … Aber seine Seele … gehört ihm allein“, erinnerte er den König. Balduin erwiderte Balians geraden Blick.
„Ja, das waren meine Worte“, bestätigte er.
„Ihr habt meine Liebe … und meine Antwort“, versetzte Balian. Gewiss, Sibylla heiraten zu können, war ein verlockendes Angebot, das nicht nur ihm Freude machen würde, sondern sicher auch der unglücklichen Sibylla, die in Ibelin geradezu aufgelebt war. Er liebte sie und sie liebte ihn, aber er wollte nicht über die Leiche seines ermordeten ehelichen Vorgängers an dieses Glück gelangen. Guy einfach so zu hängen, war Mord, nichts anderes. Er war ins Heilige Land gekommen, um Vergebung seiner Sünden zu erlangen, nicht um neue zu begehen! Der Plan, den der König und der Statthalter vortrugen war nicht mehr und nicht weniger als Sünde. Sollte Natalie etwa doch noch in der Hölle schmoren, weil er, Balian, einen persönlichen Vorteil in einer Sünde suchte? Kam gar nicht in Frage!
„Oohhh“, erwiderte Balduin gedehnt, „so soll es sein!“, bestätigte er dann die Gewissenentscheidung seines Vasallen.
Tiberias und Balian verließen die persönlichen Gemächer des Königs.
„Warum beschützt du Guy, he?“, fragte Tiberias verständnislos und stellte sich Balian in den Weg. „Dieser Mann beleidigt dich, er hasst dich. Er wurde dich eigenhändig töten, wenn er die Chance hätte“, warnte er. „Du kannst dieses Königreich erlösen. Wäre es denn dafür so schwer, Sibylla zur Frau zu nehmen?“, fragte er dann weiter. Dass Balian Sibyllas Liebe erwiderte, war für ihren Bruder und seinen Statthalter sonnenklar. Warum schlug er ein solches Angebot aus, das der König – bei Gott – nicht jedem machte? Sibylla zu heiraten und Jerusalem eine Hoffnung auf friedliche Zeiten zu geben, war nicht das Problem; das Problem war der Mord, der dorthin führen sollte, fand Balian.
„Jerusalem hat keinen Bedarf für einen … vollkommenen Ritter“, setzte Tiberias nach, der Balians Absicht, eben dieser vollkommene Ritter zu sein, als eher naiv betrachtete. Die Welt war nicht gut … Balian sah Tiberias einen Moment an. Galt denn das alles nicht, was sein Vater ihm sterbend gesagt hatte, was er ihm als unumstößliche Wahrheit beigebracht hatte? Wenn es wirklich nicht galt, dann war er der falsche Mann am falschen Ort. Mit diesen Methoden wollte er nichts zu tun haben. Dazu hatte ein viel zu gut funktionierendes Gewissen.
„Es ist ein Königreich des Gewissens!“, zitierte er Godfreys Worte. „Oder gar nichts!“, versetzte er eisig und ließ Tiberias einfach stehen. Der Statthalter ließ ihn gehen und sah einen Moment in die Dunkelheit Jerusalems und die Fackeln, die den Arkadengang zu Balduins Gemächern erhellten. Es schien ihm für die gegenwärtige Situation geradezu symbolträchtig zu sein. Warum musste Balian sich ausgerechnet in Jerusalems dunkelster Stunde auf sein zweifelsohne lobenswert funktionierendes Gewissen berufen? Dann fragte Tiberias sich, ob es klug gewesen war, den geradlinigen Balian in den Plan einzuweihen …
Balian hielt nichts mehr in Jerusalem. Er wollte nur noch heim nach Ibelin. Die Adligen im Heiligen Land waren wirklich nicht besser als jene in Europa. Er fragte sich, ob sein Vater einen solchen Frevel mitgemacht hätte. Eine innere Stimme sagte ihm, dass sein Vater dieses Unrecht ebenso wenig gebilligt und noch weniger mitgemacht hätte. Auch Godfrey hätte nicht anders entschieden, sagte sich Balian. Er kehrte in sein Stadthaus zurück, entledigte sich seiner Rüstung und des Wappenrocks. In Ibelin brauchte er diese Dinge nicht. Beides verstaute er im Sattelgepäck des Grauschimmels, den er als Ersatz für seinen im Kampf um Kerak gefallenen Rappen aus dem königlichen Marstall erhalten hatte.
Das Hoftor seines Anwesens wurde geöffnet und Sibylla ritt herein. Balian wollte jetzt wissen, ob sie in diesem Komplott Mitwisserin war – oder ob Tiberias und ihr Bruder diese Ungeheuerlichkeit ohne ihr Wissen eingefädelt hatten. Sie sprang vom Pferd, überließ es den Stallknechten und war schon auf dem halben Weg in den Herrentrakt, als Balian ihr aus dem Stand seines Pferdes ein Stück entgegentrat.
„Sibylla!“, rief er. Sie sah ihn, eilte zu ihm und umarmte ihn.
„Wer seid Ihr, dass Ihr Euch einem König widersetzt?“, fragte sie ihn zwar distanziert, doch zärtlich leise. Sie wollte mit ihm schmusen.
„Ich werde über dieses Land herrschen, allein oder mit Guy an meiner Seite“, stellte sie klar. „Guy wird nicht sterben, weil Ihr es verlangt oder mein Bruder. Aber wenn ich es entscheide!“
Balian entzog sich ihr wortlos und vorsichtig. Sie wusste es also! Sie wusste von dem schrecklichen Plan und sie wusste auch schon, dass er nicht mitmachte! So, wie sie ihn fragte, war es sogar ihre Idee gewesen. Und was wäre, wenn sie seiner überdrüssig wurde? Würde sie ihn dann ebenso wegwerfen, wie sie Guy offenbar wegwerfen wollte? War das die Frau, der er seine Zuneigung geschenkt hatte? Nein, entschied Balian. Die Zeit war schön gewesen – aber wenn sie diese Methoden bejahte, dann passte sie nicht zu ihm und er nicht zu ihr.
„Was wisst Ihr von Jerusalem außer, dass es Euch gehört?“, fragte er bissig. So, wie sie sich jetzt gab, war sie keinen Deut besser als die Adligen, die er in Frankreich kennen gelernt hatte. So gehörte sie zu der Sorte, die er überhaupt nicht mochte und mit der er nichts gemein hatte. Es schien ihm, als hätte sie ihm nur Theater vorgespielt …
„Ihr werdet niemals den Frieden bewahren, so wie es Euer Bruder getan hat“, grollte er. „Es wird Krieg geben“, prophezeite er düster. Und daran wollte er sich nicht beteiligen.
„Mein Großvater eroberte Jerusalem in einer blutigen Schlacht“, antwortete sie.
Sibylla meinte nicht die Eroberung durch Godfrey de Bouillon, sie meinte den Adelsaufstand, den Hugo du Puiset, ein Großonkel von Balian, angeführt hatte – und eine Schlacht, bei der sein anderer Großonkel, Balian der Alte, König Fulko von Jerusalem aus dem Hause Anjou immerhin tatkräftig geholfen hatte, nachdem er sich von seinem Bruder Hugo losgesagt hatte.
„Ich werde es ebenso halten oder auf jede Weise, die in meiner Macht steht“, fuhr sie fort. Dass diese Antwort Diplomatie einschloss, erkannte Balian nicht aus ihren Worten.
„Ich bin, was ich bin. Das biete ich Euch an – und die Welt!“, setzte sie verzweifelt hinzu. Sah er denn nicht, dass sie auch nur ein Mensch war und nicht über ihren Schatten springen konnte? Wenn ihr überhaupt jemand helfen konnte, dieses öffentliche Gesicht abzulegen, das sie zuweilen wirklich hasste, und sich auch nach außen normal zu geben, dann war er es. Aber sie fand keine Worte, um das auszudrücken.
„Ihr sagt nein?“, fuhr sie bedrückt fort, als er auf ihr Angebot nicht reagierte. Balian schüttelte langsam und mit aller Beherrschung leicht den Kopf. Sibylla sah zu ihm hoch, ihre Augen füllten sich mit Tränen.
„Denkt Ihr, ich bin wie Guy? Dass ich meine Seele verkaufen würde?“, versetzte er. Er war nahe daran zu sagen:
‚Und ich dachte, du liebst mich!’
Er schluckte es nur knapp herunter.
Sibylla hatte den gleichen Gedanken. Sie ließ ihn los – ernüchtert und recht beleidigt. Das hatte ihr noch keiner geboten! Sie drehte sich um und ging fort, blieb aber nach wenigen Schritten wieder stehen und wandte sich nochmals um.
„Es wird der Tag kommen, an dem Ihr Euch wünscht, Ihr hättet ein kleines Übel begangen, um etwas wirklich Gutes zu bewirken!“, prophezeite sie düster, dann ging sie zu ihrem Pferd zurück, stieg auf und verließ wortlos sein Stadthaus.
Balian sah ihr nach, tief getroffen von ihrer harschen Reaktion; hilflos, verzweifelt. War es denn so unbegreiflich, dass er ein Gewissen hatte und sich danach richtete? Ein Gewissen, das christliche Moralvorstellungen ernst nahm – und zwar zu allererst für sich selbst und nicht als bloße Peitsche für Untertanen? In diesen Kreisen hatte er nichts zu suchen, befand Balian und verließ eilig die Heilige Stadt, um in der Wüste wieder einen klaren Kopf zu bekommen …
Inzwischen besuchte Guy Reynald im Gefängnis. Der todkranke König hatte noch kein abschließendes Urteil gefällt und so schmachtete Reynald immer noch hinter Gittern. Guy fragte nach Reynald, der Wächter führte ihn und ließ den Gemahl der Prinzessin dann mit dem Gefangenen allein. Kaum war der Wächter fort, als Guy ein Bündel aus dem Wappenrock zog und es durch die Gitterstäbe schob. Reynald hatte schon lange nicht mehr richtig gegessen und fiel wie ein ausgehungerter Bär über das gebratene Hähnchen her, das Guy ihm mitgebracht hatte. Trotz der Entbehrungen wegen der schlechten Kerkerkost vergaß Reynald die Vorsicht nicht. Er war Mitwisser von vielen Vergehen, die Guy begangen hatte. Nichts war leichter, als einen ohnehin todgeweihten Gefangenen mit vergiftetem Proviant zu beseitigen, bevor er ausplaudern konnte, was er wusste … Er rupfte ein Stück des Brustfleisches von dem Hühnchen und reichte es Guy durch die Gitterstäbe. De Lusignan nahm es und verzehrte es vor Reynalds Augen. Erst jetzt war er sicher, dass Sibyllas Gemahl ihn nicht vergiften wollte und aß selbst mit gutem Appetit.
Reynalds ansehnliche Formen hatten im Gefängnis wohl gelitten, nicht aber seine schier angeborene Frechheit.
„Glaubt Ihr wirklich, dass der König will, dass Ihr sein Heer befehligt, wenn er tot ist? Oder dass Eure Gemahlin dies will?“, stocherte Reynald in Guys bekannter Wunde. Bedrückt schüttelte Guy den Kopf, hielt sich recht mühsam am Gitter aufrecht, so schien es Reynald. Er war zwar an der richtigen Stelle angelangt, aber Sibylla ging ihm immer mehr aus dem Weg, Balduin empfing ihn nicht mehr – und ob Tiberias ihn nicht demnächst ebenfalls samt allen Templern verhaften würde, war ein zusätzlicher Unsicherheitsherd für den ehrgeizigen Guy. Aber der größte Klotz auf dem Weg zum Thron schien ihm Godfreys Bastard zu sein …
„Ich habe ein Problem …“, seufzte Guy. Reynald nickte verstehend.
„Oh ja! Balian!“, sprach er Guys Gedanken aus. De Lusignan nickte.
„Ich sah ihn in Kerak. Er wurde gefeiert!“, stieß Reynald hervor. So viel Blut hatten gerade die Templer für den König auf Erden und jenen im Himmel vergossen – auch reichlich eigenes – aber vergolten wurden ihre kämpferischen Bemühungen um ein christliches Reich nur mit Drohungen und dem Strick … Aber dieser hergelaufene Hufschmied unehelicher und unstandesgemäßer Abstammung, der bekam jede Ehre, ohne darauf erpicht zu sein. Er war so bescheiden, dass es schon wieder unverschämt war …
„Nehmt Euch in Acht vor einem solchen Mann! Tötet ihn!“ empfahl Reynald. Guy nickte nur.
Kapitel 38
Ein letzter Traum
Raymond von Tiberias humpelte langsam durch den Palast. Sein Ziel waren die persönlichen Räume Sibyllas und ihres Sohnes.
„Was ist das?“, fragte die junge Frau ihren Sohn. Sie saßen an einem Tisch, Balduin junior hatte eine Schreibfeder in der Hand, vor ihm lag eine große Landkarte ausgebreitet, die Europa zeigte. Der Finger seiner Mutter wies auf eine Insel nördlich des Festlandes.
„England“, sagte der Junge mit heller Stimme. Sibylla nickte.
„Wer ist König?“, fuhr sie in der Abfrage des gelernten Stoffes fort.
„Richard“, sagte Balduin. „Und sein Vater war Henry*.“
„Guuut“, lobte Sibylla den Lernerfolg ihres Sohnes. „Und das hier?“, fragte sie weiter und wies auf das Festland.
„Frankreich“, antwortete Balduin. Dann sah er seine Mutter an. „Werde ich jemals Frankreich sehen?“, erkundigte er sich. Viel hatte er von Frankreich gehört, gerade von denen am Hofe, die erst kürzlich von dort gekommen waren, aber auch von Baron Godfrey, der der Lehrer seiner Mutter und seines Onkels gewesen war. Sibylla strich Balduin sanft durch das blonde Haar.
„Vielleicht, eines Tages …“, stellte sie vorsichtig in Aussicht. „Aber du musst hier König sein“, setzte sie hinzu – und das schloss weite Reisen wie etwa nach Frankreich einfach aus. Balduin würde hier in Jerusalem gebraucht werden. „Wie viele Inseln kannst du hier sehen?“, fragte sie dann weiter und wies auf die Kanalinseln. Balduin begann leise zu zählen.
Tiberias sah Mutter und Sohn lächelnd an. Eigentlich fehlte an diesem Tisch nur noch der Praktiker Balian, der Balduin nicht nur mit seinem eigenen Leben beschützen würde, sondern ihm auch technische Fähigkeiten beibringen konnte, die einem König nicht schaden würden.
„Der König will Euch sehen“, sagte er sanft. Sibylla bekam einen entsetzten Ausdruck.
„Nein, ich kann nicht. Sein Anblick ist mir unerträglich, das weiß er. Das bedeutet nicht, dass ich ihn nicht liebe“, entgegnete sie. Balduin junior hatte inzwischen bis sechs gezählt.
„Geht, Madame!“, beharrte Tiberias eindringlich. Wenn sie jetzt nicht ging, würde sie ihren Bruder nicht mehr lebend vorfinden, das wusste der alte Graf. Sibylla verstand und folgte Raymond.
Balduin blieb allein in den Gemächern der Prinzessin zurück. Kaum war seine Mutter aus dem Raum, wurde ihm langweilig, und er sah die Flamme der Öllampe interessiert an. Dann hob er seine linke Hand und hielt sie über die Flamme. Als er seine Handfläche forschend betrachtete, hatte sich eine schwarze Rußschicht darin gebildet – und eine dicke Brandblase.
Seit Balduin Balians Ablehnung erhalten hatte, hatte der letzte Rest Lebensmut den todgeweihten König verlassen. Die junge Frau fand ihren Bruder in ein Goldbrokatgewand gekleidet auf seinem Bett schlafend vor. Wie seit Jahren üblich waren Hände und Füße des Königs mit Binden umwickelt, das Gesicht unter der silbernen Maske verborgen, die er täglich im Palast trug. Sibylla setzte sich an das Lager ihres Bruders. Wie von selbst legte sich ihre Hand auf die seine. Sibylla war das älteste der Kinder Amalrichs I. und sie hatte sich auch stets für ihn verantwortlich gefühlt, obwohl er der König war. Sie wusste, dass sie für Balduin nichts mehr tun konnte, jedenfalls nichts, um sein diesseitiges Leben zu retten. Ihr wurde bewusst, dass sie seit langer Zeit zum ersten Mal wieder die Gemächer ihres Bruders betrat. Tief in ihrem Inneren wünschte sie, Balian wäre jetzt hier. Als brüderlicher Freund des Königs, dem er treu diente; als Halt für sie selbst, wenn Balduin für immer die Augen schloss. Aber Balian war nicht hier, er war in Ibelin. Sibylla fühlte sich verlassen, auch im Stich gelassen von Balian. Wie hatte er ihr das nur antun können? Unbewusst hatte sie bei dem Gedanken an Balian Balduins bandagierte Hand getätschelt. Der König wachte auf und drehte den Kopf zu ihr.
„Oh“, sagte er mit deutlichem Stöhnen in der Stimme, „hallo.“
Es schien Sibylla, als würde er lächeln, auch wenn das Lächeln durch die silberne Maske verdeckt wurde. Sie erwiderte sein hörbares Lächeln, doch es fiel gequält aus.
„Ich habe geträumt“, sagte Balduin. „Es war wieder jener Sommer, in dem ich Salahadin besiegte. Erinnerst du dich? Ich war erst sechzehn.“
Sibylla hörte seine Worte und erinnerte sich an Balduins seliges Lächeln. Er hatte einst ein ebenso schönes Lächeln wie Balian gehabt, wenn der mit ihr allein war.
Balduin nahm die Hand seiner Schwester und weidete sich an ihrem schönen Gesicht – trotz der unübersehbaren Trauerschatten und der Tränen, in denen ihre sanften, blaugrünen Augen schwammen.
„Du warst ein wunderhübscher Junge“, erwiderte Sibylla, die heftig mit den aufkommenden Tränen kämpfte. „Du warst immer wunderhübsch. In jeder Hinsicht“, flüsterte sie mit versagender Stimme.
„Meine wunderhübsche Schwester“, hauchte der sterbende König seufzend. „Ich habe dich vermisst“, sagte er, aber es war ohne jeden Vorwurf. „So wunderhübsch“, freute er sich an dem schönen, unversehrten Gesicht seiner Schwester. „Es tut mir Leid, wenn ich dir Schmerz bereitet habe“, bat er sie um Vergebung. Sibylla nickte nur. Für seine Krankheit konnte Balduin nichts, und ihre Ehe hatte er nicht zu verantworten; das hatte ihre Mutter in Allianz mit Reynald de Châtillon und dem damaligen Patriarchen von Jerusalem veranlasst. Sie hatte Balduin nichts zu verzeihen. Aber wenn er Vergebung wünschte, gewährte sie diese.
„Behalte mich in Erinnerung, als den, der ich war“, bat Balduin. Unausgesprochen forderte er sie damit auf, ihn maskiert beizusetzen. Er wollte nicht, dass Sibylla oder jemand anderes sein entstelltes Gesicht sah. Sie nickte.
„Das werde ich“, versprach sie. Tränen flossen über ihr Gesicht. Balduin spürte, dass seine ohnehin immer mehr erblindeten Augen dunkel wurden. Er drehte den Kopf in eine gerade Position, atmete noch einmal tief durch – dann stand sein Atem still. Balduin IV., König des Heiligen Jerusalem, war ganz leise zum Herrn gegangen. Ihr Bruder – dessen war Sibylla sicher – konnte reinen Gewissens vor den König des Himmels treten …
Weinend verließ sie das Sterbebett ihres toten Bruders. Ihr Sohn war der Erbe des Thronanspruches und würde demnächst König sein. Doch Sibylla wusste auch um die Machtlosigkeit einer Frau, mochte sie auch die Mutter des Königs sein. Da Balian sich nicht bereitgefunden hatte, an Guys Stelle zu treten, musste sie sich mit dem ungeliebten Gemahl in dieser Hinsicht arrangieren. Aber ein kleines Zugeständnis wollte sie ihm noch abringen …
Als sie in den Laubengang trat, schob sich Guys weißberockte Gestalt ins Licht.
„Sibylla!“, rief er – und es klang ebenso befehlend wie überheblich. Die junge Frau drehte sich um, tränenüberströmt, eingezwängt in die Trauer um ihren geliebten Bruder, verzweifelt über den Verlust des Mannes, dem sie ihr Vertrauen hätte vorbehaltlos schenken können und wollen. Für Balian wäre sie nie Königinmutter gewesen, hätte es auch nie sein wollen. Für ihn wäre sie immer nur die Frau gewesen, die ihn liebte und die zufällig die Mutter eines Königs war. Sie sah Guy einen Moment an und fragte sich, warum sie ihren Plan, Guy loszuwerden, nicht allein mit Tiberias ausgeführt hatte. Balian hätte davon nichts erfahren müssen und selbst Balduin hätte sie aus dem Spiel lassen können. Nun war es zu spät, ihr Plan gründlich schiefgegangen. Guy war da – und er hatte die Macht, die er besser nicht haben sollte.
„Wenn mein Sohn Eure Ritter hat – werdet Ihr Eure Gemahlin haben“, bot Sibylla an. Guy nickte schweigend. Er hatte, was er wollte: Die absolute Macht in Jerusalem!
Kapitel 39
Lang lebe der König
Der Tag der Bestattung des verstorbenen Königs war für Sibylla ein schrecklicher Tag. Sibylla, die als nächste Verwandte die Bestattung anordnen musste, trug ein schwarzes Kleid mit einem schwarzen Schleier. Vor der Beisetzung suchte sie ihren aufgebahrten Bruder nochmals auf und wollte noch einige Augenblicke mit dem geliebten, kleinen Bruder allein sein. Die Diener verließen die trauernde Prinzessin und blieben in respektvollem Abstand, zwar in Rufweite, aber außer Sicht.
Sibylla trat an den Katafalk, auf dem die sterbliche Hülle Balduins lag. Der Tote war in das kostbare Brokatgewand gehüllt, in dem er verstorben war. Die Prinzessin wollte schon wieder aufstehen und den Dienern ein Zeichen geben, dass sie Balduin einsargen konnten, aber dann glitt ihre Hand wie von selbst zu der silbernen Maske, die seit so vielen Jahren das Antlitz des Bruders auch vor seiner Schwester verborgen hatte. Sie hob die Maske ab – und bereute im selben Augenblick, der letzten Bitte ihres Bruders nicht nachgekommen zu sein. Balduins Gesicht war kein Gesicht mehr, es war die verweste Fratze eines Gespenstes. Anstelle der Nase waren nur noch offene, teilweise mit halbverwestem Fleisch umkleidete Luftlöcher, bloßliegende Sehnen und Zähne an der rechten Mundseite ließen vage erahnen, dass es einmal mehr gewesen war als ein Totenschädel. Das grauenhafte Bild brannte sich in das Gedächtnis der Prinzessin. Der Bruder, an den sie sich bis vor wenigen Augenblicken noch so lebhaft erinnert hatte, dass sie ihn unbedingt wieder sehen wollte, war nicht mehr …
Nachdem Balduin IV. feierlich in der Gruft der Grabeskirche zu Jerusalem beigesetzt war, wurde der Sohn seiner Schwester als Balduin V. inthronisiert. Die Grabeskirche in Jerusalem war sowohl die Grablege als auch Krönungskirche der christlichen Könige von Jerusalem. Nur Tage zuvor hatte sie trauernde Familienangehörige und Vasallen des verstorbenen Königs gesehen, nun war die Stimmung zwar immer noch feierlich-ernst, aber der Anlass bot doch eher Grund zur Freude. In festlicher Prozession zogen der künftige König, seine Mutter und sein Stiefvater mit den engsten Vasallen durch ein Spalier der versammelten Ritter und Soldaten des Königreichs Jerusalem in die Kirche ein. Balduin trug ein weißes, goldbesticktes Seidengewand, zu dem auch ein bodenlanger Umhang aus dem gleichen Material mit Hermelinbesatz gehörte.
Sibylla hatte alles getan, um ihrem Sohn die Aufregung zu nehmen, aber das weihevolle Zeremoniell war für den scheuen Jungen eine starke Belastung. Er stellte sich vor den Thron unter den Baldachin am Altar und zeigte sich den Vasallen, die – abgesehen von Sibylla, Guy de Lusignan, Raymond von Tiberias und Bruder Jean, die in den Altarraum mitkamen – vor den Stufen des Altarraumes stehen blieben. Nach dem Wortgottesdienst bezeichnete der Bischof Balduins Stirn mit dem geweihten Chrysam, dem Salböl, und sagte:
„Benedicum domine! Seht Euren rechtmäßigen König und Erben des Throns von Jerusalem!“
„Ja! Ja! Ja!“, antworteten die versammelten Vasallen im Chor.
Dann senkte der Bischof die Krone auf Balduins blondes Haupt. Die Krone Jerusalems, ein edelsteingeschmückter Goldreif, aus dem vier stilisierte Lilien zu wachsen schienen, war für den noch kleinen Kopf Balduins extra umgearbeitet worden, damit sie ihm nicht über die Ohren rutschte. Als weitere Insignien der Königswürde gab der Bischof Balduin den Reichsapfel in die rechte und das Zepter in die linke Hand. Beide Teile waren hauptsächlich aus Gold gefertigt, mit diversen kostbaren Steinen geschmückt und für den nicht einmal acht Jahre alten Jungen eine buchstäblich schwere Last, abgesehen von der Verantwortung, die nun auf ihm lastete und seine Kindheit viel zu früh beendete. Balduin schnaufte sichtlich durch – vor Aufregung und Kraftaufwand, die schweren Insignien in der Hand zu behalten. Sein Blick traf den seiner Mutter. Er lächelte scheu und bekam von ihr ein strahlendes, glückliches Lächeln mütterlicher Zuneigung zurück.
„Lang lebe der König! Möge es ihm wohl ergehen!“, rief der Bischof
„Lang lebe der König! Lang lebe der König! Lang lebe der König!“, tönte der Chor der Vasallen.
Kapitel 40
Tag der Abrechnung
Einige Zeit war seit der Krönung Balduins V. vergangen. Balian hatte sich nach Ibelin zurückgezogen, um wieder zu sich selbst zu finden und damit fertig zu werden, dass er sich in Sibylla so geirrt hatte. Ihre Liebe hatte seine durch den Tod seiner Familie verwundete Seele geheilt, aber der Schmerz, den die Trennung von ihr verursachte, war deshalb nur umso schlimmer.
Dass sie verheiratet war, war sicher eine Schwierigkeit, aber er hätte damit leben können, dass sie vor Gott einem anderen gehörte. Nach allem, was er wusste, war diese Ehe alles Mögliche, aber gewiss nicht glücklich. Wenn es Sünde war, sie zu lieben, weil sie mit Guy de Lusignan verheiratet war, mochte das so sein. Außereheliche Verhältnisse waren Sünde, aber in Adelskreisen auch nicht gerade selten. Aber war es nicht eine viel größere Sünde gewesen, ihr den Mann einfach aufzuzwingen? Schon das war nicht das, was Balian als gerecht, angemessen und den Geboten entsprechend empfand, mochte es auch kein Gebot geben, das Zwangsehen ausdrücklich verbot. Natalie und er hatten einmal geheiratet, weil sie sich geliebt hatten, nicht weil Natalies Eltern Balian speziell ausgesucht hatten. Gewiss, einen für die ärmlichen Verhältnisse des Dorfes eher wohlhabenden selbstständigen Schmiedemeister als Schwiegersohn zu haben, war nicht gerade ein Nachteil gewesen, aber deshalb hatten sie Natalie noch längst nicht genötigt, ihn zu ehelichen. Mit welchem Recht nahm sich eine Mutter eigentlich heraus, ihrer Tochter einen Mann auszusuchen? Er hatte gehört, dass es in den Adelsfamilien dynastische Überlegungen gab, die es angeblich rechtfertigten, eine junge Frau zwangsweise mit einem jungen, zuweilen auch alten Mann zu verheiraten. Bei Guy konnte man da durchaus geteilter Meinung sein. Seine Familie war aus Poitou und dort der Familie Anjou-Plantagenet lehenspflichtig. Dass die Verheiratung mit einem Vasallen der eigenen Familie dynastische Vorteile brachte, war für Balian nicht recht ersichtlich.
Was ihn aber wirklich erschreckt hatte, war der Umstand, dass Sibylla Guy hätte töten lassen, um für ihn, Balian, frei zu sein – und das war nicht die Handlungsweise, die er als richtig empfand. Nein, das war eines Königreichs des Gewissens nicht würdig, erst recht nicht einer Frau, die es nach seiner Liebe verlangte! In Jerusalem hatte er so lange nichts zu suchen, wie dort eher Verhältnisse wie in Sodom und Gomorrha herrschten … Ibelin, dieses kleine Paradies westlich von Jerusalem, diese ideale kleine Welt, in der Christen, Juden und Moslems friedlich miteinander lebten, gab ihm Halt und eine sinnvolle Aufgabe.
Doch hin und wieder musste er allein sein. Nicht weit von seinem geliebten Ibelin erstreckte sich ein Erg, eine Felswüste, in der nur noch karge Dornbüsche wuchsen. Balian ritt allein hinaus, ließ sein Pferd laufen, setzte sich am Rand eines tief eingeschnittenen Wadis auf den blanken Boden und grübelte. Eher unbewusst warf er Steine auf einen etwas entfernten Dornbusch.
„Man darf in das Licht sehen, bis man das Licht wird. Ich hab’ es oft getan“, hörte er Jeans Stimme hinter sich. Balian reagierte nicht auf die unerwartete Anwesenheit des Johanniters. Jean war schon häufiger unerwartet aufgetaucht, ohne dass Balian ihn hatte kommen hören. Er warf weiter Steine auf den Dornbusch. Einer traf auf einen Feuerstein, ein Funke schlug über – und setzte den Dornbusch, einen Kreosotebusch, in Brand. Der erstaunliche Effekt entlockte dem jungen Baron ein spöttisches Lachen.
„Das ist Eure Religion! Ein Funke, ein Dornenbusch!“, stieß er hervor und stand auf. „Das ist Euer Moses! Ich hab’ ihn nicht sprechen hören“, versetzte er. Balian war ein nüchterner Techniker, der bestimmten Phänomenen gern auf den Grund ging, kein abergläubischer Dummkopf. Für das, was in der Bibel als Wunder beschrieben wurde – ein Dornenbusch, der scheinbar ohne äußeren Anlass aufflammte – gab es eine natürliche Erklärung, nämlich die Öle, die ein solcher Dornbusch absonderte, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Jean blinzelte im hellen Sonnenlicht.
„Das heißt nicht, dass Gott nicht existiert“, entgegnete er. Balian schien in dieser Hinsicht unverbesserlich zu sein, aber Jean war nicht der Mann, der aufgab, ihm zu verdeutlichen, dass Gott sehr wohl existierte, Balian ebenso sehr wohl kannte und als eines seiner Geschöpfe liebte.
„Liebt Ihr sie?“, fragte er dann. Balian war verblüfft, dass Jean von Sibylla und ihm zu wissen schien. Diese Tatsache zu leugnen, entsprach weder seinem Wesen noch dem Rittereid.
„Ja“, sagte er und sammelte seinen Schwertgürtel auf, den er abgelegt hatte. Jean nickte. Bei Balians Vorgeschichte war ihm klar, wie sehr ihn Sibyllas harsche Reaktion auf seine Gewissensentscheidung getroffen haben musste.
„Euer Herz wird sich erholen“, tröstete er den jungen Mann, wohl wissend, dass es seine Zeit brauchen würde. „Kümmert Euch jetzt um die Menschen dieser Stadt“, sagte er dann. Jerusalem brauchte diesen jungen Ritter – und er musste wieder unter Menschen. Balian nickte ergeben. Arbeit konnte in gutes Mittel sein, um den Kummer zu vergessen …
„Ich werde beten“, sagte Jean. Balian sah ihn verblüfft an.
„Wofür?“, fragte er.
„Für die Kraft, um das zu ertragen, was kommen wird“, erwiderte Jean geheimnisvoll.
„Und was wird kommen?“, erkundigte sich Balian, der nicht wusste, worauf Jean hinauswollte.
„Die Vergeltung wird kommen für das, was hier vor hundert Jahren geschehen ist. Die Moslems werden das niemals vergessen. Und das sollten sie auch nicht“, sagte Jean. Balian wusste von Jean, dass die Christen, die 1099 Jerusalem erobert hatten, ein entsetzliches Blutbad unter den Bewohnern Jerusalems angerichtet hatten. Die ersten Kreuzritter unter dem Kommando von Godfrey von Bouillon hatten nicht nur Moslems und Juden niedergemacht, sie hatten auch Christen orthodoxen Glaubens abgeschlachtet. Jeans Worte waren eine eindringliche Mahnung an Balian, dass sich die Moslems für dieses Gemetzel in gleicher Art rächen würden, wenn es ihnen gelingen sollte, Jerusalem zu erobern.
Während er sich das noch vergegenwärtigte, machte ihn ein seltsames Geräusch aufmerksam. Er drehte sich um und sah, dass ein etwa einen Klafter neben dem brennenden Busch befindlicher Dornbusch ebenfalls aufgeflammt war. Balian wunderte dies nun doch. Der Busch war zu weit entfernt, als dass die Flammen vom ersten einfach hätten überspringen können. Als er sich wieder umwandte, war außer ihm und seinem Pferd niemand mehr am Rand des Wadis. Verblüfft sah sich der junge Mann um. Keine Spur von Jean …
Plötzlich scheute sein Schimmel, als ob er von etwas Unsichtbarem berührt worden war … Balian begann sich zu fragen, was hier gerade geschehen war. Hatte er das eben nur geträumt? Hatte er Halluzinationen?
War es ein Traumbild gewesen? Eine Fata Morgana? Oder doch ein Engel Gottes …
Kapitel 41
Der Schmerz einer Mutter
Balduin saß in dem großen königlichen Arbeitszimmer am Schreibtisch neben seiner Mutter. Klein, wie er war, reichten seine Beine noch nicht bis auf den Boden. Gelangweilt ließ er die Beine schaukeln und wünschte sich ganz weit weg von diesem Tisch. Die Briefe zu unterschreiben und zu siegeln, die seine Mutter in recht großer Zahl schrieb, war einfach furchtbar langweilig. Viel lieber hätte er jetzt mit seiner Bleiritterarmee gespielt …
Sibylla hatte gerade eine Botschaft an Saladin fertig geschrieben. Patriarch Heraclius, der sich in der Position des Beraters sah, hatte den Brief gelesen.
„Mylady, Euer Brief an Salahadin …“, setzte er an. Sibylla sah ihn fragend an. „Der Frieden soll gewahrt werden, die Grenzen respektiert und der Handel weiterhin erlaubt …“, zitierte er laut aus dem Schreiben. „Ist das klug, Eure Absichten so offen zu zeigen?“, wandte er ein. „Es wäre besser, wenn wir ihn … in Unwissenheit lassen“, empfahl er dann. Sibylla wandte sich demonstrativ von ihm ab.
„Wir bewahren den Frieden meines Bruders“, sagte sie entschieden. Sie hatte mehrere Gründe, das Königreich im Sinne ihres Bruders fortzuführen. Erstens hatte sie ihren Bruder geliebt und seine Auffassung von Politik dank der Lehren Baron Godfreys geteilt, auch wenn sie nach außen hin vielen als die in den Tag hinein lebende Prinzessin erschienen sein mochte, die Politik nicht interessierte. Zweitens hatte nur die lange Friedenszeit der Regierung Balduins überhaupt zu einer Konsolidierung des Reiches führen können. Drittens wäre eine kriegerische Auseinandersetzung zum jetzigen Zeitpunkt äußerst ungelegen. Zunächst musste wieder Einigkeit unter den Christen herrschen, bevor man überhaupt in Betracht ziehen konnte, sich mit den Sarazenen Erfolg versprechend gewaltsam auseinandersetzen zu können. Und viertens … viertens hatte Balian angezweifelt, dass sie den Frieden ihres Bruders bewahren würde. Schon seinetwegen und um seiner Liebe willen wollte sie den Beweis antreten, dass sie die Ideale ihres Bruders, die auch Balians Ideale waren, ungeschmälert übernommen hatte. Es würde ihm auch beweisen, dass sie klug genug war, einen Rat anzunehmen, mochte er auch aus Kritik erwachsen sein. Jedem anderen hätte sie solche Kritik übel genommen, bei Balian konnte sie es einfach nicht …
Sie reichte den Briefbogen zu Balduin, der neben ihr saß.
„Unterschreib“, sagte sie leise. Der kleine König tunkte die Feder in das Tintenfass und schrieb sorgfältig seinen Thronnamen unter den Brief.
„Nimm das Siegel“, wies seine Mutter ihn an. Balduin nahm das große Petschaft, das fast so lang war wie sein Unterarm und hielt es in der Hand, bereit, das Siegel in den Siegellack zu drücken. Wortlos bedeutete Sibylla einem der Diener, den flüssigen Siegellack auf das Pergament zu gießen.
„Gib Acht“, warnte sie ihren Sohn vor der heißen Flüssigkeit. Der Diener goss etwas Siegellack auf den Brief, zog den Behälter wieder weg, einige Tropfen fielen neben das Pergament – direkt auf Balduins rechte Hand. Der Junge sagte nichts, sondern drückte das Siegel mit der linken Hand kräftig in den Siegellack.
„Mein Liebling, das reicht“, sagte Sibylla leise und half ihrem Sohn, das Petschaft aus der schnell erstarrenden Masse zu ziehen. Ihr Blick begegnete dem des Patriarchen. Beide sahen sich ebenso verstehend wie entsetzt an. Wenn Balduin den heißen Siegellack nicht auf der Hand spürte, dann …
Sie beschloss, der Sache sofort auf den Grund zu gehen. Saladins Ärzte waren im Palast, und so konsultierte die junge Frau die Ärzte, die auch sofort eine Untersuchung des Jungen durchführten. Einer der Diener lenkte Balduin ab, indem er ihm mit einer Fingerpuppe eine Geschichte vorspielte, während ein Arzt mit einer Nadel an verschiedenen Stellen in Balduins Fuß stach. Balduin zeigte keine schmerzhafte Reaktion, sondern amüsierte sich königlich über die Fingerpuppe und lachte ausgelassen.
Der Blick des Arztes traf den Sibyllas, die sich verzweifelt an die Wand drängte, sich schier daran festhielt und nicht wahrhaben wollte, was der Arzt ihr mit dem Blick bedeutete: Sie hatte sich nicht geirrt! Balduin hatte Lepra! Sibylla war dem Zusammenbruch nahe und rutschte langsam an der Mosaikwand herunter. Nein, das durfte nicht wahr sein! Nicht ihr geliebter Sohn Balduin!
Sie wusste kaum wohin mit ihrem Schmerz. Voller Bitternis und Trauer zog sie sich in ihre Gemächer zurück, um wieder zur Ruhe zu kommen und nachzudenken.
Nicht lange darauf kam Raymond von Tiberias zu ihr. Dem Statthalter war das lauter werdende Gerücht nicht entgangen, dass Balduin krank war. Er war nie von stabiler Gesundheit gewesen, das war bekannt, aber jetzt … jetzt murmelte man von schlimmer Krankheit …
„Es kursiert ein Gerücht“, sagte der alte Graf, als er die Räume der Königinmutter betrat. Sie hatte kein Interesse an einem Gespräch darüber. Verbissen schrieb sie an dem Brief weiter, den sie gerade in Arbeit hatte.
„Nennt es Verrat … und tötet die, die es verbreiten!“, knurrte sie unwillig. Doch Tiberias war nicht der Mann, der Menschen nur deshalb tötete, weil sie sich Gedanken um ihren König und dessen Gesundheit machten. Er kam an den Tisch und stützte sich darauf ab.
„Das Gerücht wird sich legen, wenn wir der Welt zeigen, dass der Junge aktiv ist“, widersprach er.
„Aarrgh!“
Mit einem wütenden Aufschrei sprang Sibylla auf, dass ihr Stuhl umfiel und geräuschvoll auf den Marmorboden krachte.
„Und wann wird er eine Maske tragen?“, schrie sie zornig. „Werdet Ihr eine für ihn anfertigen lassen?“, schleuderte sie dem Statthalter entgegen. Das entstellte Gesicht ihres Bruders hatte sich tief in ihr Gedächtnis gebrannt. Um nichts in der Welt wollte sie zulassen, dass ihr geliebter Sohn ebenso von Lepra zerfressen ein einsames und unwürdiges Dasein fristen musste.
„Womit hat mein Junge … das verdient?“, fragte sie voller Verzweiflung. Sie kannte wie ihr Bruder die Annahme der Araber, dass die Lepra Gottes Strafe wider die Eitelkeit des christlichen Königreichs war – aber Balduin war ein unschuldiges Kind, das niemandem etwas getan hatte, das niemandem etwas Böses wollte. Er regierte ja nicht einmal selbst, sondern wurde dabei von seiner Mutter vertreten. Nein, so grausam konnte Gott doch nicht sein, dass er ein unschuldiges Kind mit einer so schrecklichen Krankheit strafte!
Tiberias bemerkte, dass sie verzweifelt nach einem Ausweg für ihren Sohn suchte, dass sie ihm dieses schreckliche Schicksal ersparen wollte. Er wollte ihr nicht noch mehr Kummer bereiten, indem er sie noch zusätzlich unter Druck setzte. Er schüttelte den Kopf und brummte entschuldigend.
„Jerusalem ist tot, Tiberias!“, keuchte Sibylla. „Kein Königreich ist es wert, dass mein Sohn die Hölle durchlebt. Ich werde stattdessen zur Hölle gehen!“
Raymond kam zu ihr und umarmte sie und wiegte sie tröstend wie ein Vater die weinende Tochter. Sie ließ ihren Tränen in den Armen des alten Grafen freien Lauf. Es gab nur wenige Menschen, denen sie so vertraute, dass sie sich diese Emotionen in ihrer Gegenwart erlaubte. Sie war mit ihrer Nervenkraft am Ende und war froh, dass Tiberias da war, um ihr Halt zu geben.
Balduin selbst bekam vom Kummer seiner Mutter nichts mit. Um wieder etwas Abstand zu der für ihn langweiligen Repräsentation des Königreichs zu bekommen, zogen Mutter und Sohn sich in das Landhaus zurück. Balduin spielte weltvergessen mit seinen Bleirittern auf der Terrasse des Landhauses und bemerkte kaum, dass seine Mutter immer stiller wurde, sich immer mehr in sich zurückzog.
Umso mehr wunderte er sich, als sie sich mit seinem Lieblingsritter in der Hand – ein Geschenk seines Onkels Balduin – zu ihm hockte und fragte:
„Erinnerst du dich an die Geschichte von Louan?“
„Nein“, erwiderte er. Das sagte ihm gar nichts.
„Weißt du noch, warum?“, fragte Sibylla ihn weiter. Er schüttelte den Kopf.
„Nein.“
„Er … war so einsam, dass er alle Götter rief“, erzählte sie.
„Wieso?“, fragte Balduin, nun doch interessiert.
„Weil er verzweifelt war. Als Beweis seiner Liebe“, erklärte sie.
Sibylla gönnte ihrem Sohn Ruhe und Entspannung. Wie jeden Abend legte er sich in ihrem Arm zum Schlafen und lauschte dem leisen, französischen Schlaflied, das sie ihm sang. Vertrauensvoll überließ sich der Junge dem friedlichen Schlaf, dicht an seine Mutter gekuschelt. Ohne hinzusehen, entkorkte sie eine Phiole und träufelte ihm unter bitteren Tränen ein schnell wirkendes Gift ins Ohr. Balduin zuckte nur noch einmal, dann war er tot.
Die Phiole entglitt der Hand seiner bitterlich weinenden Mutter und fiel zu Boden, rollte zu dem kleinen Bleiritter, den Balian im Palast repariert hatte. Selbst der Himmel schien zu weinen, denn der kleine Bleiritter stand mitten im strömenden Regen …
Kapitel 42
Der Angriff
Balian hatte seine Ländereien bereist und war auf dem Rückweg nach Ibelin. Er war allein, in einfacher Kleidung, ganz unauffällig. An einer verfallenen Karawanserei machte er Rast. Nachdem er und sein Pferd sich sattgetrunken hatten, setzte er sich in den Schatten einer Palme, um die heißeste Zeit des Tages zu verdösen. Sein Pferd, ein hitzegewohnter Araber, hatte sich langsam in die Nähe der etwa drei Ellen hohen, restlichen Trockenmauer entfernt. Balian, der halb schlief, hatte es nicht bemerkt.
Das Geräusch von Hufen, von Hufen eines scharf gezügelten Pferdes, störte den jungen Mann aus seiner Siesta auf. Er fuhr hoch und sah einen voll gerüsteten Ritter, über dem Kettenhemd einen weißen Waffenrock mit einem schwarzen Nagelkreuz, der mit gezogenem Schwert an einem der drei Zugänge in der Mauer stand. Der Mann trug einen Topfhelm – das Gesicht war nicht erkennbar, aber das höhnische Lachen verbarg der Helm nicht, als Balian sich nach seinem Pferd umsah, an dessen Sattel er Schwert und Schild hängen hatte. Das Tier stand wenigstens zehn Klafter entfernt – unerreichbar! Ein zweiter Ritter, der ebenso ein Nagelkreuz auf dem Waffenrock trug, erschien an einem zweiten Zugang zu dem Brunnenbereich, ein dritter war im Anmarsch.
Balian reagierte schnell und in einer für den ersten Angreifer sehr unerwarteten Weise: Er griff sich einen etwas über faustgroßen Stein, der neben ihm am Boden lag und stürmte damit auf den ersten Ritter zu, schlug so heftig mit der steinbewehrten Faust in die Metallmaske seines Kontrahenten, dass der nicht nur gestoppt, sondern aus dem Lauf zurückgeworfen wurde. Balian schlug weiter mit dem Stein – und zwar im Vorwärtsgang, drängte den verwirrten Nagelkreuzler bis an den Brunnenrand, wo der Stein unter den heftigen Schlägen mit einer kräftigen Schmiedefaust an dessen Helm zerbrach. Balian, nun waffenlos, bekam einen Schlag mit der gepanzerten Faust, ging kurz zu Boden, schnappte sich dort aber einen samt Henkel abgebrochenen Teil eines Krugs und drosch weiter auf den Angreifer ein.
Der zweite bemerkte die Bedrängnis seines Ordensbruders und griff Balian mit dem Morgenstern an. Doch der junge Baron bemerkte den Angreifer rechtzeitig, drehte den von den Steinschlägen ziemlich benommenen Templer in die Schlagbahn des Morgensterns. Der aus dem vollen Galopp geschwungene Morgenstern traf den unglücklichen ersten Nagelkreuzler mit voller Wucht und tötete ihn auf der Stelle. Den zweiten Angreifer riss Balian mit einem beherzten Griff vom Pferd, dass er bewusstlos zu Boden ging und liegen blieb. Balian riss dem zweiten Mordbuben das Schwert aus der Scheide, trat ihm so heftig auf den Kehlkopf, dass der Mann sofort tot war und wehrte sich mit dem Beuteschwert gegen den dritten Angreifer.
Der dritte sprang vom Pferd und ging zu Fuß zum Angriff über.
„Seid Ihr deswegen ins Heilige Land gekommen?“, schrie Balian voller Zorn. „Los, macht schon!“
Der dritte Ritter griff an. Die Attacke mit dem Morgenstern wehrte Balian mit dem als Kampfstock gehaltenen Schwert ab, entriss dem Nagelkreuzler die Waffe, der darauf zum Schwert griff, mit dem er offenbar sehr viel besser umgehen konnte. Er erwies sich als geschickter Schwertkämpfer. Balian – schon erschöpft vom Kampf mit den beiden anderen Angreifern und den Hieben, die er hatte einstecken müssen – konnte die Hiebe seines Kontrahenten nicht ganz abwehren und konnte auch dessen geschickte Schilddeckung nicht durchbrechen. Nach einem harten Hieb des Nagelkreuzlers gegen seinen Kopf ging Balian zu Boden. Der Angreifer warf Schwert und Schild beiseite, wollte Balian erwürgen, doch schnappte der Baron sich dessen Dolch, riss ihn heraus und rammte ihn dem Angreifer durch den Sehschlitz seines Helms ins Auge. Auch der dritte Angreifer brach tot zusammen, aber der heftige Kampf und die Hiebe, die er hatte einstecken müssen, forderten ihren Tribut von Balian: Er fiel zurück und blieb bewusstlos liegen. Blut lief ihm aus dem linken Ohr und einer Platzwunde an der linken Schläfe, bildete einen kleinen See im heißen Sand.
Die Nachrichten, die Guy erhalten hatte, bestätigten ihm, dass er den verhassten Rivalen endlich los war. Nun, fand Guy, war es Zeit, seinen treuesten Bluthund wieder auf die richtige Spur zu setzen. Höchstselbst suchte er Reynald im Kerker auf.
„Lass uns allein!“, wies er den Wächter an, der sich auch gehorsam zurückzog, nachdem er die Zelle aufgeschlossen hatte. Reynald hielt sich mit Schreittänzen und einer Art Schattenboxen bei Kräften und umkreiste Guy in seiner Zelle wie ein Storch, der durch den Sumpf watete.
„Ist der Junge im Himmel?“, fragte er.
„Ja“, antwortete Guy.
„Seine Mutter hat mehr Rückgrat als ich“, bemerkte der Gefangene und stelzte weiter um Guy herum.
„Sie ist in der Krypta und will sie nicht verlassen“, sagte Guy. Seit Balduin tot war, hatte sie sein Grab nicht verlassen. Guy war weiter von einer Ehe entfernt, wie er sie sich vorstellte, als in den Tagen, in denen Balian Sibyllas Liebhaber gewesen war…
„Haben die Templer Balian umgebracht?“, fragte Reynald, seinen Storchengang fortsetzend.
„Ja“, grunzte Guy. Dann sah er Reynald direkt an.
„Reynald … Gebt mir einen Krieg!“, forderte er und überreichte Reynald dessen Waffengürtel. De Châtillon nahm ihm den Gürtel samt Schwert mit einer leichten Verbeugung ab, wiegte sein Schwert wie ein Kind in den Armen und grinste, als er sagte:
„Das ist es, was ich tue.“
*** In einer verlassenen, verwüsteten Karawanserei fand Johanniterbruder Jean nicht nur drei tote Ritter, deren Nagelkreuzrock Jean schnell an Nahtspuren als getarnte Templerröcke identifizieren konnte, sondern auch den bewusstlosen Balian, der blutend und fast verdurstet in der heißen Sonne lag. Jean kniete neben ihm nieder, streckte den Finger aus und berührte ihn sanft an der linken Schläfe. Ein Lächeln zeigte sich auf dem Gesicht des Johanniters, als Balian sich regte und dann langsam zu sich kam. Als Balian die Augen aufschlug und Jean erkannte, fragte er sich zum wiederholten Mal, wer oder was dieser Ritterbruder eigentlich wirklich war … Nur ein Engel Gottes oder der Herr der Welt selbst …
(*** Siehe Glossar)
Kapitel 43
Königin von Jerusalem
Nachdem mit Balduin V. schon der zweite König in überaus jungem Alter verstorben war, durfte das Reich nicht lange ohne einen neuen König sein. Jeder im Königreich Jerusalem hoffte, dass dem neuen König eine längere Regierungszeit beschert sein möge als Balduin V., der gerade eineinhalb Jahre der König gewesen war. Dass er regiert hatte, konnte man nicht sagen, schließlich war Balduin nicht mündig gewesen und seine Mutter die Regentin gewesen.
Eigentlich war mit Balduins erbenlosem Tod ein Fall eingetreten, den sein Onkel testamentarisch geregelt hatte. Für diesen Fall hatte Balduin IV. bestimmt, dass die Könige von England und Frankreich, der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und der Papst den neuen König Jerusalems erwählen sollten. Doch diese Bestimmung hatte den Haken, dass es sehr lange dauern würde, um diese Wahlberechtigten zu informieren und deren Entscheidung einzuholen – nicht eingerechnet die Zeit, die sie brauchen würden, um sich auf einen Kandidaten zu einigen. Bei den Querelen zwischen Kaiser und Papst und zwischen den Königen von England und Frankreich bestand die Möglichkeit, dass entweder der Jüngste Tag angebrochen war, bevor sie einen König von Jerusalem einsetzten oder dass Saladin Jerusalem erobert hatte …
Die aus Frankreich stammenden Könige Jerusalems hatten die französische Tradition mitgebracht, dass auch eine Frau den Thron erben konnte. Durch eben diesen Umstand war die Krone an Balduins Großvater Fulko gekommen, der mit Melisende, der einzigen Tochter König Balduins II., verheiratet gewesen war. Nicht alle hatten akzeptieren wollen, dass Fulko den Thron durch seine Gemahlin bekommen hatte, darunter Hugo du Puiset, Balians Großonkel. Doch dessen Bruder Balian, genannt der Alte, hatte sich gegen seinen eigenen Bruder gestellt und dem König beigestanden. Der Lohn für seine Treue zum König aus dem Hause Anjou war der Titel des Barons von Ibelin gewesen …
Sibylla, die als Schwester von Balduin IV. den Erben seines Thrones geboren hatte, war noch jung und konnte noch weitere Kinder haben, die die Linie des Hauses Anjou fortsetzen konnten. Doch sie steckte in einem ähnlichen Dilemma wie einst Melisende von Bouillon: Für Sibylla war die Tradition problematisch, dass eine Königin die Regierungsgeschäfte nicht allein führen sollte. Geschrieben stand das nirgends, es war in der christlich-patriarchalischen Gesellschaft des immer stärker blühenden Feudalismus einfach so, dass ein Mann Träger der tatsächlichen Macht war. Schließlich war Gott doch auch ein Mann – davon war jeder im Heiligen Land felsenfest überzeugt, auch wenn noch niemand Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hatte, aus dem Himmel oder aus der Hölle auf die Erde zurückgekehrt war. Und Jesus war doch auch ein Mann gewesen, hatte nur Männer als Apostel ausgesandt – doch, es war einfach richtig, dass nur ein Mann Herrscher über ein Volk sein konnte. In dieser Hinsicht waren sich männliche Juden, Christen und Moslems ausnahmsweise sogar einmal einig …
Die Jerusalemer Grabeskirche war gesteckt voll. Fast alle Barone des Königreichs Jerusalem waren versammelt, um an der Krönung der neuen Königin und der möglichen Erwählung des neuen Königs teilzunehmen. Patriarch Heraclius krönte Sibylla daher zunächst als Erbin des Throns.
„Seht Eure rechtmäßige Königin, und Erbin des Throns des Königreichs Jerusalem“ rief er, als er den mit Goldbrokat gefütterten Reif der Königin auf Sibyllas Haupt senkte.
„Ja! Ja! Ja!“, riefen die Barone und Ritter im Chor.
Sibylla erhob sich, nahm die auf dem verwaisten Thron ihres Bruders liegende Königskrone und hielt sie hoch, dass jeder sie sehen konnte.
„Ich, Sibylla, wähle durch die Gnade des Heiligen Geistes als König … Guy de Lusignan, den Mann, der mein Gemahl ist!“, verkündete sie laut.
Guy trat zu ihr, nahm auf dem Thron Platz und sah Sibylla erwartungsvoll an, als sie ihm die Krone auf das Haupt setzte.
„Mit Gottes Hilfe wird er sein Volk gut regieren“, schloss sie die Zeremonie dann ab. Ob Guy wirklich auf Gottes Hilfe vertrauen würde, oder ob er eher seine eigenen, meist fanatischen und zuweilen ganz und gar unchristlichen Gedanken mit Gottes unerforschlichem Ratschluss verbrämen würde, war die Frage, die offen bleiben musste – für Sibylla wie für Tiberias, der gehorsam in den Chor der Vasallen einstimmte:
„Lang lebe der König! Lang lebe der König! Lang lebe der König!“
Kapitel 44
Geliebte Schwester
Reynald und seine Templer taten, was sie konnten, um den Wunsch König Guys zu erfüllen, einen Krieg vom Zaun zu brechen. Niemand war vor ihnen sicher, der auch nur den Anschein erweckte, Moslem zu sein; am gefährdetsten waren die langsamen Karawanen der Sarazenen.
Einige Zeit nach Beginn der verstärkten Überfälle hatte Reynald mit seinen Templern eine Karawane sogar im Rastlager einer von Moslems bewohnten Oase angegriffen. Es war eine blutige Angelegenheit gewesen. Die weißen Wappenröcke zeigten erheblich mehr Rot als nur das rote Tatzenkreuz ihres Ordens, ihre Gesichter und Rüstungen waren ebenfalls blutbespritzt – allerdings nicht vom eigenen Lebenssaft. Einige steckten Zelte an, andere vergaßen ihr Mönchsgelübde und vergewaltigten überlebende Frauen, um sie danach zu ermorden; zwei schleppten einen Gefangenen zu einem großen Tontopf, den sie als Schafott umgedreht hatten, einer zwang den Mann darauf, der andere hieb ihm mit dem Schwert den Kopf ab.
Reynald war kein Mann, den das Gewissen frühzeitig biss, aber dieser Überfall stimmte selbst diesen Mann nachdenklich. Er stieg blutverschmiert über die Leichen der niedergemetzelten Karawanenreisenden und der muslimischen Bevölkerung der Oase und hatte das dunkle Gefühl, dass er eines Tages für das, was er im Auftrag Guys, der Kirche und des von ihm unterstützten Ordens getan hatte und noch immer tat, zur Rechenschaft gezogen werden würde – von den Sarazenen oder gar von Gott selbst. Reynald begann zu zweifeln, dass es richtig war, was er tat.
„Ich bin was ich bin. Jemand muss es sein!“, murmelte er müde und fatalistisch. Er war Guys Bluthund … Er hatte es sich selbst ausgesucht … Sein Hauptmann, den ihm Großmeister de Ridefort persönlich als ebenso willigen Helfer wie als Aufpasser an die Seite gestellt hatte, wies Reynald auf eine in einem Kornfeld kniende Gestalt hin.
„Das ist Salahadins Schwester“, sagte der Mann. Reynald blinzelte in die tief stehende Sonne zu der schwarz verhüllten Frau.
„Ich weiß“, sagte er und stieg über am Boden liegende Trümmer und weitere Leichen zu ihr hin. Ihre Anwesenheit in der Karawane war eben der Grund gewesen, weshalb Reynald hier wirklich keinen Überlebenden zurücklassen wollte. Wenn der Überfall auf diese Karawane noch immer keinen Krieg auslöste, dann musste Saladin entweder ein ungeheurer Feigling sein – oder ein noch größerer Friedensengel als Balian von Ibelin.
Die Schwester Saladins hatte mit ihrem Leben bereits abgeschlossen. Diese ungläubigen Mordbuben würden niemanden am Leben lassen, das war ihr klar. Allenfalls würde man sie als Schwester des Sultans gefangen nehmen – aber ob es besser war, in einem stinkenden Kerker als Geisel zu schmachten oder jetzt gleich zu sterben, war eine andere Frage. Sie beendete ihr Gebet und stand auf. Nein, davonlaufen würde sie nicht. Chancen dazu hatte sie ohnehin keine. Aber sie würde mit Stolz sterben. Allah und ihr Bruder Saladin würden diese Christenhunde zur Rechenschaft ziehen. Sie konnte in Frieden zu Allah ins Paradies gehen.
Reynald war überrascht über den Mut, den diese Frau zeigte. Sie stand kerzengerade vor ihm und sah ihn stolz an, als sie ihm auf Arabisch sagte, dass Saladin ihr Bruder sei.
„Ich weiß“, seufzte Reynald und riss ihr als Akt der Entehrung den Schleier vom Gesicht. Dann griff er zum Dolch und stieß zu.
Drei sarazenische Reiter hielten auf das Jerusalemer Damaskustor zu und wurden als Parlamentäre eingelassen. Wenig später war König Guy über den Boten von Saladin unterrichtet und kam – noch einen Weinkelch in der Hand – in den Innenhof, in dem einige Templer, die Palastwache im Jerusalemrock sowie deren Befehlshaber Tiberias versammelt waren. Mit hochmütigem Gesichtsausdruck gab Guy seinen Kelch einem Diener.
„As-Salam ’alaykum!“, grüßte er den Boten mit seinem üblichen, hochnäsigen Tonfall.
„U ’alaykum as-Salam!“, erwiderte der Bote und verbeugte sich leicht.
„Sprich!“, forderte der König den Boten auf.
„Der Sultan verlangt die Herausgabe des Leichnams seiner Schwester, die Köpfe der Verantwortlichen und die Kapitulation Jerusalems“, erklärte der Bote. Ein zorniges Raunen ging durch die Menge der Versammelten. Dem Sultan die Leiche seiner Schwester zu geben, war sicher nicht das Problem, und wenigstens Leute wie Raymond von Tiberias und Jean wären gewiss nicht abgeneigt gewesen, ihm auch die Köpfe der Kriegstreiber auf einer silbernen Platte zu servieren – falls gewünscht, auch mit einer Zitrone zwischen den Zähnen; aber Jerusalem zu verlangen, das ging selbst entschiedenen Kriegsgegnern zu weit.
„Tut er das?“, fragte Guy spöttisch und kam zwei Stufen zu dem Boten herunter.
„Welche Antwort wollt Ihr Salahadin übermitteln?“, erkundigte sich der Bote.
„Diese?“
Obwohl vom Tonfall her Frage, war es eindeutig eine Feststellung, denn Guy zog gleichzeitig mit diesem Wort in einer fließenden Bewegung seinen Dolch und rammte ihn dem auf einen tätlichen Angriff gänzlich unvorbereiteten Boten von unten durch die Kehle, dass dessen Blut spritzte und die Stufen des Throns nur knapp verfehlte. Die beiden Begleiter des Boten wollten sich auf Guy stürzen, doch blieben sie in einem vielfachen Zaun aus augenblicklich gesenkten Lanzen stecken. Ein Durchkommen war für sie unmöglich. Guy sah sich um, steckte den Dolch weg und zog sein Schwert, holte aus und trennte den Kopf des sterbenden Boten mit einem einzigen, wohlgezielten Hieb vom Rumpf. Ein Strahl Blut ergoss sich auf den weißen Marmorboden des Palasthofes. Wächter schleppten den Enthaupteten zu seinen Gefährten und hinterließen eine breite Blutspur.
„Bringt den Kopf nach Damaskus!“, wies Guy die Gefährten des Boten an, die samt dem Toten aus dem Innenhof entfernt und gen Damaskus auf den Weg gebracht wurden.
„Ich … bin Jerusalem!“, verkündete Guy dann, kaum dass die Sarazenen fort waren. Es waren präzise die Worte Balduins IV., aber eine völlig andere Aussage als die des verstorbenen Königs. Er zog sein Schwert, reckte es zum Himmel und rief:
„Versammelt die Truppen!“
►Sibylla hatte von all dem nichts mitbekommen. Nach wie vor hatte sie die königlichen Gemächer nicht verlassen, die eher einer Krypta glichen, da der Sarkophag ihres Sohnes noch immer hier stand und sie nichts davon wissen wollte, dass er endlich in die Grabeskirche übergeführt wurde. In tiefer Trauer versunken saß sie auf dem blanken, gefliesten Boden, weinte um ihren Sohn – und um ihre Liebe.
Schritte störten sie auf. Sibylla sah auf und gewahrte ihren Gemahl mit einem triumphierenden Grinsen neben sich.
„Was habe ich getan?“, sprach Guy mit beißendem Spott ihre Gedanken aus, ihren Tonfall böse imitierend. Sibylla sah ihn geschockt an, als er ihr Kinn einfach anhob und sie zwang, ihn anzusehen. Er hatte etwas getan, was nicht rückgängig zu machen war … Etwas Furchtbares … Das war ihr in diesem Moment klar, als ihre Augen in seinen eiskalten Blick tauchten.
„Ihr habt den Falschen vergiftet“, fuhr Guy fort und grinste böse. „Ihr habt Euren Sohn getötet und ich Euren Liebhaber. Ich habe die Macht. Ich bin Jerusalem!“
Damit verließ er sie.
Sibylla war wie vom Blitz getroffen. Balduin tot, durch ihre eigene Hand – und Balian letztlich auch durch sie, denn hätte sie nicht Guy zum König gekrönt, hätte er nach ihrer Überzeugung kaum gewagt, Hand an Balian zu legen. Es gab kein Zurück mehr. Dass Guy sie belogen hatte, wenn er behauptete, dass er Balian getötet hatte, konnte sie nicht wissen, ebenso wenig, dass Guy durchaus schon vor der Krönung die Templer gegen Balian ausgesandt hatte – und dass er sich, was den Tod des Barons von Ibelin betraf, im Irrtum befand. Sie war Guy vollkommen ausgeliefert. Jetzt konnte sie nur noch beten, dass Guy nichts von gewissen Umständen erfuhr … Die Königin verlor vor bitterer Trauer um zwei geliebte Menschen den Verstand …◄
Kapitel 45
Das Warten
Auf König Guys Befehl versammelten sich die Vasallen Jerusalems zum Kriegsrat. Alle erschienen bis auf Balian von Ibelin, den Guy aber auch gar nicht erwartete, war ihm doch berichtet worden, der Baron von Ibelin sei tot. Er ahnte nicht, dass der verhasste Rivale höchst lebendig und nur noch eine Meile entfernt war.
Balian hatte sich unter der Obhut Jeans von den Folgen des Überfalls erholt. Der Johanniter hatte ihm von Reynalds Überfällen berichtet. Auch wenn er von dem Mord an Saladins Schwester noch nichts wusste, war Jean klar, dass es über kurz oder lang Krieg mit den Sarazenen geben würde. Jean wusste zudem, dass Guy sich von einem Kriegszug nicht abhalten lassen würde; dennoch wollte Balian versuchen, ihm den Krieg auszureden oder ihn wenigstens davon abzuhalten, Jerusalem schutzlos zu lassen. Obwohl er noch nicht wieder im Vollbesitz seiner Kräfte war, jagte er eilig gen Jerusalem, um zu retten, was zu retten war.
Schon von weitem sah der junge Baron, dass die Truppen bereits versammelt waren. Die außerhalb der Mauern stehenden Fußtruppen bemerkten ihn zuerst. Sie jubelten ihm zu und skandierten seinen Namen, als er an ihnen vorbei ritt. In Gestalt des Balian von Ibelin war endlich jemand gekommen, der nicht nur als Freund des toten Balduin IV. und seiner Idee von einem friedlichen Zusammenleben der Religionen des Heiligen Landes galt, sondern auch in der Lage war, eine Schlacht zu schlagen; mit einem Heer dieser Größe, davon waren die Männer überzeugt, würde Balian sogar Saladin schlagen können.
Guy eröffnete die Versammlung:
„Jetzt ist diese Versammlung der Barone und ganz Jerusalems vollständig“, erklärte er. „Es mag einige unter Euch geben, die mit meiner Nachfolge nicht einverstanden sind …“, fuhr er fort und sah aus dem Zelt, als draußen Tumult entstand, ja, Jubel zu hören war. Zu Guys blankem Entsetzen, das er freilich gut zu verbergen wusste, galoppierte ein ihm gar zu gut bekannter Reiter auf einem Grauschimmel auf das Zelt zu. Balian stieg einige Klafter außerhalb des Zeltes, unter dem Kriegsrat gehalten wurde, vom Pferd und marschierte schnurstracks zum Kriegsrat. Er trug noch immer die Kleidung, in der die Templer ihn überfallen hatten, aber das Schwert hatte er im Gürtel an der Seite. Guy sah ihn an, fassungslos, wie es sein konnte, dass diese zähe Kröte immer noch lebte.
„Aber … es ist Krieg und ich … bin der König“, erklärte er, ohne auf Balians unerwartetes Erscheinen auch nur einzugehen. Er hätte damit zugegeben, an dem Anschlag auf ihn beteiligt gewesen zu sein. „Wir marschieren unverzüglich! Was sagt dieser Rat dazu?“
„Aye!“, tönte es im Chor unter dem Beratungszelt, auch Patriarch Heraclius stimmte in den Ruf ein.
Balian trat unter das Zeltdach und schüttelte den Kopf.
„Nein!“, widersprach er. „Wenn Ihr unbedingt Krieg wollt, darf sich dieses Heer nicht vom Wasser entfernen. Ihr habt eine Chance, diese Stadt zu halten, aber wenn Ihr gegen Salahadin zu Felde zieht, werden diese Truppen vernichtet und die Stadt bleibt schutzlos zurück“, warnte er. Guy grinste höhnisch.
„Wenn ich wünsche, von einem Hufschmied beraten zu werden, lasse ich es ihn wissen“, verwarf er den Rat Balians. Doch der gab so schnell nicht auf.
„Salahadin will, dass Ihr aus der Stadt kommt. Er wartet darauf, dass Ihr diesen Fehler begeht. Er kennt seinen Gegner!“, warnte er erneut. Sein Blick hatte etwas Lauerndes, Listiges; das war nicht zu übersehen.
Templergroßmeister Gérard de Ridefort sprang auf und hob die geballte Faust.
„Wir sollten uns den Feinden Gottes stellen!“, rief er. Wieder ertönte ein vielstimmiges, zustimmendes:
„Aye!“
„Und das werden wir!“, bestätigte Guy mit leuchtenden Augen. Er war am Ziel seiner Wünsche.
„Dann tut das – ohne meine Ritter!“, meldete sich Raymond von Tiberias zu Wort. Guy sah ihn spöttisch an.
„Dann werde ich den Ruhm ernten, Tiberias“, versetzte Guy. „Ihr hattet Euren – vor vielen Jahren. Es ist Zeit für meinen!“, giftete er. Balian und Raymond wandten sich ab und verließen das Beratungszelt. Tiberias legte dem Sohn seines besten Freundes väterlich eine Hand auf die Schulter. Wer immer Guy verraten hatte, dass Balian in seinem früheren Leben das ehrbare Handwerk eines Hufschmieds ausgeübt hatte, sie wussten es nicht – und es hatte keine Bedeutung. Wenn Guy nicht auf einen klugen Rat hören wollte, war ihm nicht zu helfen.
Er beschleunigte seine Schritte, der Jüngere hatte Mühe ihm zu folgen.
„Tiberias!“, rief er schließlich, um den Konstabler zu stoppen. Raymond blieb stehen und drehte sich um.
„Wenn Salahadin Guy besiegt hat, wird er kommen. Wir müssen eine Verteidigung errichten“, empfahl Balian. Wenn Guy schon keine Hilfe von Balian wollte, brauchte Jerusalem sie gleichwohl. Der Konstabler nickte nur zustimmend, aber auch abwesend.
„Der Junge ist tot“, sagte er tonlos. Der Baron nickte. Er hatte es erwartet, dass Guy Sibyllas Sohn nicht lange am Leben lassen würde, um sich selbst der Krone zu bemächtigen.
„Guy!?“, fragte er, um sich zu vergewissern, jetzt einen besseren Grund zu haben, dem Gemahl seiner Geliebten den Hals umzudrehen. Doch Tiberias schüttelte den Kopf.
„Nein“, sagte er. „Der Junge hatte Lepra – wie sein Onkel. Sie schenkte ihm Frieden. Sie ließ ihn gehen. Und Jerusalem … ging mit ihm.“
Balian nickte. Er wusste, wie sehr Sibylla ihren Sohn geliebt hatte. Nie, dessen war er sicher, hätte sie ihren geliebten Sohn aus Eigensucht getötet. Nein, sie hatte aus Liebe zu ihrem Kind gehandelt, um ihm das Grauen dieser Krankheit zu ersparen. Balian konnte das nicht verwerflich finden. Guy war nicht schuld am Tod des kleinen Königs, also bestand für Balian kein Grund, ihn zu töten. Seine Liebe zu Sibylla würde unerfüllt bleiben, aber er akzeptierte es. Sie war verheiratet und damit unerreichbar.
Die sich zum Abmarsch sammelnden Truppen setzten sich in Bewegung, Raymond ging fort, und Balian blieb allein zurück. Der junge Baron fiel fast erneut vom Glauben ab, als er Bruder Jean sah, der ihm in einiger Entfernung gefolgt war: Jean schickte sich an, mit dem Heer zu ziehen, statt dem kriegslüsternen König eine Absage zu erteilen.
„Ihr zieht mit dem Heer?“, wunderte sich Balian verstört.
„Der Platz meines Ordens ist beim Heer“, gab Jean gelassen zurück. Johanniter waren in erster Linie dem Wohl der Pilger verpflichtet, doch schloss die Ordensregel des Johanniterordens gleichwohl den Kampf ein – und zwar nicht nur zur Verteidigung der ihnen anvertrauten Kranken und Verwundeten. Aus welchen Gründen der Großmeister des Johanniterordens sich König Guys Willen gebeugt hatte war unerheblich – er hatte es getan und damit waren die Johanniter Teil des Heeres, das nach Balians Überzeugung in den Untergang zog.
„Ihr geht in den sicheren Tod!“, warnte er eindringlich. Jean lächelte nur.
„Der Tod ist immer sicher“, erwiderte er – und er hatte Recht, wie Balian nur zu gut wusste. Menschen lebten nicht ewig; das irdische Leben war irgendwann beendet. Aber musste man es deshalb bewusst wegwerfen?, fragte sich Balian. Doch er würde Jean mit seinen Argumenten nicht abhalten, das wusste er auch. Jean lächelte ihn milde an.
„Ich werde Eurem Vater erzählen, was aus Euch geworden ist“, versprach er dann und ritt an. Balian sah ihm nach. Er wurde das dunkle Gefühl nicht los, den klugen Johanniterbruder zum letzten Mal lebend gesehen zu haben. Schließlich gab er sich einen Ruck und ging zum Palast. Königin Sibylla sollte wissen, dass Jerusalem nicht völlig von allen Baronen und Rittern verlassen war.
Es erschien ihm unendlich lange her, dass er zuletzt durch die nun fast völlig verlassenen Gänge des Königspalastes gegangen war. Ein leiser Singsang führte ihn zu ihr. Er fand eine in Tränen aufgelöste Sibylla in ihren Gemächern vor und blieb abwartend in der Tür stehen.
Sibylla hörte Schritte durch den Gang kommen. Nein, das war nicht Guy. Das klang eher nach Balian. Aber konnte das überhaupt sein? Gerade noch hatte Guy ihr gesagt, dass er Balian getötet hatte! Als er dann in der Tür stand, ramponiert, aber höchst lebendig, konnte sie es kaum fassen, doch brachte sie es nicht fertig, aufzustehen, zu ihm zu gehen und ihn zu umarmen. Seine brüske Zurückweisung nach dem von ihr und Tiberias eingefädelten Mordkomplott gegen Guy hatte sie nicht vergessen. Aber als sie ihn jetzt sah, schlug sie ihr eigenes Gewissen erneut. Ihr wurde bewusst, wie sehr dieses Komplott Balian in seiner Ehrenhaftigkeit und seinem reinen Gewissen verletzt hatte. In seinen Augen sah sie seine Verletztheit, aber auch seine unbedingte Treue. Balian, der vollkommene Ritter, ließ sie nicht im Stich, mochte sein Unterfangen auch völlig unmöglich erscheinen.
„Wenn Salahadin kommt, können wir uns nicht verteidigen“, schluchzte die Königin verzweifelt. „Rette die Menschen vor dem, was ich tat!“, flehte sie ihn dann an.
„Das werde ich“, versprach er, wortkarg wie immer. Er wandte sich ab und verließ den Palast. Ohne jedes weitere Wort begab er sich auf die Mauer und entwarf seine Pläne für die Verteidigung Jerusalems.
Sibylla sah ihm nach und brach erneut in heiße Tränen aus. Was hatte sie nur angestellt, diesen treuen und verlässlichen Ritter, den vollkommensten Ritter, den die Welt je gesehen hatte, in eine solche Intrige verstricken zu wollen? Sie hatte seine Liebe verraten, sie missbrauchen wollen, seine Integrität für überflüssig gehalten. Doch genau deshalb war er jetzt hier, weil er ein treuer Diener eines gerechten Königs war und immer noch ihrem Bruder Balduin und ihrem Sohn Balduin die Treue hielt. Vielleicht auch, weil er sie liebte, aber darauf wagte Sibylla im Moment nicht mehr zu hoffen …
Kapitel 46
Die Straße nach Hattin
Guys Armee marschierte auf direktem Weg nach Nordosten, um Saladins Truppen möglichst vor dem See Tiberias abzufangen. Der König hatte es eilig und hatte deshalb den direkten Weg gewählt, nicht den sehr viel längeren durch das Jordantal, in dem sie stets dicht am Wasser gewesen wären. Er war ihm zu lang erschienen, um den See Tiberias rechtzeitig zu erreichen. Doch der direkte Weg, den die Armee nahm, war trocken und wüst. Es gab kein Wasser auf diesem Weg. Nicht nur Guy wurde klar, dass Balians Rat, in der Nähe von Wasser zu bleiben, klug gewesen war. Jetzt rächte sich, dass er dessen Rat nur abgelehnt hatte, weil er von Balian gewesen war.
Die Julihitze war unerträglich, die Sonne brannte erbarmungslos von einem unschuldig blauen Himmel, der schon seit Wochen auch nicht den Fetzen einer Wolke gesehen hatte. Die Ritter und Soldaten schleppten sich mühsam dahin. Durst quälte die Männer. Selbst die Führer wie Guy de Lusignan und Reynald hatten nur noch wenig Wasser. Und das wenige Wasser wurde auch noch dazu vergeudet, die überhitzte Haut zu kühlen … Immer wieder fielen Berittene ohnmächtig aus dem Sattel oder stolperten Fußsoldaten über die eigenen Füße und blieben als Futter für die Geier liegen. Die christliche Armee war schon kampfunfähig, bevor die Männer überhaupt einen einzigen Schwertstreich oder Speerstoß geführt hatten …
Die Armee des Sultans überschritt den Jordan am See Tiberias. Saladin registrierte zufrieden, dass sie den Christen zuvor gekommen waren. Späher ritten voraus und beobachteten den Vormarsch des christlichen Heeres – und dessen Zustand. Was sie dem Sultan berichteten, ließ ihn gewiss sein, seine Rache gründlich ausführen zu können.
Mit dem muslimischen Heer zog auch Khaled ibn Jubayr, jener fanatische Mullah, der Saladin wegen seines Rückzugs bei Kerak Vorwürfe gemacht hatte. Endlich war Saladin bereit, seinen Schwur zu erfüllen, Jerusalem zurückzuerobern. Khaled wollte es mit eigenen Augen sehen und darüber wachen, dass die Christen ihre gerechte Strafe für alles bekamen, was sie den Muslimen angetan hatten, seit sie die Stadt des Propheten mit dem Blut ihrer muslimischen Bewohner geflutet hatten …
„Gott will es!“, rief er voller Begeisterung ein ums andere Mal und fast alle Männer der Armee Saladins antworteten ihm ebenso laut. Imad gehörte mit dem Sultan zu den Wenigen, die nicht in dieses fanatische Geheul einstimmten. Er blickte skeptisch auf den jungen Mullah. Seine Gedanken gingen zu Balian von Ibelin, und er hoffte, dass Balian nicht bei dem Heer des Königs von Jerusalem war. Nichts wollte Imad weniger als gegen diesen Mann kämpfen – nicht nur, weil es lebensgefährlich war, Balian von Ibelin im Zorn zu begegnen, sondern vielmehr, weil er ihn mochte und seine Ehrenhaftigkeit und Güte schätzte.
‚Warum können die Zeiten nicht anders sein?’, dachte er. ‚Balian ist ein guter Mensch, seine Untertanen lieben ihn, Ibelin ist ein Ort des Friedens. Allah sei mit ihm.’
Saladins Armee nahm die Position in dem Kessel zwischen den Hörnern von Hattin ein. Wie ein riesiger Wirbel kreisten die Reiter, wirbelten Staub auf, um die Christen in die Falle zu locken. Und dann wurden sie gesichtet … Die letzten Sarazenen verließen den Talkessel, als die Spitzen der christlichen Armee am Pass auftauchten.
Guy ließ die letzten Kräfte mobilisieren, um die Sarazenen abzufangen und den rettenden See zu erreichen. Doch kaum waren die letzten Soldaten Jerusalems in den Talkessel gezogen, als die sorgsam vorbereitete Falle zuschnappte …
Tage vergingen, in denen Balian die Verteidigung Jerusalems vorbereitete, ohne darüber auch nur ein Wort zu verlieren. Dann, eines Morgens, stand er auf der Mauer und spürte Tiberias’ Nähe. Er machte sich zunehmend Sorgen, weil von Guy und seiner Armee nichts, aber auch gar nichts zu hören war.
„Könnt Ihr es fühlen?“, fragte er.
„Es wurde kein Bote geschickt“, bemerkte Tiberias, als er die Mauerkrone erreicht hatte. In der Tat: Noch immer gab es keine Nachricht von König Guy. Guy persönlich war sowohl Balian als auch Tiberias herzlich gleichgültig, aber was war mit den vernünftigen Leuten, die nur durch ihren Treueid zu diesem Kriegszug genötigt worden waren und den Krieg keinesfalls guthießen? Er und Balian sahen sich verstehend an. Sie mussten nachsehen.
Kapitel 47
Königliches Vorbild
Fern davon räumten die Sarazenen das blutgetränkte Schlachtfeld von Hattin ab. Es war ihnen – wie von Balian prophezeit – gelungen, das christliche Heer vom Wasser des Sees Tiberias abzuschneiden und völlig zu vernichten. Ein paar Überlebende wurden zusammengetrieben oder von jeweils mehreren Wächtern geschleppt. Die überlebenden Ordensritter – Templer und Johanniter – wurden auf Befehl des Sultans enthauptet und die abgeschlagenen Köpfe auf einen Haufen an den Fuß des Heiligen Kreuzes geworfen.
Saladin und Imad kehrten in das Zelt des Sultans zurück, bekamen Wasser zum Waschen gereicht; ein Diener öffnete ein gut isoliertes Kästchen, in dem sich tatsächlich Schnee befand. Saladin nahm den ihm dargebotenen Kelch, schöpfte ihn voll Schnee. Dann drehte er sich um und sah auf die beiden waffenlosen Gefangenen, die Wächter vor dem Zelt des Sultans in Schach hielten. Guy und Reynald waren völlig erschöpft und halb verdurstet, blutverschmiert und verdreckt. Saladin reichte den schneegefüllten Kelch dem König von Jerusalem, der ihn annahm, einen Bissen von dem Schnee nahm und ihn dann an Reynald weiterreichte.
„Ich trinke Wasser egal, in welcher Form“, kicherte Reynald und schlürfte den Becher gierig leer.
„Ich habe den Becher nicht dir gegeben“, fuhr Saladin ihn grollend an. Einem Gefangenen einen Becher Wasser zu geben, war das Zeichen, dass er verschont werden würde. Wer diesen Becher nicht bekam, hatte mit größter Wahrscheinlichkeit den Tod zu erwarten – und dass Saladin Reynald ungeschoren lassen würde, nach allem, was er angerichtet hatte, konnte der Templergönner nicht wirklich hoffen. Doch solange sie sich schon im Orient aufhielten: Die Bräuche der Sarazenen hatten weder Guy noch Reynald interessiert. Reynald, der die Gefahr deshalb nicht erkannte, schüttelte grinsend den Kopf.
„Nein, Mylord“, kicherte er bestätigend. Khaled ibn Jubayr stand hinter Saladin und hielt dessen Schwert in den Händen. Saladin drehte sich kurz um und sah ihn an. Khaled zog das Schwert ein Stück aus der Scheide und erwiderte den Blick des Sultans bedeutungsschwer. Saladin verstand. Dem Mullah zugewandt, riss er den Dolch aus der Scheide, drehte sich ruckartig um und schlitzte Reynald aus der Drehung heraus die Kehle auf. Erschrocken ließ Reynald den Kelch fallen, als sein Blut im Takt des Herzens aus der Halsschlagader schoss und den Sultan nur um eine Handbreit verfehlte. Auf einen Wink Saladins packten seine Soldaten den erschrockenen Reynald, schleppten ihn ein Stück vom Zelt fort. Einer hielt den Kopf des Todgeweihten, Saladin gab den Dolch einem Diener, griff bei ibn Jubayr nach seinem Schwert, zog es aus der Scheide, ging mit zornigem Blick aus dem Zelt und enthauptete Reynald eigenhändig. Seine Schwester Jazira war gerächt …
Guy wähnte sein letztes Stündlein gekommen, hatte er doch Reynald den Kelch gegeben. Zudem war er für einen Großteil der Missetaten Reynalds verantwortlich, wie er nur zu gut wusste … Er schloss mit dem Leben ab. Doch Saladin trat neben ihn und sagte:
„Ein König tötet keinen König. Warst du nicht nahe genug bei einem großen König, um von ihm zu lernen?“, hielt er Guy sein Versäumnis vor. De Lusignan schwieg betreten.
Kapitel 48
Vier Tage
Tiberias und Balian hatten mit einer recht massiven Eskorte das Schlachtfeld bei den Hörnern von Hattin erreicht. Begleitet von Soldaten in Jerusalemer Röcken hatten sie sich auf den Weg gemacht. Die Spuren, die das gewaltige Heer hinterlassen hatte, waren so deutlich, dass sie ihnen mühelos folgen konnten. Da sie sich mit ausreichend Wasser versorgt hatten, waren sie schnell vorangekommen, ohne ihre Kräfte zu verausgaben und erreichten die Hörner von Hattin nur Stunden nachdem die Sarazenen den Ort des schrecklichen Gemetzels endgültig verlassen hatten.
Schon von weitem mussten sie nicht mehr auf die breite Spur des christlichen Heeres schauen. Eine riesige Wolke kreisender Geier zeigte den Ort der Schlacht aus meilenweiter Entfernung. Sie fanden nur christliche Tote; die Sarazenen hatten ihre eigenen Gefallenen ihren Riten entsprechend sofort nach der Schlacht bestattet. Das Heilige Kreuz stand verbrannt mitten auf dem Schlachtfeld, umgeben von den abgeschlagenen Köpfen der nach der Schlacht gefangen genommenen und hingerichteten Ordensritter. Die enthaupteten Körper lagen nicht weit entfernt in langen Reihen, wo die Sarazenen die Gefangenen auf die Knie gezwungen und dann getötet hatten; sie steckten noch immer in den Rüstungen und Waffenröcken. Aufgespießt auf einer Lanze steckte weithin sichtbar der abgeschlagene Kopf Reynalds … Die Männer aus Jerusalem sahen sich erschüttert an. Hier gab es keine Überlebenden mehr …
Sie suchten dennoch das Schlachtfeld ab, doch mehr auf der Suche nach weiteren bekannten Personen. Es fehlten einige, darunter Guy de Lusignan. Offenbar hatten die Sarazenen doch Gefangene gemacht. Ob sie lange überleben würden, war allerdings eine andere Frage … Was für die Christen aus Jerusalem unbekannt blieb, war, wie groß das Heer Saladins nach dieser Schlacht noch war. Sie hatten weder eine Ahnung, wie groß es ursprünglich gewesen war, noch wie hoch die Verluste waren. Es war unmöglich, dass Saladin keine Toten zu beklagen hatte, aber wie viele es waren und welchen Einfluss dies auf die Kampfkraft seines verbliebenen Heeres hatte, das konnten sie nicht ermessen.
Tiberias war in diesem Augenblick klar, dass Jerusalem verloren war. Das Heer war vernichtet; eine Chance, ernsthaften Widerstand zu leisten, gab es nicht mehr. Hier gab es für ihn nichts mehr zu tun, meinte er.
„Ich habe Jerusalem mein Leben geopfert. Alles. Am Anfang habe ich gedacht …, es wäre für Gott. Und dann wurde mir klar, dass wir für Land und Wohlstand kämpften. Ich habe mich geschämt“, bekannte er reumütig. Müde schüttelte er den Kopf und wandte sich ab. Raymonds Äußerung traf Balian wie ein Schlag. Raymond und Godfrey waren aus völlig unterschiedlichen Beweggründen ins Heilige Land gekommen – Raymond, um für Gott zu kämpfen, Godfrey, um sich eine eigene Existenz aufzubauen. Godfrey war aus genau dem Grund gekommen, den Raymond von Tiberias so verabscheute, wie sich jetzt zeigte, und doch waren sie gute Freunde gewesen … Die Welt war voller Widersprüche …
„Tiberias!“, rief Balian ihm nach. Tiberias zügelte sein Pferd und drehte noch einmal um.
„Jerusalem gibt es nicht mehr. Ich werde nach Zypern gehen. Kommst du mit mir?“, fragte er Balian. Godfreys Sohn war entsetzt. Wie konnte er so etwas sagen? Und was war mit den Leuten in Jerusalem?
‚Beschütze die Wehrlosen!’, hallte der Rittereid in seinem Kopf nach. Nein, das konnte er nicht tun. Er schüttelte den Kopf.
„Nein“, erwiderte er. Tiberias nickte. Etwas anderes hatte er von Balian nicht erwartet.
„Du bist deines Vaters Sohn!“, sagte er. „Saladin muss seine Truppen von Oase zu Oase führen. Das verschafft euch vier Tage, vielleicht fünf*!“, trieb er Balian an. Er schlug ihm kräftig auf die Schulter.
„Gott sei mit dir. Mich hat er verlassen“, setzte er hinzu. Damit wendete er sein Pferd, winkte seinen Männern und sprengte davon.
Balian blieb mit wenigen Männern zurück, deren Familien noch in Jerusalem waren. Er sah Tiberias und seinen Männern nach und machte keinen weiteren Versuch, sie aufzuhalten. Aber er wollte wirklich in der Hölle schmoren, wenn er die Menschen Jerusalems einfach so im Stich ließ. Das konnte niemand von ihm verlangen … Balian hatte seinen Glauben an Gott wiedergefunden – doch nicht in religiöser Verblendung. Er hatte erkannt, dass es so viele Wege zu Gott gab, wie es Menschen gab – und das schloss eine eigene Auffassung der Verehrung Gottes ein.
Dann sah er zu seinem Entsetzen den abgeschlagenen Kopf Jeans, der unter den vielen anderen am Heiligen Kreuz lag. Trotz der Gewalt, mit der man ihm das Leben genommen hatte, wirkte Jeans Gesicht ruhig und friedlich. Jean schien mit sich und dem irdischen Leben in Frieden gegangen zu sein. Vielleicht erzählte die gute Seele gerade Godfrey von seinem Sohn …
‚Der Tod ist immer sicher’, waren seine Worte gewesen. In der Tat, er hatte Recht gehabt.
‚Bist du jetzt bei Vater und redest mit ihm?’, fragte Balian in Gedanken. ‚Friede sei mit dir, alter Freund.’
Mit Tränen in den Augen winkte er den wenigen verbliebenen Männern. Hier gab es nichts mehr zu tun und zu retten. Jetzt zählten nur noch die Menschen Jerusalems, die auf seine Rückkehr warteten und sich Schutz von ihm erhofften. Er konnte sie einfach nicht enttäuschen.
Kapitel 49
Die Verteidigung Jerusalems
Balian hatte zusätzlich zu dem, was er bereits zusammen mit Tiberias an Verteidigungsmaßnahmen organisiert hatte, noch einige Ideen im Kopf gehabt, wie Jerusalem einer Belagerung wenigstens einige Zeit standhalten konnte. Er hätte von manchen dieser Ideen aber Raymond erst überzeugen müssen; jetzt war das nicht mehr erforderlich, denn Tiberias hatte ihm – ohne es wirklich auszusprechen – den Oberbefehl über Jerusalem und seine Verteidigung übergeben. Eilig kehrte der junge Baron mit seinen Begleitern nach Jerusalem zurück, um seine Ideen schleunigst in die Tat umzusetzen. Als Erstes unterrichtete er Königin Sibylla, dass Tiberias sich nach Zypern zurückgezogen hatte und teilte ihr mit, dass er dringend die Stadt für eine Verteidigung vorbereiten müsse. Sie ließ ihn gewähren, gab ihm freie Hand, alles zu unternehmen, was ihm angemessen erschien, um das Volk zu retten.
Er ließ alle Katapulte und Steinschleudern überprüfen, verbesserte die Zielgenauigkeit und setzte an den Geschützen Markierungen, die er in Einheiten zu vierhundert, dreihundert, einhundertfünfzig und einhundert unterteilte. Die Bedienmannschaften der Kriegsgeräte konnten damit zunächst nichts anfangen.
Das änderte sich, als Balian vor den Toren Jerusalems kleine Steinhügel aufschichten ließ, die auf der von der Stadt sichtbaren Seite mit weißem Kalkputz bestrichen wurden und damit von der Mauer sehr gut erkennbar waren. Jede Reihe vermaß er mit einem Peilgerät, das er aus Metallschienen selbst konstruiert hatte. Er machte das ebenso genau, wie er einst Nagellöcher für seine Hufeisen ausgemessen hatte. Über das doppelte, schwenkbare Schienenvisier konnte er erheblich schärfer in der Entfernung sehen als mit bloßem Auge. Weitere Hilfe bei der Vermessung der Steinhäufchen war eine Knotenleine, in die Knoten in der Anzahl der angegebenen Abstände eingeflochten waren. Zur Sicherheit hatte Balian die maßgeblichen Knoten zusätzlich entsprechend gekennzeichnet, denn viele seiner Leute konnten weder lesen noch gar rechnen. Almaric, der mit seinem Stellvertreter Michel Balian bei der Einmessung assistierte, bewunderte die Genialität von Balians Konstruktionen und sagte sich, dass doch etwas dran sein musste, wenn behauptet wurde, dass ein Schmied auch immer ein Erfinder* sei.
Vier Tage waren vergangen, seit sie die Toten bei Hattin gefunden hatten und wussten, dass Jerusalem gänzlich allein dastand, weil die Armee vernichtet war. Falls es Überlebende gegeben hatte – König Guy und einige andere hatten sie unter den Toten nicht gefunden – waren sie in sarazenischer Gefangenschaft, aus der ein Entkommen nur gegen hohe Lösegelder überhaupt möglich war. Doch es war keine Lösegeldforderung gestellt worden. Sie würde auch nicht folgen, sagte sich Balian, denn Saladin wollte jetzt Jerusalem haben. Dafür konnte er nicht einen einzigen Gefangenen gehen lassen, der dann gewiss in den Reihen der Verteidiger zu finden gewesen wäre…
Balian war, assistiert von dem treuen Almaric, dabei, die letzte Reihe mit dem Maß vierhundert vor dem Damaskustor einzumessen. Er peilte auf Zuruf des Soldaten den eben gerade geweißelten Steinhaufen an. Dann sah er etwas über diesem Haufen und richtete das Schienenvisier etwas höher. Er sah einen einsamen Reiter in sarazenischer Rüstung auf einem der Wüstenhügel östlich von Jerusalem. Balian schob das Visier beiseite und sagte:
„Sie sind da!“
Almaric hatte den Reiter ebenfalls gesehen.
„Es ist nur ein Mann“, erwiderte und kniff die Augen zusammen, aber mehr sah er immer noch nicht. Balian schüttelte den Kopf. Er hatte einen jener Soldaten in Saladins Dienst erkannt, die die Vorhut der Hauptarmee bildeten. Dieses Detail hatte er aber nur durch das Visier erkennen können, im Gegensatz zu Almaric, der kein Visier als Peilhilfe hatte.
„Nein. Sie sind da!“, beharrte er bestimmt.
Balian hatte Recht. Der einzelne Reiter war der vorderste Vorposten einer ungeheuer großen Armee die – wie von Tiberias geschätzt – vier Tage bis nach Jerusalem gebraucht hatte, aber noch hinter dem letzten Pass verborgen war, über den die Straße vom Jordantal hinauf nach Jerusalem führte. Balian winkte den Männern des Einmesstrupps, dass sie hinter die Mauern kommen sollten, was sie auch eilig taten. Dann verließen er und Almaric den Vermessungsposten. Auf dem Weg um die Mauer erklärte Balian seinem Hauptmann seinen Plan:
„Dies ist der einzige Abschnitt der Mauer, den sie angreifen können, wenn sie beginnen, die Stadt zu beschießen. Sie werden den Beschuss nur einstellen, um ihre eigenen Belagerungstürme nicht zu treffen. Wir lassen den Beschuss über uns ergehen. Wenn ihre Katapulte schweigen, schießen wir zurück.“
Almaric begriff den Plan und nickte.
Als sie ihren Rundgang beendet hatten, konnte Balian die Vorbereitungen als abgeschlossen betrachten und meldete dies auch Königin Sibylla. Er erhielt von ihr nun auch formell den Oberbefehl über die Stadt und die Vollmacht, in ihrem Namen jede Entscheidung nach seinem Ermessen zu treffen, die ihm für das Wohl der Stadt und ihrer Bewohner richtig erschien. Zum Zeichen dessen setzte Sibylla Balian von Ibelin als Konstabler der Stadt Jerusalem ein. Er erhielt den kornblumenblauen Rock der Jerusalem-Ritter mit dem königlichen Wappen des Heiligen Jerusalem auf der Brust.
Im neuen Ornat ging Balian mit Almaric, der nach wie vor den Ibelin-Rock trug und Balian nicht mehr von der Seite wich, zur Zitadelle von Jerusalem. Dort hatten sich auf Balians Befehl alle kampffähigen Männer Jerusalems versammelt. Auf dem Weg dorthin hielt der Patriarch den Konstabler auf.
„Wir müssen die Stadt verlassen!“, beschwor er den jungen Befehlshaber. Balian blieb stehen.
„Und wie stellt Ihr Euch das vor, Eure Heiligkeit?“, erkundigte er sich. Heraclius nahm den ironischen Unterton der Frage nicht wahr.
„Wir nehmen die schnellsten Pferde und fliehen durch das Seitentor“, erklärte Heraclius. Balian zog fragend eine Augenbraue hoch.
„Und was ist mit dem Volk?“, fragte er weiter. Der Patriarch bekreuzigte sich hastig.
„Das Schicksal des Volkes ist bedauerlich – aber es ist Gottes Wille!“, erwiderte er. Mit einer solchen religiösen Begründung biss er bei Balian von Ibelin allerdings auf sehr harten Granit. Der junge Baron ließ ihn kopfschüttelnd einfach stehen und ging weiter, bis er den Vorhof erreicht hatte. Es wurde Zeit, den Männern zu sagen, worum es ging.
Noch war deutliches Volksgemurmel bis auf den Wehrgang zu hören, auf dem Balian an das innere Geländer trat.
„Ruhe!“, brüllte Almaric. Augenblicklich war es so still, dass man einen Nagel hätte fallen hören können.
„Es ist an uns, Jerusalem zu verteidigen!“, rief Balian laut. „Und wir haben uns darauf vorbereitet, so gut man sich darauf vorbereiten kann“, erklärte er. Alles war so gut gerichtet, wie es nur menschenmöglich war.
„Keiner von uns hat diese Stadt den Moslems weggenommen. Kein Moslem der großen Armee, die jetzt gegen uns zieht, war geboren, als diese Stadt verloren ging. Wir kämpfen wegen einer Tat, die wir nicht begangen haben, gegen Menschen, die zum Zeitpunkt der Tat noch nicht geboren waren“, fuhr er fort. Nein, schuldig fühlen musste und sollte sich keiner der Männer, denen es beschieden war, Jerusalem gegen eine Übermacht zu verteidigen.
„Was ist Jerusalem?“ fuhr Balian dann, etwas philosophischer, fort. „Eure heiligen Stätten liegen über dem jüdischen Tempel, den die Römer zerstörten. Die heiligen Stätten der Moslems liegen über den euren. Welcher Platz ist heiliger? Die Klagemauer? Die Moschee? Das Heilige Grab? Wer hat Anspruch darauf?“ fragte Balian, um gleich darauf selbst die Antwort zu geben: „Niemand hat Anspruch darauf! Alle … haben Anspruch darauf!“
Für Balian war klar: Die Stadt Jerusalem gehörte nicht einer Religion allein, mochte sie sich auch als die einzig Richtige bezeichnen. Jerusalem war für alle drei Religionen, die hier ihren Ursprung hatten oder Jerusalem als einen Ort göttlicher Offenbarung betrachteten, eine heilige Stadt – und deshalb sollte sie auch allen gehören, die sich zu einer dieser drei Religionen bekannten. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das war seines Vaters Überzeugung gewesen, das war Balduins Überzeugung gewesen und auch Balian hatte dies als richtig und gerecht erkannt.
„Das ist Blasphemie!“, ereiferte sich der Patriarch.
„Seid still!“, fuhr Almaric ihn an. Erschrocken schwieg der Patriarch.
„Wir verteidigen diese Stadt nicht, um diese Stätten zu beschützen, sondern um die Menschen zu beschützen, die innerhalb dieser Mauern leben!“, stellte Balian dann gleich klar. Die Männer sollten keine Scham empfinden, ausschließlich für sich und ihre Familien zu kämpfen und nicht für eine gewisse religiöse Überzeugung.
Er wandte sich ab, um zu seinem Posten zu gehen, während die Menge noch stumm dastand. Noch niemand hatte den Baron von Ibelin so viel auf einmal reden hören; auch Sibylla nicht, die seine Rede von einer gegenüberliegenden Loggia verfolgt hatte. Sie lächelte sanft und zustimmend. Jerusalems Schicksal und das seiner Bewohner war bei Balian von Ibelin in den besten Händen.
Kapitel 50
Zu Rittern geschlagen
Als Balian den Wehrgang verließ, stutzte er. Vor ihm stand ein Mann in Kettenhemd und dunkelrotem Waffenrock mit einem schwarzen Wappen auf der Brust, von dem gerade zwei goldene Sterne unter dem oberen Schildrand sichtbar waren. Er nahm den breitrandigen Eisenhut* ab und verbeugte sich leicht vor Balian. Irgendwie kam der Mann dem Konstabler bekannt vor, doch konnte er ihn im Moment nicht einordnen. Er nickte ihm zu und ging dann weiter.
Der Patriarch hielt Balian hinter dem nächsten Torbogen schon wieder auf.
„Mylord! Mylord! Mylord … wie … sollen wir Jerusalem ohne Ritter verteidigen? Wir haben keine Ritter!“, warnte er. Der Angesprochene blieb stehen und drehte sich um.
„Ist das so?“, fragte er in seiner üblichen, wortkargen Art. Der Patriarch nickte bedrückt, aber gleichzeitig triumphierend. Balian sah sich um. Sein Blick fiel auf einen Jungen, der neben dem Patriarchen stand. Er mochte sechzehn, allenfalls siebzehn Jahre alt sein; zwar kampffähig, aber noch längst nicht erwachsen.
„Was ist deine Stellung?“, fragte Balian ihn.
„Ich bin Diener des Patriarchen“, erwiderte der Junge. Sein Name war Pierre.
„Das … ist … äh … einer meiner … Diener“, bestätigte der Patriarch stockend.
„Ist er das?“, fragte Balian bissig. „Du wurdest als Diener geboren?“, erkundigte er sich weiter. Pierre nickte, ohne die Frage wirklich zu verstehen. Balian war hatte nach den Worten seines Vaters auf dem Sterbebett und den Erfahrungen, die er seither gemacht hatte, die Erkenntnis erlangt, dass niemand als etwas Bestimmtes geboren wurde, sondern das war, was er oder sie aus sich machte …
„Knie nieder!“, forderte Balian ihn auf und ging halb zurück in den Hof der Zitadelle.
„Jeder Mann unter Waffen oder fähig, eine Waffe zu benutzen, kniet nieder!“, rief er laut. Die verblüfften Männer kamen der Aufforderung nur zögernd nach; so zögernd, dass Balian richtig laut ein scharf befehlendes:
„Auf eure Knie!“, folgen ließ. Alle sanken gehorsam auf die Knie.
Der Konstabler holte einmal tief Luft, dann sagte er so laut, dass es jeder in der Menge verstehen musste:
„Seid ohne Furcht im Angesicht eurer Feinde! Seid tapfer und aufrecht, auf dass Gott euch lieben möge! Sprecht immer die Wahrheit, auch wenn es den eigenen Tod bedeutet! Beschützt die Wehrlosen! Das … ist Euer Eid!“, schwor er die Männer auf den Rittereid ein. Dann trat er zu dem Jungen, der bisher dem Patriarchen gedient hatte und verpasste dem überraschten Jungen stellvertretend für alle die saftige Ohrfeige des Ritterschlags.
„Und das ist dafür, dass du ihn nicht vergisst!“, setzte er mit einem Lächeln hinzu, als Pierre ihn erschrocken ansah. „Erhebt Euch als … Ritter! Erhebt Euch als Ritter!“, rief er dann. Sein Blick fiel auf den Mann, der vor ihm den Eisenhut gezogen hatte. Jetzt hatte er auch keine Kettenkapuze mehr auf. Balian sah sein eingekerbtes rechtes Ohr und lächelte.
„Meister Totengräber!“, begrüßte er François. François sah ihn verblüfft an. Auch ihm war der junge Befehlshaber bekannt vorgekommen und jetzt wusste er auch, wen er da vor sich hatte.
„Ihr seid es!“, stieß er hervor.
„Nicht das, was ich war; so wenig, wie Ihr. Erhebt Euch als Ritter“, sagte Balian mit freundlichem Lächeln. Nicht alle begriffen, dass er damit erklären wollte, dass die Zukunft eines Menschen mit dessen Herkunft nichts zu tun hatte,
Der Patriarch schnappte heftig nach Luft. Was erlaubte der Mann sich? Einfach gewöhnliche Männer zu Rittern zu schlagen!
„Für wen haltet Ihr Euch?“, fuhr er Balian an. „Wollt Ihr die Welt verändern? Wird ein Mann durch einen Ritterschlag etwa zu einem besseren Kämpfer?“, ereiferte er sich. Balian drehte sich langsam um, sah ihn offen und gerade an. Er selbst hatte buchstäblich einschlägige Erfahrungen mit der Tatsache, dass ein Ritterschlag aus einem einfachen Mann einen besseren Kämpfer machen konnte – und die Welt hatte er, eingedenk seines vom Ziehvater ererbten Wahlspruchs, schon immer verbessern wollen … Er sagte nur ein einziges Wort:
„Ja!“
Kapitel 51
Belagerung
Im Laufe des Tages schlossen die Sarazenen Jerusalem von allen Seiten ein und brachten Katapulte, Steinschleudern und Trébuchets in Stellung. Doch mehr geschah zunächst nicht. Die Sarazenen unternahmen keinen Versuch, Jerusalem noch bei Tageslicht anzugreifen. Balian schloss daraus, dass sie noch nicht alle Truppen in der geplanten Position hatten. Zu verhindern war der Aufmarsch jedoch nicht, da die sarazenische Armee deutlich außerhalb der Reichweite der Jerusalemer Katapulte angehalten hatte. Ein Katapultangriff hätte auch keinen Nutzen gehabt, setzte man diese Waffen doch ausschließlich zur Vorbereitung eines Sturmangriffs ein. Balian war sich mit allen Männern seiner Führungsmannschaft einig, dass sie zwar Jerusalem verteidigen konnten, aber die Armee Saladins nicht in einem Ausfall schlagen konnten. Die Verteidiger von Jerusalem konnten nur auf den Angriff Saladins warten.
Nachdem die Sarazenen keine Anstalten machten, die Stadt sofort anzugreifen, hatte Balian das Damaskustor wieder öffnen lassen und Bogenschützen dort aufziehen lassen. Im letzten Licht des Tages beendeten er und Almaric ihren abschließenden Rundgang am Damaskustor. Der Baron ging ein Stück aus dem Tor, Almaric blieb einen Schritt hinter ihm stehen.
„Almaric“, sagte er, ohne seinen Hauptmann anzusehen, „wenn Ihr überlebt, geht Ibelin an Euch. Ihr seid der Herr von Ibelin.“
Erst dann drehte er sich zu seinem verblüfften Hauptmann um und lächelte ihn freundlich an.
„Ich bestätige dies. Erhebt Euch als Ritter … und Baron von Ibelin“, setzte er hinzu und klopfte seinem ersten Mann anerkennend auf die Schulter.
Balian sah für sich keine Zukunft in diesem Land, schon gar nicht mit der Person, mit der er sein Leben teilen wollte. Guy war der König, Saladin hatte ihn mit größter Wahrscheinlichkeit nicht getötet. Also würde er zurückkehren und den Platz an Sibyllas Seite als ihr Gemahl beanspruchen. Balian wollte dem rechtmäßigen Ehemann nicht im Wege stehen. Zudem wusste er, dass Guy Mittel und Wege finden würde, ihn, seinen Rivalen um Sibylla, aus dem Weg zu räumen – und wenn er es nur tat, um ihr die Möglichkeit zu nehmen, nochmals in Versuchung zu geraten, ihn, Guy, umbringen zu lassen, um mit Balian zu leben … Der Kampf um Jerusalem würde sein letzter Kampf hier sein. Entweder, weil er diese Belagerung nicht überlebte oder weil er es verlassen würde … Genau genommen hatte er nicht vor, die Schlacht um Jerusalem zu überleben.
Almaric sah ihn verstört an. Warum wollte Balian das tun? Sein geliebtes Ibelin, das er erst zu einem bewohnbaren Platz gemacht hatte, jenes kleine Paradies, in dem der Glaube keine Rolle spielte … Balian lächelte sanft. Almaric begriff plötzlich, was sein Herr vorhatte – und er schwor sich, auf ihn Acht zu geben, damit er nicht doch noch seiner verstorbenen Frau folgte …
„Aber … es ist ein armseliger und staubiger Ort“, sagte er mit einem schiefen Grinsen, wohl wissend, wie schön Ibelin geworden war. Es war seine Art, seinem Heimatort ein liebevolles Kompliment zu machen. Balian lachte über seine Worte, und Almaric sonnte sich in dem schönen Lachen, das er so selten zu sehen bekam.
Die Wirklichkeit holte sie schnell ein. Ein einzelner sarazenischer Reiter kam etwa bis zur Hälfte des Niemandslandes heran geritten.
„Es gibt keinen Sieg außer durch Gott!“, rief er auf Arabisch.
„Mylord?“, fragte einer der Bogenschützen den Konstabler. Er hatte bemerkt, dass der Reiter in Reichweite seines Bogens war und spannte die Waffe, aber Balian hob abwehrend die Hand.
„Nein!“, sagte er und der Bogen wurde wieder entspannt.
„Möge Gott mit uns sein!“, beschwor der Reiter Allahs Hilfe auf Arabisch auf die Belagerer herab.
„Wann … wird es beginnen?“, fragte Almaric mit trockenem Hals.
„Bald“, erwiderte Balian und presste die Lippen zusammen. Dann drehte er sich um und kehrte hinter die Mauern zurück, Almaric folgte ihm, auch die Bogenschützen verließen die Posten. Das Tor wurde geschlossen.
Hinter den Verteidigern flammten helle Sterne am Boden auf und erhoben sich in den Himmel. Es waren tödliche Sternschnuppen aus griechischem Feuer, die über Jerusalem niedergingen.
Balian hatte gerade den inneren Torbogen passiert, als ein italienischer Ritter einen Alarmruf ausstieß:
„Ballista!*“
„Bringt sie an die Mauern! Bringt die Katapulte an die Mauern!“, wies er die wild durcheinander laufenden Leute an. Die Männer hörten seine Stimme und gehorchten sofort. Die verbesserten Geschütze wurden dicht an die Mauern geschoben, wo sie vor den Geschossen mit griechischem Feuer geschützt waren. Doch der Konstabler erteilte nicht nur Befehle, er packte ebenso wie Almaric auch selbst mit an, die wertvollen Geschütze zu sichern.
„Schiebt!“, befahl er und drückte mit aller Kraft mit an dem Katapult.
Das griechische Feuer ging über Jerusalem nieder wie der biblische Vernichtungsregen über Sodom und Gomorrha. Eine der Feuertonnen zerschellte auf einem nicht rechtzeitig weggeschobenen Katapult. Der feurige Inhalt ergoss sich auf das Geschütz und die Männer, die es retten wollten und sich abmühten, es noch hinter die Mauer zu bekommen. Sie flohen als lebende Fackeln, ohne ihrem schrecklichen Schicksal entgehen zu können. Eine weitere explodierte in einem engen Tordurchgang und tötete dort weitere Männer auf die gleiche, grausame Art.
Balian und seine Führungsmannschaft aus seinen Ibelinern waren an den Orten der größten Gefahr zu finden, griffen zu, wo es nötig war, machten den Leuten Mut, halfen löschen. Ein Geschoss krachte in eine Mauer, die in einem Hagel aus Steinen und Splittern zusammenbrach. Die Trümmer überschütteten auch Balian, der sich nur knapp vor Verletzungen schützen konnte.
Weit vor den Toren Jerusalems stand Imad neben Saladin. Wie der Sultan beobachtete auch er die Beschießung der Stadt. Kopfschüttelnd fragte er:
„Warum werden wir nicht angegriffen?“
Es fiel dem jungen Heerführer schwer zu begreifen, dass die Christen sich überhaupt nicht wehrten. Saladin hatte damit weniger Probleme.
„Sie warten“, erwiderte er. Der Befehlshaber von Jerusalem musste ein erfahrener Mann sein, dem offensichtlich klar war, dass es keinen Sinn machte, bei Nacht auf einen im Schutz der Dunkelheit verborgenen Gegner zu schießen. Der Zeitpunkt des Angriffs war gut gewählt. Die Nacht war sehr dunkel, mondlos. Das Licht der Sterne – so strahlend es auch war – reichte nicht aus, den genauen Standort der Katapulte und Steinschleudern auszumachen.
Sibylla hatte im Palast am Sarkophag ihres Sohnes Schutz gesucht. In den Händen hielt sie den kleinen Bleiritter, das Lieblingsspielzeug ihres Sohnes. Doch auch von hier konnte sie durch einen Bogen weit oben sehen, wie eine tödliche Sternschnuppe nach der anderen die heilige Stadt erreichte. Still betete sie für alle, die Jerusalem verteidigten und draußen mit den Feuern kämpften. Verzweifelt versuchten die Verteidiger, die Brände, die sich rasch ausbreiteten, zu bekämpfen.
„Wir brauchen Wasser!“, schrie es hier und dort.
Die Steingeschosse und Feuertonnen prasselten lange Zeit ohne Unterlass auf die belagerte Stadt. Soweit es möglich war, hatten Frauen und Kinder in den Katakomben unter dem Palast und anderen großen Gebäuden Jerusalems Schutz gesucht. Diese Kammern waren in den Fels gehauen und konnten den Einschlägen an der Oberfläche standhalten, aber selbst dort unten bebte die Erde unter den heftigen Einschlägen. Balian machte einen Kontrollgang durch die Katakomben, um zu sehen, ob dort alles in Ordnung und die Menschen in Sicherheit waren. Sein Erscheinen vermittelte den Leuten Zuversicht. Er war da und kümmerte sich um ihre Sicherheit.
Während die Christen in Jerusalem sich des gefräßigen Feindes Feuer zu erwehren suchten, führten die Sarazenen vor der Stadt schon Freudentänze auf und glaubten an einen schnellen und vollständigen Sieg.
Als der Beschuss endlich aufhörte, nutzten Balian und Almaric die Zeit relativer Ruhe, um die Vorräte in den Kellern unter der Burg zu kontrollieren. Balian sah sich unter den Krügen, Kisten und Tonnen dort unten um.
►„Wie lange reichen unsere Vorräte?“, fragte er Almaric.
„Zehn Tage“, erwiderte der. ◄
„Das war erst der erste Tag – es könnten noch hunderte folgen“, gab Balian zu bedenken. Besorgnis lag in seinem ebenmäßigen Gesicht, das vom Ruß der Brände verschmutzt war. Almaric erwiderte den besorgten Blick des jungen Heerführers.
„Salahadin wird kein Erbarmen haben“, warnte er. Angesichts der hier vorhandenen Vorräte war es offensichtlich, dass Jerusalem eine lange Belagerung nicht durchhalten konnte. Balian teilte seine Sorge um die Vorräte.
„Wir müssen standhalten und ihn zwingen, Bedingungen zu stellen“, sagte er.
„Was für Bedingungen?“, erkundigte sich sein Hauptmann.
„Wir kämpfen für die Menschen, für ihr Leben; für ein Leben in Freiheit und in Sicherheit.“
Almaric sah ihn zweifelnd an. Wie sollten sie standhalten? Reserven gab es weder für die Ritter und Soldaten noch hinsichtlich der Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser. Doch der Hauptmann sah auch die Entschlossenheit in Balians Blick …
Kapitel 52
Vergeltung
Am Morgen gab es in Jerusalem zwar eine Menge Trümmer und leider auch einige Tote zu beklagen, aber von dem einen in der Nacht zerstörten Katapult abgesehen, waren die an den Mauern in Sicherheit gebrachten Katapulte und Schleudern unbeschädigt und einsatzfähig. Balian ging auf den Wehrgang der Außenmauer am Damaskustor, während die Bedienmannschaften ihre Geschütze in die vorher von ihm ausgemessene Position rollten.
Ihm bot sich ein Bild, wie er es noch nie gesehen hatte: Eine schier unübersehbare Masse von Soldaten war zum Sturm auf Jerusalem angetreten. Sie standen in Reih und Glied, blockweise zu Einheiten geordnet. In regelmäßigen Abständen standen Belagerungstürme bereit, um an die Mauern geschoben zu werden. Es war eine ungeheure Übermacht, die Saladin gegen Jerusalem aufgeboten hatte.
Dieser Morgen begann für die Moslems der Armee Saladins wie jeder Morgen, seit sie ihre Glaubenspflichten übernommen hatten: mit dem Frühgebet. Muezzine in der Armee riefen die Gebetsformeln aus, die Männer antworteten und knieten wie vorgeschrieben nieder, berührten mit der Stirn die Erde.
Saladin, Imad und Khaled, der junge Mullah, saßen zu Pferd vor den vordersten Linien der Sarazenen. Imad sah den Sultan an.
„Habt Gnade“, bat er. Saladin schüttelte den Kopf, ohne seinen Feldherrn anzusehen.
„Nein, das geht nicht!“, antwortete er grimmig. Die Männer hinter ihm bekamen einen kurzen Wink, und einer führte einen Esel vor die Linien. Darauf saß – nur mit einem Lendenschurz bekleidet, eine Narrenmütze aus Papier auf dem Kopf und das Gesicht dem Hinterteil des Esels zugewandt – König Guy von Jerusalem, der Lächerlichkeit preisgegeben.
Wie alle anderen auf der Mauer sah Balian das Jammerbild des gefangenen Königs. Aber wenn Saladin hoffte, die Verteidiger von Jerusalem damit zu erschrecken oder zu demoralisieren, dann hatte er sich geirrt. In Jerusalem gab es niemanden, der für Guy in seiner misslichen Situation Mitleid empfunden hätte. Seine Lage hatte sich der hochmütige König selbst zuzuschreiben – und er war es gewesen, der Jerusalem durch seine verfehlte Politik und seine Kriegslüsternheit überhaupt erst in die jetzige Situation gebracht hatte. Nein, das Volk von Jerusalem, seine Königin und der junge Konstabler der Stadt hatten keine Sympathien für den König. Balian wurde in diesem Moment bewusst, dass seine Vermutung bezüglich des Königs zutraf, dass es für ihn und Sibylla wirklich keine Zukunft geben konnte. Guy lebte tatsächlich, mochte er auch gedemütigt sein – und er hatte als Gefangener Saladins sehr viel größere Überlebenschancen als alle Männer, die Jerusalem nun mit ihrem Leben verteidigen würden.
Der Esel wurde samt seinem unglücklichen Reiter wieder hinter die Linien der Sarazenen geführt, dann ballte Saladin für die Männer in den ersten Reihen sichtbar die rechte Faust in Höhe seiner Schulter und gab so das Zeichen zum Angriff. Auf der gesamten Front gingen Fußsoldaten hinter den ebenfalls nun vorrückenden Angriffstürmen vor, unterstützt von Steinschleudern, die außer Steinen wiederum auch Brandgeschosse auf die Stadt warfen.
Balian sah die Armee anrücken, aber die Fußsoldaten interessierten ihn momentan noch nicht. Er beobachtete die Angriffstürme, sah, dass sie die erste Markierung erreichten – und dass die kleinen Steinhäufchen, die nur auf der der Stadt zugewandten Seite geweißelt waren, erwartungsgemäß von den Angreifern übersehen wurden …
„Vierhundert!“, schrie er. Seine Führungsmannschaft nahm das Signal auf und gab es an die Geschützmannschaften weiter. Der Konstabler bemerkte, dass alle das Signal bekommen hatten und bereit waren.
„Und – los!“, schrie er. Almaric und die anderen Unterführer gaben den Befehl weiter. Diejenigen, für die diese Markierung das Zeichen war, lösten die Sperren ihrer Katapulte. Die Geschosse – meist riesige Steine, aber ebenso Feuertonnen – flogen über die Mauer und trafen die Türme mit der Präzision eines gezielten Pfeils – nur mit erheblich größerer Zerstörungskraft und an genau der Stelle, an der sie am empfindlichsten waren. Die Stellungen der Katapulte waren von Balian so berechnet, dass sie ihre maximale Gewalt an oder kurz nach dem Markierungspunkt entfalteten. Entsprechend war die Wirkung, je nachdem, wie rasch die auf vierhundert eingestellten Katapulte laden und wieder schießen konnten. Gingen die Salven zu früh oder zu spät los, verfehlten sie das Ziel. Doch die meisten Schüsse waren regelrechte Volltreffer, die zahlreiche Türme schon auf weite Entfernung zerfetzten.
Die Markierung dreihundert wurde erreicht, wieder brüllte Balian das Signal, wieder reagierten die entsprechenden Leute rasch – und wieder brachen viele Türme zusammen. Doch nun wurden nicht nur Steine und Brandgeschosse geschleudert, sondern auch Tonbehälter, die mit Öl gefüllt waren. Die Behälter zerschellten auf den Türmen, der Inhalt ergoss sich über die hölzerne Konstruktion, über die darin auf den Angriff wartenden Soldaten und die Mannschaften, die die Angriffstürme schoben.
Bei Markierung einhundertfünfzig schossen die Bogenschützen, was die Bögen und Köcher hergaben, überschütteten die Sarazenen mit Wolken aus Pfeilen. Jetzt waren die Sarazenen nahe genug heran, um selbst Pfeile auf die Mauern zu schicken. Die ersten Verteidiger wurden von Pfeilen getroffen und stürzten über die Mauer oder wurden rücklings vom Wehrgang geworfen.
An allen Seiten erreichten nur wenige Türme überhaupt die Mauer. Es waren die wenigen Fälle, in denen die Steingeschosse der Verteidiger zum unpassenden Zeitpunkt abgeschossen worden waren. Einige glänzten feucht, wo die ölgefüllten Tonflaschen getroffen hatten. An der Seite, an der auch Balian war, flog ein Schwarm ölgefüllter Krüge auf zwei der Türme, die eben gerade die Mauerkrone erreicht hatten.
„Stoppt den Angriff! Wartet!“, bremste Balian die übereifrigen Verteidiger, als er sah, dass sie ihre Brandflaschen zu früh warfen. Die Männer gehorchten. Der Baron nahm Maß. Jetzt passte es.
„Und los!“, befahl er.
Die Sturmbrücke fiel, krachte auf die Mauer, die Verteidiger warfen Ölflaschen mit brennenden Dochten – und die Türme gingen in Flammen auf. Brennende Menschen stürzten schreiend von den Sturmbrücken, die Flammen fraßen sich rasend schnell nach unten durch.
Am Damaskustor versuchte eine Truppe Sarazenen, mit einem Widder* das Tor einzurammen. Balian bemerkte die Aktivität unten und rannte eilig auf den Wehrgang über dem Tor. Er sah nach unten.
„Das Öl!“, schrie er.
Zähflüssiges, rabenschwarzes Öl wurde aus großen Tonnen von den Mauern gegossen.
„Jetzt!“, befahl Balian. „Feuer!“
Er warf als Erster seine Feuerflasche, seine Männer folgten dem Befehl und warfen nochmals Feuerflaschen hinunter. Der hölzerne Widder ging samt seinem gezimmerten Schutzdach und der Bedienungsmannschaft in Flammen auf. Das Sterben der Sarazenen vor den Mauern Jerusalems war grauenhaft.
Es wurde Abend. Hüben und drüben trug man Verwundete und Tote zusammen, bestattete die Toten und versorgte die Wunden der Überlebenden.
Saladin saß mit Imad in seinem großen Zelt und war zugleich erschrocken und beeindruckt, dass der Anführer der Jerusalemer geschickte Taktiken anwandte oder Waffen gänzlich anders einsetzte als üblich. Er hatte schon erkannt, dass es nicht Tiberias war, der die Jerusalemer führte; dem älteren Konstabler hatte er solche taktischen Raffinessen auch wirklich nicht zugetraut.
„Wer führt sie an?“, fragte er Imad.
„Balian von Ibelin, der Sohn Godfreys“, antwortete Imad.
„Godfrey? Godfrey hätte mich im Libanon beinahe umgebracht!“, keuchte Saladin. Wenn es einen Ritter Jerusalems gab, vor dem er wirklich Respekt hatte, dann war es Godfrey von Ibelin.
„Ich wusste nicht, dass er einen Sohn hatte“, zweifelte er dann.
„Der Mann in Kerak war sein Sohn“, half Imad dem Gedächtnis seines Herrn auf die Sprünge.
„Der, den du am Leben gelassen hast?“, hakte Saladin nach. Imad nickte.
„Vielleicht hättest du das besser nicht getan“, grollte der Sultan seufzend. Imad lächelte verbindlich.
„Vielleicht … hätte ich einen anderen Lehrer haben sollen“, erwiderte er. Tatsächlich hatte er sich in seiner Handlungsweise stets stark an Saladin orientiert – er war nahe bei einem großen König und lernte auch von ihm. Und diese Art Großmut, die die Güte eines anderen vergalt, hatte er von Saladin gelernt. Der erwiderte Imads freundliches Lächeln. Sie waren sich in vieler Hinsicht ähnlich – so ähnlich wie sich Balian und Godfrey auch waren.
Während Imad und Saladin sich ihre Gedanken zu Balian machten, machte der junge Baron einen erneuten Kontrollgang um die Mauern. Vor den Mauern brannten die Angriffstürme der Armee Saladins. Er fragte sich, welche Mittel der Sultan noch aufbieten würde, um die Stadt zu erobern – und er fragte sich, ob seine Vorbereitungen und seine geplanten Gegenangriffe ausreichten, um Saladin solange die Stirn zu bieten, dass er Bedingungen akzeptieren musste … Einstweilen hatte er aber noch einige Überraschungen für Saladin parat.
Sibylla war erschüttert über die schreckliche Zahl der christlichen Toten. Vor Scham und Trauer griff sie zur Schere, setzte sich vor den Spiegel und schnitt sich die Haare ab. Sie wollte Buße tun für das, was sie getan hatte. Der Metallspiegel war nicht wirklich glatt, vielmehr war die polierte Oberfläche unregelmäßig gewellt, so dass sie kein ebenes Spiegelbild ihrer selbst sah. Als sie eine besonders widerspenstige Locke abschneiden wollte, verzerrte sich ihr Spiegelbild – und nahm die leprazerstörten Züge ihres toten Bruders an. Ihr toter Bruder mahnte sie, sich seiner Ansichten zu erinnern. Sie erschrak, als sie feststellte, dass sie den Untergang Jerusalems durch eine Reihe Fehler mit verursacht hatte:
Da war der Plan, Guy durch den Henker beseitigen zu lassen und Balian zu heiraten; ein Plan, der weder dem Wesen ihres Bruders noch dem Balians entsprochen hatte. Sie hatte damit nicht nur ungewollt einen Keil zwischen Balduin und den Mann ihrer Wahl getrieben, sie hatte mit Balians Verweigerung die Liebe ihres Lebens verloren.
Da war der Fehler, mit Guy eine Vereinbarung treffen zu wollen, nach der ihr Sohn – und damit sie selbst – die Hoheit über dessen Ritter hatte. Sie hätte wissen müssen, dass Guy sich entweder nicht an eine solche Vereinbarung halten würde oder durch den Großmeister de Ridefort Mittel und Wege finden würde, ihr die eben übertragene Macht wieder zu nehmen.
Da war der Fehler, Guy zum König zu krönen. Dieser Fehler war der schlimmste, denn er hatte de Lusignan jede Macht gegeben, die er sich nur wünschen konnte – auch wenn seine Wünsche schier keine Grenzen kannten. Aber der König von Jerusalem war nun einmal der nahezu absolute Herrscher in Jerusalem selbst … Erst die Krönung hatte Guy diese ungeheure Machtfülle verliehen.
Sie hatte die Wahl gehabt, über den neuen König zu entscheiden. Sie hätte keinen König krönen müssen, sie hätte auch einen Bailli bestimmen können, einen Regenten, der dieselben Befugnisse hatte wie ein König, ohne selbst König zu sein. Der Bailli musste nicht zwangsläufig mit der Königin verheiratet sein. Balian, der ihrem Bruder in seinen geradlinigen Ansichten so ähnlich war, wäre Jerusalem ein guter Regent gewesen; ein gerechter und sanftmütiger Regent, der gleichwohl seine Untertanen zu begeistern wusste, indem er mit eigenem und gutem Beispiel voranging. Sie hatte es in Ibelin gesehen … Sie sah es jetzt in Jerusalem, wo er aus ängstlich zitternden Untertanen tapfere Ritter gemacht hatte, die Jerusalem mit ihrem Leben verteidigten. Und Balian von Ibelin selbst stritt in vorderster Reihe tapfer für sie, die Königin, und für das Volk. Dabei hatte sie nie vorgehabt, ihn zum Regenten zu machen. Selbst, als sie seine Liebe für ihre Zwecke hatte missbrauchen wollen, hatte sie nie die Absicht gehabt, ihre Macht mit ihm zu teilen. Sibylla schämte sich noch mehr.
Zutiefst geschockt erkannte sie, dass das Abschneiden der Haare für das, was sie angerichtet hatte und für das, was auf den Mauern dieser Stadt geschah, keineswegs ausreichend war – welches Opfer es auch für eine Frau sein mochte, die stets voller Freude ihr langes Haar gepflegt hatte und es liebte, wenn es im Wind wehte. Sie legte die königlichen Trauergewänder ab, zog ein Büßerkleid an und ging auf geheimen Wegen in die Katakomben der Stadt, wo sich die Ärzte um die Verwundeten kümmerten.
Kapitel 53
Der dritte Tag
Die Nacht wurde zu einem neuen Tag und mit ihm rannten die Sarazenen wieder gegen die Mauern Jerusalems an. Die wenigen verbliebenen Angriffstürme wurden wiederum mit Öl und Feuer attackiert.
Doch die Sarazenen setzten nun auch Sturmleitern in einer Anzahl ein, dass die anstürmenden Truppen nicht überall rechtzeitig mit siedendem oder brennendem Öl abgewehrt werden konnten. Bogenschützen unterstützten den Sturm auf die Mauern, von oben her regneten ebenfalls Pfeile auf die Angreifer hernieder.
Allen Abwehrmaßnahmen zum Trotz gelang es nun doch immer wieder einzelnen Männern oder auch größeren Gruppen der Sarazenen, die Mauerkrone zu erreichen. Wo sie auf die Mauerkrone sprangen, entbrannte ein gnadenloses Gefecht Mann gegen Mann. Man zerriss sich dort mit Schwertern, Äxten und Dolchen. Einigen dieser Männer gelang der Durchbruch bis auf einen Mauerturm, den die Fahne von Jerusalem schmückte. Sie rissen sie herunter und pflanzten die Fahne des Propheten dort auf.
Der Jubel, den diese Tat bei den Sarazenen auslöste, währte nicht lange. Balian, dadurch auf das Geschehen am Turm aufmerksam geworden, konnte diesen Zwischenerfolg nicht zulassen, wollte er die Kampfmoral der Verteidiger Jerusalems erhalten. Almaric und Michel, in deren Bereich der Turm lag, steckten zu tief im Kampfgetümmel und hatten keine Chance, den Turm noch zu erreichen. Balian entschied sich, es allein zu versuchen.
Entschlossen stieg er eilig zu dem Turm hinauf, entriss einem der Männer, der gerade anderweitig beschäftigt war, dessen Schwert und stürmte – in jeder Hand ein Schwert – alles vor sich niederhauend, nötigenfalls auch mit herzhaften Fußtritten nachhelfend, mutterseelenallein den Turm. Zweien zerschnitt er mit wuchtigen Kreishieben seiner Schwerter die Sehnen in den Kniekehlen. Die Männer stürzten schreiend in die Tiefe und zerschmetterten fünfzig Fuß tiefer auf dem harten Boden vor der Mauer.
Einer der Sarazenen konnte noch einen harten Hieb anbringen, der Balians Kettenhemd am linken Arm aufriss und eine tiefe Wunde hinterließ, aus der das Blut des Barons von Ibelin einen halben Klafter weit spritzte. Balian schrie schmerzvoll auf, verlor das Schwert, das er in der linken Hand gehalten hatte und setzte den Kampf um den Turm allein mit Schwert Ibelins fort. Der Mann, der ihn verwundet hatte, hatte nicht lange etwas von seinem Triumph, als ein wuchtiger Hieb mit dem Schwert Ibelins sein Leben beendete.
Trotz der schmerzhaften Verwundung gelang es Balian schließlich, alle Eindringlinge dort zu fällen und den Turm zurückzuerobern. Er ließ sein eigenes Schwert fallen, riss die sarazenische Fahne aus der Halterung und schleuderte sie mit fürchterlicher Wucht wie einen Speer weit von der Mauer fort. Sein grimmiger Blick traf fast genau gegenüber auf den Saladins, der seinerseits in diesem mutigen Mann den Anführer der Verteidiger Jerusalems erkannte.
Saladin nickte anerkennend. Der Mann war ein Löwe! Er war seinen Männern ein leuchtendes Vorbild an Mut und Entschlossenheit und damit riss er sie mit. Der Alleingang an diesem Turm war an Verwegenheit kaum noch zu überbieten.
Fast im selben Moment spürte Balian den Schmerz in seinem linken Arm, den er bis jetzt fast völlig ignoriert hatte. Unwillkürlich griff seine Rechte nach dem schmerzenden linken Unterarm und zog ihn entlastend an den Körper. Dann hob er die Rechte wieder hoch. Den verwundeten linken Arm eng an den Körper gepresst, gab er weiteren Geschützführern einen heftigen Wink.
„Zum Angriff!“, kommandierte er und nahm sein Schwert wieder auf.
Vier der verbliebenen Angriffstürme waren durchgedrungen und standen angriffsbereit an der Mauer. Doch diese Türme bekamen die technische Raffinesse des erfinderischen Hufschmieds zu spüren. Balian hatte Skorpione, große, überdimensionale Armbrüste, auf die Mauern stellen lassen, mit denen armdicke Pfeile von fast einem Klafter Länge verschossen werden konnten. Normalerweise benutzte man diese Waffe als Sturmhilfe, um Kletterseile oder Leiterbefestigungen von außen an eine Festung zu schießen. Jetzt krachten die von den Riesenarmbrüsten abgeschossenen Pfeile seitlich in zwei der Türme hinein. Die starken Leinen an den Pfeilen waren jeweils an einem Gegengewicht befestigt, das nach dem Eindringen der Pfeile in die Angriffstürme hinter der Mauer, auf der die Armbrüste standen, fallen gelassen wurde. Die Wirkung war für die Sarazenen geradezu verheerend: Das Gegengewicht war so massiv, dass es den Turm schlicht umriss – mit Mann und Maus. Einer der so getroffenen Türme stand recht nahe an einem anderen; so nahe, dass er diesen beim Sturz aufriss und tragende Teile zerstörte, so dass auch der zweite Turm zusammenbrach. In diesen vier Türmen und in deren näherer Umgebung starben allein auf dieser Seite hunderte Sarazenen.
Saladin war geschockt, aber ebenso angetan von der raffinierten Kreativität dieses jungen Feldherrn, der seine Waffen geradezu genial nutzte. Warum nur mussten sie Feinde sein? fragte sich der Sarazenenherrscher. Er gestand sich ein, dass er diesen Mann gern zum Freund gehabt hätte. Sein Blick kreuzte den Imads, und der Sultan spürte, dass sein Schüler ebenso von widersprüchlichen Gefühlen übermannt wurde wie er selbst. Beide wünschten sich einen Sieg ihrer Truppen, aber beide wollten sie diesen Mann nicht besiegt wissen – und schon gar nicht in Ketten und gedemütigt. Es musste doch eine andere Lösung geben …
Wieder senkte sich Dunkelheit auf das Schlachtfeld, wieder wurden Verwundete und Tote zusammengetragen.
Kapitel 54
Gott ist uns gnädig
Während Sibylla in den Katakomben von Jerusalem ihren Dienst tat, war einer ihrer Patienten François, der ehemalige Totengräber, der nun hier in Diensten stand. Sibylla verband seine Wunden, als François sie diskret auf Balian aufmerksam machte, der nun endlich Zeit fand, seine am Vormittag im Kampf um den Mauerturm erlittene Verwundung richtig behandeln zu lassen. Sie sah kurz hoch und blickte dann beiseite. Er ging an ihr vorüber, ohne sie zu bemerken und setzte sich zu einem Medicus, bei dem der Behandlungsplatz gerade frei geworden war. Der Medicus legte eine notdürftig abgedeckte, tiefe Wunde in Balians linkem Unterarm frei, die fast bis auf den Knochen ging. Der junge Mann sah beiseite, als der Arzt die Wunde reinigte, nähte und dann wieder sorgsam verband.
François nahm Sibyllas Reaktion verblüfft zur Kenntnis. Als sie seinen erstaunten Gesichtsausdruck sah, fragte sie sich, ob ihr Patient wusste, was zwischen ihr und Balian gewesen war oder ob er es einfach nur seltsam fand, dass eine Frau sich für diesen Mann nicht interessieren wollte. Tatsächlich hatte sie mehrere Gründe, sich vor ihm zu verbergen. Sie wollte nicht von ihm gesehen werden, nicht hier und nicht in diesem Zustand mit Büßerkleid und abgeschnittenen Haaren. Sie wollte auch für das Buße tun, was sie ihm zugefügt hatte, aber noch sollte er es nicht wissen. Sie konnte ihm noch nicht wieder in die Augen sehen. Zu sehr schämte sie sich.
„Ihr seid keine Schwester …“, sprach François sie an. Sie sah kurz hoch und lächelte verlegen.
„Wir sind, was wir tun“, erwiderte sie leise. Der ehemalige Totengräber erwiderte ihr leichtes, verlegenes Lächeln.
„Dann bin ich ein Mann, der einen langen Weg gereist ist, um für nichts zu sterben. Was würdet Ihr dazu sagen?“, fragte er. Es erschien ihm zu wenig, nur für das Leben der Menschen hier, für das eigene nackte Leben zu kämpfen. Er war hergekommen, weil er sich hier ein besseres Leben versprochen hatte, Wohlstand, vielleicht Land – gefunden hatte er nur Kampf und Tod. Dass sein Dienstherr ihn mit einer Rüstung ausgestattet hatte, die ebenso teuer wie gut war, spielte für ihn nur eine untergeordnete Rolle. Sie gehörte ihm nicht. Er hatte bisher persönlich nichts von dieser Reise gehabt, sah man vom Ritterschlag ab, aber der alleine machte nicht satt … Ihr Lächeln wirkte gequält. Nein, es war nicht nichts, wofür Balian und die Ritter Jerusalems kämpften … Aber dieser Mann würde das nicht begreifen.
„Ich … würde sagen, dass es mir Leid tut“, erwiderte sie, eigentlich mehr, um überhaupt etwas zu sagen. In den letzten Tagen hatte sie kaum einen klaren Gedanken fassen können, war eingeklemmt in der Trauer um ihren Sohn, der Angst um Balian und der Angst vor ihrem Ehegatten, der zwar Gefangener Saladins war, aber sehr wohl am Leben war. Sie schloss den letzten Verband. François erhob sich.
„Ihr tut mir Leid …, Königin von Jerusalem“, sagte er. Sie sah ihn erschrocken an. Er wusste also, wer sie war. Ob er auch von ihr und Balian wusste? François ging mit einem wissenden Lächeln fort.
Sie renkte sich fast den Hals nach Balian aus, der mit dem Rücken zu ihr saß. Wenn er jetzt hierher kam und sich zu einem Medicus setzte, war er verwundet; für sie eine schlimme Vorstellung. Sie sah die Wunde, die ihr Geliebter im Kampf davongetragen hatte und konnte ihn nur noch bewundern, dass er den ganzen Tag damit noch heftig gefochten hatte. Offenbar war er ebenso hart im Nehmen wie sein seliger Vater. Sie hatte einerseits den Wunsch, ihn selbst zu behandeln und ihn um Verzeihung zu bitten, aber andererseits hatte sie große Zweifel, dass sie diese Wunde hätte nähen können, wenn er bei vollem Bewusstsein war. Sie hätte auch nicht gewusst, wohin mit ihren Blicken, denn Balian jetzt in die Augen zu sehen, in denen Müdigkeit und Erschöpfung unübersehbar waren, hätte sie fast um den Verstand gebracht. Vielleicht hätte sie sich dazu durchringen können, ihn um Verzeihung anzuflehen. Aber wenn er ihr verziehen hätte, hätte keine Macht der Welt sie davon abhalten können, ihn zu umarmen – und den Rest dieser Nacht mit ihm zu verbringen. Sibylla sehnte sich unendlich nach seinen Zärtlichkeiten und gleichzeitig wusste sie nicht, ob sie sie ertragen hätte.
Die Situation nahm ihr die Entscheidung ab, weil bei ihrem Tisch die Wartenden Schlange standen. Sie gab sich einen Ruck und winkte den nächsten Verwundeten zu sich heran.
Die sarazenischen Gefallenen lagen, entsprechend dem islamischen Bestattungsritus in Leinentücher gehüllt, in einem Massengrab. Es war eine riesige, weiße Fläche, vor der ein sichtlich erschütterter Sultan Saladin stand und in tiefer, ehrlicher Trauer das islamische Totengebet für seine treuen Gefolgsleute sprach. Dann schlug er vor Trauer und Entsetzen die Hände vor das Gesicht, als das Massengrab zugeschüttet wurde.
In der belagerten Stadt hatten die Männer auf Balians Anweisung ebenfalls die Toten zusammengetragen. Der junge Konstabler Jerusalems hatte dafür den ganzen Vorhof eines Tores räumen lassen und eine flache Grube ausheben lassen, um die Toten zu verbrennen. Er hatte sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber François, der Totengräber, hatte ihn darauf hingewiesen, dass Leichen aus gutem Grund außerhalb bewohnter Stätten begraben wurden. Zu groß war die Gefahr, dass verwesende Leichen, die innerhalb der Mauern einer Stadt vergraben wurden, das Grundwasser vergifteten – besonders, wenn sie in großer Zahl beerdigt wurden. In die gleichen Leichentücher gehüllt wie ihre moslemischen Kontrahenten draußen vor der Stadt, lagen die christlichen Toten nebeneinander und übereinander in der Grube. Der Patriarch Heraclius hatte die Vorbereitungen unten im Hof mitbekommen und erfahren, dass die Leichen verbrannt werden sollten. Er stürmte in den Hof.
„Wenn ein Körper verbrannt wird, kann er nicht wieder auferstehen bis zum Jüngsten Tag!“, warnte er. Balian sah ihn offen an.
„Wenn wir diese Körper nicht verbrennen, wird die Stadt binnen drei Tagen verseucht sein, und wir werden alle sterben. Gott wird es verstehen, Eure Heiligkeit. Und wenn er es nicht versteht, ist er nicht Gott – und wir haben keinen Grund zur Sorge“, versetzte er, nahm einem der Männer die Fackel ab und warf sie auf den ölgetränkten Leichenhaufen. Die anderen Männer taten es ihm gleich und in wenigen Augenblicken brannte der Leichenhaufen lichterloh.
Kapitel 55
Das Tor nach Jerusalem
Während Saladin bei der Totenfeier gewesen war und auch die Christen mit der Bestattung ihrer Gefallenen beschäftigt gewesen waren, hatten Imad und Raschid im Auftrag des Sultans die Mauern von Jerusalem näher in Augenschein genommen, als es bisher möglich gewesen war.
Als Saladin zurückkehrte, wurde er in seinem Zelt von einem freudestrahlenden Imad empfangen.
„As-Salam ’alaykum“, grüßte der Sultan, als er seine Kundschafter sah.
„U ’alaykum as-Salam“, erwiderte Imad den Gruß. „Die Mauer, an der früher das Christophorustor war, ist geschwächt“, erklärte Imad frohlockend.
„Ja“, warf Raschid ein, „wenn man ein Tor zumauert, dann ist es schwächer, als die Mauer drumherum.“
Ibn Jubayr, der Mullah, sah ihn skeptisch an.
„Oder stärker“, mutmaßte er.
„Es ist schwächer“, widersprach Imad. „Raschid hat es gesehen“, setzte er hinzu und deutete auf seine Augen, damit der Mullah es auch bestimmt begriff. „Dies … wird unser Tor nach Jerusalem“, erklärte er. Ibn Jubayr sah Imad und Raschid immer noch ungläubig an, aber Saladin nickte.
Jerusalems Mauern bestanden – wie praktisch alle Festungsmauern – aus zwei parallel aufgemauerten Wänden aus Natursteinen, die aus dem Fels gewonnen waren, auf dem die Stadt errichtet worden war. Der Zwischenraum dieser beiden Wände war am Fundament am breitesten; in Jerusalem betrug der Abstand im Fundament über zwei Klafter. Zur Mauerkrone hin verjüngte sich dieser Abstand bis auf etwa einen Klafter. Dieser breite Zwischenraum wurde beim Bau dann mit Bauschutt, Sand und Kies aufgefüllt. Auf diese Weise hatten die äußeren Steinschichten eine gleichsam federnde Lagerung, die eine Zerstörung der Außenmauer durch Beschuss mit Steinen unmöglich machte. Nur ein Stein, der sich auf einer harten Unterlage befindet, kann zerschlagen werden. Ein Stein auf einer weichen Unterlage widersteht jedoch auch noch so harten Schlägen. Als Erste hatten das die israelitischen Verteidiger der Bergfestung Masada erkannt und die einzige künstliche Mauer so gepolstert. Die Römer hatten Masada nicht mit ihren Katapulten brechen können.
Als das Christophorustor aber zugemauert worden war, war dort nur eine, wenn auch sehr starke, Steinschicht eingesetzt worden – aber diese Steinschicht hatte kein weiches Widerlager und war daher im Wortsinn zerbrechlich. Diese Schwachstelle meinte Raschid, als er mit Imad Saladin davon berichtete. Saladin nickte zustimmend.
Eben diesen Schwachpunkt in der Mauer hatte auch Balian ausgemacht. Schon gleich zu Beginn des sarazenischen Angriffs hatte er das zugemauerte Tor mit zusätzlichen Balken abstützen lassen, doch die Sarazenen hatten ihre Angriffe bisher auf andere Teile der Stadtmauer konzentriert. Nachdem Saladin nun aber sämtliche Belagerungstürme verloren hatte, konnte nur noch ein direkter Durchbruch durch die Mauer einen Sturmangriff ermöglichen. Wenn es einen Punkt gab, an dem die Mauer mit Katapultgeschossen zerstört werden konnte, dann war er hier. Nachdenklich ging Balian nach der Feuerbestattung der Gefallenen zum Christophorustor. Almaric wich auch hier seinem jungen Heerführer nicht von der Seite. Der Blick des Barons ging zu den massiven Balken, mit denen die Mauer verstärkt war.
„Hier … werden wir dem Feind in die Augen sehen“, sagte er. „Wir müssen uns vorbereiten“, setzte er hinzu und winkte Almaric.
Der vierte Tag brach an, und die Muslime waren angriffsbereit vor den Mauern Jerusalems aufmarschiert. Ibn Jubayr war inzwischen davon überzeugt, dass der Durchbruch durch die Mauer heute gelingen würde und schwor die Männer auf das Blutbad der Rache ein.
„Brüder!“, rief er und gestikulierte herrisch mit der rechten Hand. „Brüder! Gott hat euch diesen Tag geschenkt! Ihr werdet keine Gefangenen machen! So, wie sie es taten, so soll es getan werden! Allahu akbar!“
„Allahu akbar!“ riefen die Männer, die ihn hörten.
„Allahu akbar!“, schrie er erneut, die Männer antworteten, und Khaled ibn Jubayr konnte gar nicht mehr aufhören, Gottes Größe mit diesem Ruf zu preisen. Was er nicht sah, war das zweifelnde Gesicht Imads, den dieser Fanatismus nur noch abstieß.
Saladin gab den Geschützmannschaften ein Zeichen und der Beschuss des Tores begann.
Balian hatte zur selben Zeit fast sämtliche Ritter Jerusalems im Vorhof des Christophorustores versammelt. Es konnte auch keinem entgangen sein, dass die Sarazenen im Schutz der Nacht praktisch alle Katapulte und Steinschleudern vor dem zugemauerten Christophorustor konzentriert hatten. Das Geschrei war ebenfalls nicht zu überhören gewesen, die ersten Brocken krachten schon in die Steine der Mauer. Jeder in Jerusalem erwartete den nächsten Angriff hier.
Der Konstabler stand unter dem Torbogen des inneren Tores, die Kettenkapuze bereits über dem Kopf, den Helm noch unter dem Arm. Er übersah die immer noch stattliche, aber doch geschmolzene Zahl der Verteidiger. Kaum einer hatte lange geruht, sie waren erschöpft, übernächtigt, zum großen Teil mit kleineren Verwundungen auch nicht mehr voll kampffähig – aber es war keiner darunter, der in diesem Augenblick nicht hätte kämpfen wollen. Balian wies mit einer ausholenden Bewegung auf die abgestützte Mauer hinter sich.
„Wenn diese Mauer fällt, wird es kein Erbarmen geben! Wenn ihr eure Waffen streckt, werden eure Familien sterben“, sagte er warnend. Jeder hier im Hof hatte von der Grausamkeit der Christen gehört, die in Jerusalem nach der Eroberung ein Blutbad angerichtet hatten und weder Frauen noch Kinder oder Alte verschont hatten. Selbst Christen orthodoxer Konfession waren niedergemetzelt worden. Niemand erwartete ernsthaft, dass die Sarazenen anders handeln würden.
„Wir haben die Chance, diese Truppen zu zerschlagen!“, rief Balian dann. „Deswegen sage ich: Lassen wir sie kommen!“
Damit drehte er sich um und schüttelte die Faust zum Tor.
„Los, kommt schon!“, rief er und die Männer nahmen den Ruf ihres Kommandanten auf, der ihnen erneut Zuversicht vermittelte und sie damit mitriss.
Als ob sie das Signal aus der Stadt gehört hatten, erhöhten die Bedienmannschaften der Katapulte der Sarazenen fast genau in diesem Moment die Geschwindigkeit, in der sie ihre Geschosse auf das zugemauerte Tor schleuderten. Der Hagel von großen Steinen und Tonnen mit griechischem Feuer konzentrierte sich allein auf den Doppelbogen des zugemauerten Tores, das unter den immer häufigeren Einschlägen bebte.
Kapitel 56
Von Mann zu Mann
Nach längerem Beschuss lösten sich die ersten Brocken aus der Mauerkrone, während die Verteidiger innen sahen, wie die Mauer unter den Einschlägen bebte, die Stützbalken bis zu einer ganzen Elle von der Mauer flogen, um sich dann wieder an ihren Platz zu senken. Die Sarazenen schossen weiter, was die Katapulte hergaben – und dann brach die gesamte Mauer um das Christophorustor mit lautem Krachen zusammen.
Balian und seine Männer hatten weit genug entfernt gestanden, so dass sie nicht von herumfliegenden Mauerbrocken gefährdet wurden. Als die Mauer nun zusammenstürzte, rannten sie los – kaum, dass der Staub sich nur etwas legte – um die Bresche rechtzeitig zu besetzen. Balian warf seinen Schild fort und verließ sich lieber allein auf das beidhändig geführte Schwert Ibelins, viele seiner Männer taten es ebenfalls.
Die Sarazenen hatten den weiteren Weg, aber auch sie rannten sofort los, nachdem die Mauer einknickte. Doch die Bresche war von den Jerusalemern besetzt, bevor die Leute Saladins sie erreichten. Die Heere stießen knapp außerhalb der Bresche zusammen, und Balian war der Erste, der Feindberührung hatte. Mit dem beidhändig geführten Schwert eröffnete er den entbrennenden Nahkampf.
Mitten im Getümmel stach er einen Sarazenen nieder, dann griffen ihn mehrere Sarazenen von hinten an. Zunächst steckte er zwischen ihnen fest, verlor sein Schwert, doch dann gelangte er an einen Rabenschnabel und konnte sich eines Gegners entledigen. Der fallende Sarazene machte den Weg frei zu einem Sarazenenschwert, das in einem Toten steckte. Balian griff das Sarazenenschwert und hieb damit heftig auf den nächsten Gegner ein.
Michel und Almaric bemühten sich verzweifelt, zu ihrem Heerführer durchzukommen, der sich gegen eine Übermacht wehrte. Michel griff sich einen riesigen Brocken, der aus der Mauer gebrochen war, stemmte den Stein hoch und schleuderte ihn mit gekonnter Präzision auf einen Sarazenen, der den Stein zwar mit dem Schild abwehren konnte, aber bedrohlich ins Schwanken geriet, als ihn diese Masse traf. Ein weiterer drang mit einer Streitaxt auf Almarics Stellvertreter ein. Michel konnte ihn mit dem Schild abwehren. Ein anderer Maure wollte ihn von hinten greifen, doch Almaric fing den Angreifer gerade noch ab, bevor er Michels Kehle zu fassen bekam. Ein dritter griff beherzt zu, um Michel an weiteren Würfen dieser Art zu hindern; ihm gelang es, Almarics Stellvertreter rücklings zu Boden zu reißen.
Almaric hatte schon den nächsten Feind gegen sich, der speerschwingend auf ihn losging, konnte den Stich mit dem Schild abfangen und den nächsten Hieb mit dem Schwert parieren, aber der übernächste Stich brachte ihn auf dem unebenen Terrain aus dem Gleichgewicht. Almaric stürzte und schlug nur knapp neben einem Mauerbrocken auf. Die Sonne blendete ihn, er verlor den Schild, sprang wieder auf die Füße und ging dem Sarazenen mit bloßen Händen an den Hals. Der jedoch wehrte sich und schlug mit dem Streitkolben zu. Almaric hatte Glück, dass der Hieb den Helm traf und ausreichend gedämpft wurde. Der Hauptmann behielt sich trotz des Treffers soweit in der Gewalt und im Gleichgewicht, das er seinen Widersacher niederstechen konnte.
Das Gewühl wurde immer dichter. Wer stürzte, hatte kaum noch eine Chance, wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen. François hatte das Pech, auf den vom Blut rutschigen Trümmern der Mauer auszugleiten und der Länge nach hinzuschlagen. Fast im selben Augenblick stürzte ein Sarazene über ihn hinweg, fiel auf ihn und rammte dem unglücklichen François auf diese Art unabsichtlich einen großen spitzen Stein in das Gesicht. Blutüberströmt und verrenkt blieb der ehemalige Totengräber liegen und rührte sich nicht mehr. Die Schlacht bewegte sich über ihn hinweg, zahllose Füße trampelten über den Gestürzten und töteten ihn.
Wenige Schritte davon entfernt kämpfte Balian noch immer mit dem Beuteschwert, rammte es einem Sarazenen in den Leib, der in der Masse der Kämpfenden unterging wie ein leckes Schiff in stürmischer See. Dann entdeckte er sein eigenes Schwert, das zwischenzeitlich in einem Toten steckte, ließ das Beuteschwert fallen, griff nach dem Schwert Ibelins, riss es heraus und erschlug den nächsten Gegner noch aus der Drehung heraus. Drei der Sarazenen sahen den wie einen Berserker dreinschlagenden Heerführer Jerusalems und stürzten sich gemeinsam auf ihn und rissen ihn zu Boden. Wie ein Aal wand er sich, um sich dem tödlichen Griff zu entziehen, warf den Mann, der an seinem rechten Arm hing, über sich nach hinten, den zu seiner Linken beförderte er auf die andere Seite, kam wieder an sein Schwert. Den dritten fällte er mit einem herzhaften Fußtritt und säbelte einen vierten mit dem Schwert um, der seinen Kameraden zu Hilfe eilen wollte.
Ein Stück entfernt von Balian, um den sich nach dem heftigen Ringkampf ein freier Raum bildete, war das Gewühl so dicht, dass Freund und Feind fast nicht mehr zu unterscheiden war. Es war so eng, dass keiner mehr mit einer Waffe ausholen konnte. Die dort Kämpfenden gingen mit bloßen Händen einander an die Kehlen, Hände griffen in blutverschmierte Gesichter, Finger stachen in die Augen des Gegners.
Es war ein furchtbares Gemetzel, das sich über den ganzen Tag hinzog und von oben her, von der Mauer, so aussah, als verschlängen sich Armeen von Würmern gegenseitig. Doch so sehr sich die Sarazenen bemühten, so viele sie auch in die Schlacht warfen – es gelang ihnen nicht, an der Bresche in die Stadt durchzubrechen. Erst die Dunkelheit beendete das grauenhafte Massensterben. Als sie sich über das Land senkte, zog Saladin seine letzten Männer von der Bresche ab. Kein Sarazene hatte es geschafft, auch nur bis zum inneren Tor vorzudringen.
Die christlichen Kämpfer zogen sich nur hinter die Bresche zurück, blieben aber vor dem inneren Tor und ließen sich dort fallen, wo sie gerade standen. Nur wenige Wachen blieben auf dem Posten, um die völlig erschöpften Ritter vor unliebsamen Überraschungen zu bewahren.
Balian erwachte, als der Morgen graute und es rasch heller wurde. Er hatte das Gefühl, keinen heilen Knochen mehr im Leib zu haben und kam nur schwer in die schreckliche Realität Jerusalems zurück. Sein müder Blick fiel auf François, der nur wenige Schritte von ihm entfernt mit gebrochenem Rückgrat und zerschmettertem Gesicht über einem Trümmerhaufen lag.
„Vergesst meiner nicht in Frankreich … Meister Totengräber“, flüsterte er einen letzten Gruß an ihn. Mithilfe seines Schwertes rappelte er sich mühsam auf und übersah die Walstatt. Hier, zwischen all diesen Toten von Freund und Feind schien es kein Leben mehr zu geben, doch nach und nach richtete sich hier ein christlicher Ritter auf, da noch einer … Allmählich kam wieder Leben in den Trümmerhaufen an der Bresche.
Kapitel 57
Alles und Nichts
Die Nacht wurde wiederum zu einem neuen Tag. Zum ersten Mal seit dem Beginn der Belagerung hatten die Verteidiger wirklich einige Stunden gefahrlos ruhen können – aber keiner hatte seine Rüstung abgelegt oder sich auch nur den Dreck aus dem Gesicht gewaschen.
„Mylord!“, hörte Balian den Ruf eines Wächters und sah auf. Pierre stand oben, dort wo die Mauer noch stabil genug war, um darauf einen passablen Aussichtspunkt zu haben, und winkte ihm. Verschlafen schob Balian sein Schwert in die Scheide und erklomm mit schweren Schritten den Trümmerberg an der Bresche, um zu sehen, was Pierre bemerkt hatte oder Saladin sich für diesen Tag als neue Taktik ausgedacht hatte.
Die letzten vier Tage hatten tiefe Spuren hinterlassen: Sein kornblumenblauer Wappenrock war zerrissen und so blutbesudelt, dass er eher violett mit blauen Flecken war. Eine der zahlreichen Blutspuren an seiner linken Brustseite war von seinem eigenen Blut; Folge einer Risswunde, die sich von der oberen Wangenwölbung bis zwei Finger breit über dem Kiefer in den Bart zog. Er war verdreckt und verschwitzt wie alle anderen, die sich nach und nach hinter ihm einfanden.
Almaric, der seinem jungen Herrn am Tag zuvor ebenso oft das Leben gerettet hatte wie Balian das seine, erkannte eine Abordnung der Sarazenen; vier trugen einen Baldachin und einer eine weiße Fahne.
„Sie wollen Bedingungen aushandeln. Sie müssen … Bedingungen aushandeln“, sagte Almaric. Der Konstabler und er wechselten einen kurzen Blick. Es schien, als sei dessen Strategie aufgegangen. Der Patriarch, der sich in seinem völlig verdreckten, ehedem weißen Ornat ebenfalls eingefunden hatte, rief:
„Konvertiert zum Islam – und widerruft es danach!“
Balian sah ihn verächtlich an.
„Ihr habt mich viel über Religion gelehrt, Eure Heiligkeit“, versetzte er mit beißender Ironie und stieg den Schutthügel hinunter zu der Parlamentärsabordnung.
Sultan Saladin trat unter den Baldachin, als er sah, dass der augenscheinliche Führer der Verteidiger Jerusalems den Trümmerhaufen herunterkam. Balian verharrte kurz vor dem Baldachin und trat dann ebenfalls unter das schützende Dach. Er und Saladin musterten sich einen Moment.
„Werdet Ihr uns die Stadt übergeben?“, fragte der Sultan schließlich.
„Bevor ich sie verliere, werde ich sie bis auf die Grundmauern niederbrennen. Eure heiligen Stätten und unsere heiligen Stätten – alles, was Jerusalem hat, das die Menschen in den Wahnsinn treibt“, erwiderte Balian mit entschlossener Miene. Saladin lächelte nachsichtig.
„Ich frage mich, ob es nicht besser wäre, wenn Ihr das tun würdet“, sagte Saladin mit einem Seufzen. „Ihr wollt sie zerstören?“ hakte er nochmals nach. Balian reckte sich ihm ein Stück entgegen, das Schwert in der Scheide fest mit der Linken gepackt.
„Jeden Stein!“, bekräftigte er. „Und jeder christliche Ritter, den Ihr tötet, wird zehn Sarazenen mit in den Tod nehmen. Ihr werdet Euer Heer vernichten und nie wieder ein neues aufstellen, das schwöre ich bei Gott! Jeder Versuch, diese Stadt einzunehmen, wird Euer Ende sein!“
Die Drohung klang echt, fand Saladin, doch er fragte sich, wie die christlichen Verteidiger das anstellen wollten, ihr Mut in allen Ehren …
„Eure Stadt ist voller Frauen und Kinder!“, gab er zu bedenken. „Wird mein Heer vernichtet, so wird es Eure Stadt auch.“
Balian antwortete nicht sofort. Der Sultan hatte Recht, aber er hätte sich im Moment eher die Zunge abgebissen, als das zuzugeben. Schließlich sah er demonstrativ an Saladin vorbei hinüber zu dessen Armee.
„Ihr wollt verhandeln – ich hab’ nicht darum gebeten …“, konterte er geschickt.
‚Hoffentlich beißt er an!’ durchfuhr es ihn.
Balians entschlossener Blick und seine Furchtlosigkeit, so zu verhandeln, beeindruckten Saladin mehr, als er zugeben mochte. Dieser junge Christ war als Verhandlungspartner ein harter Brocken – ebenso hart wie sein Vater … Saladin entschloss sich nach einer gewissen Überlegungszeit zu einem Angebot.
„Ich werde jeder Seele freien Abzug in christliches Land gewähren. Jeder Seele – den Frauen, den Kindern, den Alten … und allen Euren Rittern und Soldaten. Und Eurer Königin.“
Saladins Blick ging zu Guy de Lusignan, der wieder im Schmuck seines Unterzeugs und eines Umhangs mit gefesselten Händen gut bewacht nur wenige Klafter entfernt stand. Balian folgte seinem Blick und sah zu dem geschlagenen, aber immer noch recht hochnäsig wirkenden König.
„Euren König, wie er dort steht, werde ich Euch überlassen und dem, was Gott mit ihm vorhat. Niemandem wird ein Leid geschehen. Ich schwöre es bei Gott.“
Balian musste sich zwingen, eine zu freudige Reaktion zu unterdrücken, aber es gelang ihm. Er drehte sich langsam zu Saladin und sah den Sultan skeptisch an.
„Die Christen haben jeden Moslem in der Stadt umgebracht, als sie sie einnahmen“, erinnerte er ehrlich. Saladin sah ihn leicht beleidigt an.
„Ich bin keiner von diesen Männern“, versetzte er. „Ich bin Salahudin, Salahudin!“
Balians forschender Blick fand absolute Ehrlichkeit in den Augen seines Gegenübers. Dieser Mann meinte, was er sagte. Der junge Mann straffte sich.
„Dann werde ich Jerusalem zu diesen Bedingungen aufgeben“, erklärte er. Saladin verneigte sich leicht.
„As-Salam ‘alaykum!“, grüßte er. Balian verbeugte sich ebenfalls leicht und nickte Saladin mit einem freundlichen Lächeln zu.
„Und Friede sei mit Euch!“, erwiderte er den Gruß des Sarazenen.
Saladin wandte sich zum Gehen und verließ den Verhandlungsort unter dem Baldachin. Balian blieb noch stehen, drehte sich nochmals zu Saladin um.
„Was ist Jerusalem wert?“, fragte er. Saladin blieb stehen und drehte sich auch nochmals um.
„Nichts!“, sagte er und setzte seinen Weg fort. Balian blickte zum Himmel, drehte sich um und wollte dann auch gehen, doch hörte er, dass Saladins Schritte stoppten. Er wandte sich wieder um und sah den Sultan mit bis in Brusthöhe erhobenen Fäusten mit gedrückten Daumen stehen.
„Alles!“, lächelte Saladin – dann ging er endgültig fort.
Balian konnte sich über diese Geste ein Lächeln nicht verkneifen und stieg dann den Trümmerberg wieder hinauf. Auf halber Höhe blieb er stehen und sah die Erwartung in den verschmutzten, erschöpften Gesichtern der Männer, die die Verhandlung nicht gehört hatten.
„Ich habe Jerusalem aufgegeben!“, verkündete er. „Alle werden sicher zum Meer geleitet werden!“
Jubel erhob sich unter den Männern vorn, die seine Worte ganz verstanden, darunter Almaric, der Patriarch und dessen ehemaliger Diener Pierre. Balian sah sich noch einmal um, sah vor dem Trümmerberg noch Leichen vom Vortag dort liegen, wo sie gefallen waren.
„Wenn dies das Königreich der Himmel ist, soll Gott damit tun, was immer er damit tun will“, sagte er dann leiser. In dieser Hinsicht hatte sein Vater sich vielleicht geirrt; doch wenn es ein Königreich der Himmel gegeben hatte, dann war dieses Ende des Königreichs der Himmel jenen auf beiden Seiten zu verdanken, die fanatisch an der Idee klebten, dass gerade ihre eigene Auffassung von Religion die einzig wahre war …
Schließlich riss er sich von dem traurigen Anblick los und stieg die letzten Ellen wieder hinauf und wurde oben mit Schulterklopfen von allen Seiten empfangen. Seine Strategie und sein Verhandlungsgeschick hatten alle Überlebenden gerettet. Je weiter er durch die Menge ging, desto lauter skandierten sie seinen Namen.
Mit einiger Mühe bahnte er sich den Weg zum Palast, um Königin Sibylla vom Ausgang des Kampfes zu berichten. Er fand sie mit kurzgeschorenen Haaren und im Büßerkleid vor. Sie tat ihm Leid, so wie sie dort stand; einsam, verlassen, verängstigt.
„Eures Bruders Königreich war hier“, sagte er und legte die Hand an seine Stirn, „und hier“, die Hand wanderte zum Herzen. „Und ein solches Königreich kann niemals aufgegeben werden“, erklärte er sanft. Sie wagte kaum, ihn anzusehen, auch wenn sie ihm einen verstohlenen Seitenblick zuwarf.
„Was soll ich tun? Ich bin immer noch die Königin von Akkon, Askalon, Tripolis“, bat sie, auf den kleinen Tisch vor sich sehend. Er sah sie eine Weile an. Sie wirkte so zerbrechlich, so mitgenommen von den Ereignissen der letzten Tage. Ein leichtes Lächeln zeigte sich in seinem zerschundenen Gesicht.
„Entscheidet Euch für ein Leben ohne Krone und ich werde mit Euch kommen“, versprach er sanft. Sie sah zu ihm und fand den warmen, sanften Blick wieder, den sie so sehr liebte, aber sie schwieg. Als sie nichts sagte, sondern ihn nur unverwandt ansah, wandte er sich schließlich ab und ging fort. Ihr Schweigen deutete er als Ablehnung seines Angebots.
Kapitel 58
Der perfekte Ritter
Balian hatte einen ruhigen Platz irgendwo in den Gassen Jerusalems gefunden. Er hatte sich eine Schüssel Wasser geholt, den zerfetzten, blutbesudelten Wappenrock und das Kettenhemd abgelegt und beides samt Schwert hinter sich auf eine Bank gelegt. Erschöpft kniete er vor der Waschschüssel nieder, spritzte sich das kühle Wasser ins Gesicht und über den Nacken. Das Wasser tat wohl und brachte einige der geflüchteten Lebensgeister wieder zu ihm zurück. Er lehnte sich matt über die Schüssel, wischte sich müde über das zerschundene Gesicht, rieb sich die brennenden Augen und ließ die letzten Tage nochmals in seinem Gedächtnis passieren.
Man hatte ihn gefeiert; es gab in Jerusalem wohl keinen Menschen, der ihm nicht dankbar gewesen wäre, denn seine Taktik hatte alle Christen gerettet, die nach der Schlacht um Jerusalem noch lebten. Sein Plan war aufgegangen; die überlebenden Ritter Jerusalems samt ihren Familien würden nicht abgeschlachtet werden, nicht einmal versklavt, sondern in den nächsten Tagen zum Meer gebracht werden, wo Schiffe auf sie warteten, die sie nach Europa zurückbringen würden. Balian hatte viel erreicht, sehr viel; mehr, als jeder andere hätte erreichen können. Er hatte Saladin Respekt abgenötigt.
Doch was immer er als Heerführer Jerusalems auch erreicht hatte, er selbst ging dabei leer aus, sah er davon ab, dass er noch lebte, seine Wunden nicht lebensbedrohend waren und außer Narben keine dauerhaften Schäden hinterlassen würden. Aber von dem, was Godfrey ihm hinterlassen hatte, war ihm außer dem Schwert und dem Siegelring seines Vaters nichts geblieben. Ibelin war ebenso verloren wie Jerusalem, sein Haus in der Stadt bereits von Leuten des Sultans übernommen. Den Titel des Barons von Ibelin, den er Almaric übertragen hatte, hatte der treue Hauptmann ihm zwar wieder zurückgegeben, doch der Titel allein machte nicht satt. Er stand wieder dort, wo er in Frankreich aufgehört hatte. Balian war es dennoch gleich. Als Schmied hatte er gewiss keine solchen Reichtümer gehabt wie als Baron im Heiligen Land, aber was er in Frankreich besessen hatte, hatte er ehrlich erarbeitet, mochte das Erbe seines Ziehvaters auch ein Geschenk gewesen sein und nicht das ihm tatsächlich zustehende Erbe. Das Schmiedehandwerk hatte er nicht verlernt, er würde wieder von seiner Hände Arbeit leben.
Seine Gedanken gingen zu Sibylla. Was er in den letzten Tagen getan hatte, hatte er auch für sie getan; nicht nur, weil sie seine Königin war, sondern weil er sie immer noch liebte. Doch eine Zukunft für sie beide würde es nicht geben. Guy lebte und würde den Platz an ihrer Seite beanspruchen – zu Recht, schließlich war er ihr Gemahl. Es schien Balian, als treibe das Schicksal einen besonders gemeinen Spott mit ihm. Der Mann, der all das Unglück zu verantworten hatte, das über Jerusalem hereingebrochen war, lebte und würde nun wieder den Platz an Sibyllas Seite einnehmen. Sie hatte in der Tat Recht gehabt, als sie ihm gesagt hatte, dass der Tag kommen würde, an dem er bereuen würde, ein kleines Übel nicht begangen zu haben, um etwas wirklich Gutes zu bewirken. Heute war dieser Tag …
Zudem schien es ihm, als ob sie ihm seine Ablehnung damals offenbar so übel genommen hatte, dass nicht einmal sein Einsatz für sie, seine Königin, und die Menschen Jerusalems sie wieder hatte versöhnen können. Ihr augenscheinlich eisiges Schweigen auf seinen Vorschlag, er werde ihr folgen, wenn sie auf die Krone verzichtete, legte den Verdacht für ihn nahe, dass sie ihm immer noch gram war. Aber vielleicht war es besser so. Denn wenn sie darauf beharrte, Königin bleiben zu wollen, hatte sie offenbar nicht begriffen, dass es für die Städte an der Küste ebenso wenig eine Zukunft unter christlicher Herrschaft gab wie für Jerusalem. Die Hafenstädte waren wesentlich weniger stark befestigt als Jerusalem, das zudem noch schwer erreichbar in den judäischen Bergen lag. Es gab keine Hoffnung, diese Städte halten zu können. Saladins Armee würde sie bald erobert haben, wenn Sibylla sie nicht freiwillig aufgab. Es würde ein weiteres Blutbad geben, befürchtete Balian. Guy war nicht der Mann, der Leben retten wollte. Er klebte fanatisch an der Idee, dass der Kampf gegen die Muslime Gottes Wille war. Er, Balian, würde sich jedenfalls nicht weiter daran beteiligen, sondern als einfacher Mann nach Frankreich zurückkehren.
Während er nachdenklich in der Gasse kniete und sich nur allmählich von den Strapazen der letzten Tage erholte, vergaß er seine Umgebung. Kettenhemd und Schwert lagen unbeachtet hinter ihm. Durch die Gasse eilten hin und wieder Schritte, so dass dem müden Balian der nur bedingt leise Schritt, der unter die Arkaden trat, unter denen er kniete, nicht auffiel.
Kaltes Metall, das ruppig von der rechten Seite an den Hals gestoßen wurde, holte ihn in die Gasse zurück.
„Ein vollkommener Ritter …“, drang eine ihm wohlbekannte Stimme bissig in seine Ohren. „Ist es das, wofür du dich hältst?“
Balian brauchte sich nicht nach rechts zu drehen, um zu wissen, dass dort Guy de Lusignan stand. Er legte das Tuch weg, mit dem er sich gerade das Gesicht gewaschen hatte und nahm eher automatisch und keineswegs von Eile heimgesucht den Griff seines Schwertes, das Guy heimlich aus der Scheide gezogen hatte und ihm nun an der Klinge vor die Nase hielt.
Der junge Baron hatte das Schwert noch verkehrt herum in der Hand, benutzte es als Krücke, um sich mühsam zu erheben, als Guy mit seinem eigenen Schwert kräftig auf die Klinge schlug und die Stütze damit wegschlug. Doch Balian verlor weder das Schwert, das er gerade noch mit einem Finger halten konnte, noch die Balance, auch wenn er arg ins Straucheln geriet. Seine Hand schien mit dem Schwertgriff fast verwachsen und legte sich wie von selbst richtig um den mit Walnussholz und Büffelleder anschmiegsam verkleideten Griff. Er trat aus den Arkaden, bremste Guys nächsten, beinahe spielerischen Hieb gegen die Klinge federnd aus und richtete das große Schwert gegen den Rivalen.
„Wir alle sind das, was wir tun“, erwiderte Balian. Ohne es zu wissen, gebrauchte er wie schon einmal Sibyllas Worte, die sie nur zwei Tage zuvor zu François gesagt hatte. Geburt oder früherer Stand war bedeutungslos. Wichtig war nur, was jemand wirklich tat.
Guy langte mit der linken Hand zu und schnappte sich ein zweites, kürzeres Schwert, das neben mehreren anderen in einem Korb steckte, kreuzte die beiden Klingen vor sich, während Balian die Falkenwacht einnahm. Der König griff ihn mit dem Schwert in der linken Hand an, Balian parierte den Hieb mit einem wohlgezielten Schlag von oben und konnte im Durchziehen der Klinge auch das rechte Schwert abwehren. Guy hatte das linke Schwert schon wieder in Angriffsposition, doch Balians Kreisschlag verhinderte ein Durchkommen seinerseits. Guy wich geschickt nach rechts aus und konnte einen Gegenangriff des Barons seinerseits abwehren.
Die beiden Kämpfer tänzelten umeinander, der König ließ das rechte Schwert fallen und schlug mit voller Wucht in Balians Gesichtswunde. Der Schlag riss den Feldherrn herum und warf ihn zwischen Kisten und Fässer, die am Rand der Gasse standen. Immerhin gelang es Balian, das Schwert in der Hand zu behalten. Er kam hoch und schlug aus der Drehung heraus zu, doch brachte Guy seine Klinge vor dem harten Schlag rechtzeitig nach oben in die Falkenwacht in Sicherheit und schlug von oben her zu; doch beide Hiebe der Kontrahenten trafen nur die leere Luft.
Der Schwung trieb Balian an die gegenüberliegende Wand, mit der seine rechte Schulter schmerzhafte Bekanntschaft machte. Guy witterte Morgenluft, holte mächtig aus und schlug zu, doch krachte die schwere Klinge nur Funken sprühend an die Wand, weil Balian rechtzeitig weggetaucht war. Der Templergönner holte wieder aus und hieb nach dem Rivalen. Balian parierte den Hieb, schlug seinerseits gleich viermal wie mit dem Schmiedehammer zu und trieb Guy in den Rückwärtsgang.
Schließlich tauchte der nach unten weg und zog noch im Abtauchen einen Dolch aus dem Stiefel, mit dem er gezielt in die Wunde in Balians linkem Unterarm schnitt, dass das Blut nur so spritzte. Zu Guys Verblüffung hielt Balian dem Dolchschnitt stand und schlug seinerseits zu, parierte den nächsten Angriff. Guy stach erneut zu und traf ihn auch in den rechten Unterarm, doch der Konstabler hatte sein Schwert im Kreuzgriff sicher und ließ es nicht los. Eine vierte Attacke mit dem Dolch wehrte er mit dem Schwert ab.
Er ging seinerseits zum Angriff über, schlug Guy den Dolch aus der Hand und wich gleich dem nächsten Angriff mit dem Schwert aus. Guy konnte nicht mehr bremsen und krachte an die Wand der Gasse. Ein erneuter Hieb des Barons von Ibelin verfehlte den König nur knapp und traf eine Gewürzschüssel, deren Inhalt hauptsächlich Guy ins Gesicht flog, sich ansonsten einer Explosion gleich in der Gasse verteilte und auch Balian und den immer zahlreicher werdenden Zuschauern des tödlichen Gefechts erst einmal kurzfristig die Sicht nahm.
Im Nebel gingen sie mit den Händen aufeinander los, wehrten sich gegenseitig ab. Balian ging nach unten in Deckung, Guy haute ins Leere, versuchte einen Kreisschlag, Balian duckte sich noch tiefer, kam dann hoch und parierte den nächsten wuchtigen Hieb des Gegners zunächst einhändig mit der Rechten, nahm dann aber doch die Linke mit zu Hilfe. Guy konnte nur knapp den harten Hieb parieren und sich auch den nächsten nur mit Mühe vom Leib halten. Balian bekam sein Schwert unter das von Guy und riss dessen Deckung nach oben auf, bekam aber einen mächtigen Fausthieb von Guy in die Magengrube und krümmte sich vor Schmerz. Doch dann kam er wieder hoch und verpasste dem überraschten Guy eine harte Kopfnuss, die ihm das Blut aus der Nase und Tränen in die Augen trieb. Balian trieb den König mit einer Serie von Kopfnüssen vor sich her, dass der sich nur die blutende Nase hielt und einstweilen nicht mehr zuschlug.
Ein unbeteiligter Zuschauer konnte sich gerade noch vor den Kämpfern in Sicherheit bringen, als Balian Guy unter die zum Trocknen aufgehängten Tücher einer Färberei trieb. Mit der Linken hielt der König sich die blutende Nase, mit der Rechten wehrte er Balians nächsten Hieb ab und zwang ihn, nach unten auszuweichen. Doch noch im Aufstehen warf der Baron das Schwert im Halbkreis herum und traf Guy im Bauchbereich, dass dessen Blut weit spritzte. Balian schob eines der Tücher beiseite und schlug beidhändig zu, doch hatte Guy sich wieder soweit in der Gewalt, dass er den Hieb gerade noch parieren konnte. Sein Gegenangriff scheiterte an Balians Deckung, Guy nahm das Schwert hoch, was Balian zu einem Tiefschlag geradezu einlud, doch konnte Guy auch diesen Hieb noch abwehren.
Beide zogen sich einige Schritte voneinander zurück, und Balian nahm wieder die Falkenwacht ein. Guy tat es ebenfalls und schlug als Erster zu, doch konnte Balian den Hieb abfangen. Die Wucht des Konters riss den König herum. Der Baron verpasste ihm mit einem Schlag von rechts einen weiteren Schnitt in die Bauchdecke. Das Schwert Ibelins schwang nach links aus, mit dem Schwung zurück erwischte Balian Guy zum dritten Mal quer über den Leib. Das Schwert flog wie von selbst in die Falkenwacht. Balian schlug nochmals zu und entwaffnete den vor Schmerz in die Knie gehenden Guy.
Stöhnend presste Guy beide Arme auf die blutenden, schmerzhaften Wunden, die sein Rivale ihm geschlagen hatte und sah dann mit viel Mühe hoch. Balian stand blutverschmiert über ihm, das Schwert drohend in der Falkenwacht. Guy schloss mit dem Leben ab, als er das Sonnenlicht auf der Klinge blitzen sah. Er hatte verspielt – sein Königreich, seine Gemahlin, sein Leben.
„Tu es!“, presste er heraus und erwartete den tödlichen Hieb.
Balian schüttelte langsam und mit mühsamer Beherrschung den Kopf. Dann senkte er langsam das Schwert. Guy war kampfunfähig, und Balian widerstrebte es, einen waffenlosen, kampfunfähigen Mann zu töten.
„Wenn du dich erhebst – solltest du dich erheben – erhebe dich als Ritter!“, keuchte er, behielt das Schwert nur in der rechten Hand, schob sich an dem schwer verwundeten Guy vorbei durch die Tücher ins Freie und überließ es den verblüfften Zeugen des Duells, seinem Gegner möglicherweise Hilfe zu leisten.
Kapitel 59
Die Stadt wird aufgegeben
Einige Zeit später war die Übergabe der Stadt vollzogen. Die neuen Herren Jerusalems sorgten dafür, dass in möglichst kurzer Zeit möglichst wenig an die Herrschaft der Christen hier erinnerte.
Saladin betrat den Palast. Drinnen segelten die Papiere der Verwaltung durcheinander. Die hier mit der Tilgung der Erinnerung Beschäftigten unterbrachen ihre Arbeit aber kurz und verbeugten sich vor ihrem König, als Saladin durch die Hallen schritt. Der Sultan hatte seine Rüstung abgelegt und mit einer kostbaren, fast bodenlangen Tunika aus schwarzer Seide vertauscht, die vom Bauch bis zu den Schultern hinauf mit ebenso kostbarer Goldstickerei verziert war, die bei jedem Schritt leise knisterte. Unter dem schwarzen Turban schauten die welligen, ergrauten Haare des Sultans hervor und fielen gezielt über die Schultern. Weiche Schnabelschuhe ergänzten die wahrhaft königliche Ausstattung. Saladin war in seiner königlichen Robe eine beeindruckende Erscheinung.
Sein Weg führte ihn auch in die Gemächer des verstorbenen Königs Balduin. Blutbesudelte Vorhänge zeugten von einem Kampf, der hier stattgefunden haben musste. Saladin dachte nicht lange darüber nach, wer sich hier geschlagen haben konnte, denn innerhalb der Stadt hatte es keine Auseinandersetzungen zwischen Christen und Muslimen gegeben. Vielleicht hatten sich Plünderer um Beute geprügelt … Sein Blick fiel auf ein zu Boden gefallenes Standkreuz. Er bückte sich, hob es auf und stellte es bedächtig und respektvoll auf den Tisch vor dem offenen Fenster, in dem der Wind einen Vorhang wehen ließ. Es würde dort bleiben, in Erinnerung an Jerusalems großen christlichen König Balduin IV., dessen Andenken Saladin, Beherrscher aller Gläubigen islamischer Religion, bewahren wollte.
Balian hatte gebadet und hatte den Vorzug, von Imads Leibarzt eine gute Behandlung seiner Wunden zu bekommen. Jetzt trug er wieder die einfache, dunkle Kleidung, die er bis nach Messina angehabt hatte. Am Brunnen, wo er sich vor – wie es ihm schien – unendlich langer Zeit von Imad getrennt hatte, stand er nun wieder mit dem Araber und verabschiedete sich von ihm. Sie reichten sich die Hände. Mochten sie auch verschiedenen Religionen angehören – sie verstanden sich, sie waren gute Freunde und sie würden es bleiben, gleich, wie heftig sich Christen und Moslems auch immer bekämpfen mochten. Imads Blick wurde listig.
„Dieses Pferd … es ist kein sehr gutes Pferd“, sagte er lächelnd. „Ich will es nicht behalten“, setzte er hinzu. Balian verstand und lächelte ebenfalls. Mit dankbarem Kopfnicken nahm er den Zügel jenes schwarzen Pferdes entgegen, um das er bei seiner Ankunft im Heiligen Land mit Mohammed al-Faes gekämpft hatte und das er Imad zum Abschied geschenkt hatte.
„Danke“, sagte er und schwang sich in den Sattel. Imad hielt den Rappen noch am Zaumzeug fest. Diese Geste drückte großen Respekt aus; ja, sie konnte im Extremfall als Unterwerfung gelten. Balian nahm sie als Freundlichkeit Imads entgegen und nickte ihm zu.
„Und wenn Gott dich nicht liebt … wie konntest du all die Dinge tun, die du vollbracht hast?“, fragte Imad. Es war eindeutig eine rhetorische Frage; für Imad war es unübersehbar, dass Gott diesen jungen Mann mit dem ebenso gütigen wie mutigen Herzen sehr lieben musste, sonst hätte er seinen treuen Diener Saladin nicht an den Rand der Niederlage geraten gelassen. Der Sieg zur Rückeroberung Jerusalems war teuer erkauft; er hatte sehr viel mehr Leben guter sarazenischer Soldaten gefordert, als Saladin in seinen dunkelsten Träumen befürchtet hatte. Imad schätzte Balian nicht nur als großmütigen Gegner, er war ihm wirklich ein Freund geworden. Sein Gruß an Balian drückte seine ganze Achtung aus:
„Friede sei mit dir“, sagte der Araber.
„U ‘alaykum as-Salam!“, erwiderte Balian den Gruß – und er meinte den damit verbundenen besonderen Friedensschwur ebenso ernst wie Imad seinerseits. Er winkte dem Freund noch einmal und ritt dann aus Jerusalem fort.
Auf seinem Weg zum Jaffator, durch das er damals erstmals nach Jerusalem hereingekommen war, sah er noch, dass das Kreuz auf der Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg – bis zur Übergabe der Stadt Sitz des Templerordens – gegen einen neuen Schmuck ausgetauscht wurde. Männer Saladins richteten eine lange Spitze auf, die von einem Halbmond gekrönt wurde. Bis zur Wurzel dieser Spitze machten drei auf der Länge der Spitze verteilte, nach oben hin kleiner werdende Kugeln deutlich, dass hier einer der bedeutendsten heiligen Plätze im ganzen Reich Saladins war. Es war das unübersehbare Zeichen, dass in Jerusalem die knapp einhundert Jahre währende christliche Herrschaft beendet war und nun wieder Moslems hier die Herren waren.
Den gleichen Vorgang beobachteten auch Sultan Saladin, Imad und Mullah Khaled, die zur ehemaligen Grabeskirche gingen, die nunmehr zu einer Moschee umgewidmet und neu geweiht wurde. Saladin hatte feuchte Augen, als er das geliebte Zeichen seines Glaubens wieder Jerusalem überragen sah. Im hohen Innenraum fielen die unter der Decke hängenden Banner der Vasallen und des Königreichs Jerusalems, Mullahs schritten vor dem Sultan her und streuten Rosenblätter auf seinen Weg. Mitten im Raum befand sich eine Bronzeplatte, geschmückt mit dem christlichen Kreuz und weiteren Inschriften. Die drei blumenstreuenden Mullahs, die dem Sultan vorangingen, schritten über die Platte, Saladin dagegen hielt inne, nahm Maß und setzte seinen Fuß sorgsam außerhalb der Platte auf den Steinboden und ging ganz vorsichtig darum herum, darauf bedacht, das Kreuz nicht mit Füßen zu treten.
Mitten in dem Raum war er dann allein, breitete seinen Gebetsteppich aus, kniete nieder und dankte Allah von ganzem Herzen dafür, dass Jerusalem nunmehr wieder zum Reich des Islam gehörte und seinen Platz als drittwichtigste heilige Stätte dieses Glaubens einnehmen konnte.
Kapitel 60
Eine Königin geht nie zu Fuß
Der Treck der ausgewiesenen Christen setzte sich als unendlich erscheinender Zug in Bewegung. Mitten in den langen Reihen ging Sibylla. Sie hatte Balian vergeblich gesucht und hatte sich schließlich ohne ihn auf den Weg gemacht. Sie hatte praktisch nichts bei sich, nur einen zusätzlichen Mantel mit Kapuze. Jeglicher anderer Luxus, der noch zwei Tage zuvor ihr Leben gewesen war, war zurückgeblieben.
Ein Stück hinter ihr, aber ohne Blickkontakt zu ihr, ging Patriarch Heraclius ebenfalls in der unübersehbar erscheinenden Reihe. Der von den vielen Füßen und den begleitenden Reitern aufgewirbelte Staub machte ihn niesen. Schnaufend warf er sich ein langes Tuch über die Schulter und vor Mund und Nase, damit er nicht am Staub erstickte.
Während Sibylla automatisch einen Fuß vor den anderen setzte, ritt ein Reiter im leichten Galopp an dem ganzen Zug entlang. Sie glaubte, ihren Augen nicht zu trauen, als sie Balian erkannte, der als einziger Ausgewiesener ein Pferd hatte. Im ersten Moment fluchte sie schweigend, doch dann stoppte er, ritt zurück, blieb auf ihrer Höhe stehen, saß ab und gesellte sich zu Fuß zu ihr. Heftiger Wind zauste ihm die Haare und wehte den langen Rücken seiner Gugel nach vorn. Balian musste den widerspenstigen Umhang mit der Hand bändigen, damit er nicht noch Sibylla traf.
„Eine Königin geht niemals zu Fuß“, sagte er, ohne sie anzusehen. „Und doch lauft Ihr“, setzte er mit sanftem Spott hinzu. Balian spürte ein Glück, das sein Herz fast platzen ließ, seit er die wohlbekannte Gestalt Sibyllas im Büßergewand in dem Flüchtlingszug entdeckt hatte, nachdem er sie in der Stadt nicht mehr gefunden hatte. Sie erwiderte seinen Blick scheu und wortlos, rang sich ein trauriges Lächeln ab und schob ihre Hand beinahe heimlich in die seine. Ihre Blicke trafen sich. Er erwiderte ihr scheues Lächeln mit einem strahlenden, aber immer noch sanften, liebevollen Lächeln, das nicht einmal von der langen Narbe in seinem Gesicht getrübt wurde.
Die Tatsache, dass sie sich so offensichtlich für ihn und gegen die nunmehr bedeutungslose Krone entschieden hatte, ließ ihn innerlich jubeln. Ob Guy wirklich tot war, wusste Balian nicht. Wahrscheinlich war es, denn die Wunden waren tief und zweifelsohne lebensgefährlich gewesen. Er wagte zu bezweifeln, dass Guy ebenso viel Glück wie er selbst gehabt hatte, von guten sarazenischen Ärzten behandelt zu werden. Wenn er tot war, war Sibylla ohnehin frei. Und wenn er es nicht war, musste er jedenfalls nicht erfahren, dass sie sich nun endgültig für die wahre Liebe ihres Lebens entschieden hatte … Nie wieder würde sie ein öffentliches Gesicht nötig haben, das ihr wahres Wesen hinter den Panzer der Emotionslosigkeit verbannte, dafür wollte er gern sorgen.
Der Blick, der die geliebte Frau traf, glitt ein kleines Stück an ihr herunter. Ihre rechte Hand hatte das Büßerkleid etwas gerafft, so dass es nicht auf dem Boden schleifte und sie darüber stolpern konnte. Doch dadurch wurde ihre Kleidung stärker an ihren Leib gezogen und schmiegte sich dort eng an. Unter dem Büßerkleid zeichnete sich eine deutliche Kugel an ihrem schlanken Unterleib ab. Kein Zweifel: Sibylla war schwanger! Balians Lächeln verbreiterte sich etwas, als er wieder den Blick hob und den ihren kreuzte. In diesem Blick sah er ganz deutlich, was sie ihm augenscheinlich nicht zu sagen vermochte: Dass er der Vater dieses Kindes war, das unter ihrem Herzen wuchs.
Ihr blieb eine Erwiderung im Hals stecken, als sie ihn ansah und seinen zärtlichen Blick bemerkte. Sie sah die Erkenntnis in seinem Blick und sein schweigendes Versprechen, für sie und das gemeinsame Kind zu sorgen. In diesem Moment wusste sie, dass ihr und dem mit Balian in einer der wundervollen Liebesnächte gezeugten Kind nichts mehr geschehen konnte. Er erwiderte ihren Händedruck. Sie waren endlich zusammen.
Kapitel 61
Ein einfacher Schmied
Die Zeit verging*. Es war Frühling; Frühling in Saint-Martin-au-Bois, dem kleinen Dorf nordwestlich von Chartres. Balian trat aus seinem Haus, einfach gekleidet wie damals, als sein Vater sich ihm hier offenbart hatte. Er ging zur Schmiede hinüber. Nichts hatte sich verändert. Wie es schien hatte es noch während des Brandes einen heftigen Regen oder sehr starken Schneefall gegeben, der die Flammen gelöscht hatte. Jedenfalls stand der größte Teil der Schmiede noch – einschließlich des Firstbalkens mit dem Leitspruch, der ihn sein ganzes Leben begleitet hatte. Balian sah nachdenklich auf die eingeschnitzten Buchstaben. Hatte er die Welt verbessert? Nun, er hatte den Versuch unternommen, aber wirklich besser geworden war die Welt nicht.
‚Vielleicht sollte ich in dieses einfache Leben zurückkehren’, dachte er bei sich.
Huftritte störten ihn aus seinen Betrachtungen auf. Ein Trupp gerüsteter Reiter kam die Dorfstraße entlang. Einer hielt auf die Schmiede zu. Balian hatte angesichts der Ritter im Dorf das fatale Gefühl, das schon einmal erlebt zu haben. Die Worte des Ritters, der sich seiner Schmiede näherte, bestätigten sein Déja-vu-Erlebnis:
„Wir sind auf dem Kreuzzug, um Jerusalem zurückzuerobern“, sagte der Reiter.
Balian sah versonnen an dem Pferd vorbei in eine unbestimmte Ferne. Vor seinem geistigen Auge sah er seinen Vater und gab dem Reiter mit einem sanften Lächeln dessen Wegbeschreibung:
„Geht dorthin, wo man italienisch spricht – und dann geht weiter, bis man etwas anderes spricht.“
Der Ritter sah Balian ob dieser Beschreibung etwas verwirrt an, dann zu einem anderen, der sich nun näherte. Sein Wappenrock war rot und zeigte die zwei Löwen der Normandie, die sich gegenseitig die Pranken zeigten und nun Englands Wappen waren; den Helm schmückte eine goldene Krone.
„Wir wählten diesen Weg auf der Suche nach Balian“, präzisierte der königliche Ritter sein Anliegen. „Er war der Verteidiger von Jerusalem“, setzte er hinzu.
Balian wurde endgültig klar, von welchem Berg der Wind pfiff … Nein, an einem Kreuzzug würde er sich nicht beteiligen – nicht für alle Perlen Jerusalems, nicht einmal für sein geliebtes Ibelin.
„Ich bin ein Hufschmied“, erwiderte er. Es war keine Lüge, schließlich hatte er seinen erlernten Beruf nie wirklich aufgegeben und beschlug seine Pferde immer noch selbst. Der königliche Ritter lächelte nachsichtig.
„Ich bin der König von England“, entgegnete er. Balian lächelte leicht und sah Richard Löwenherz geradeheraus an. Und wenn es der Herr Jesus selbst gewesen wäre – er würde ihm nicht folgen! Jedenfalls nicht auf einen Kreuzzug!
„Ich bin ein Hufschmied“, beharrte er. König Richard nickte und gab seinen Leuten ein Zeichen zum Weiterreiten. Der Blick, mit dem er Balian bedachte, machte deutlich, dass Richard ihn sehr wohl erkannt hatte, aber nicht die Absicht hatte, einen so ruhmvollen Mann zu nötigen, ihm zu folgen. Zudem war Balian ihm nicht untertan. Er hatte keine Macht über ihn, mochte der junge Mann im Moment auch ohne Waffe und allein sein.
Balian sah ihnen nach und ging dann nach unten in den Obstgarten. Seine Hand glitt sanft über die blühenden Zweige eines Baumes, den Natalie gepflanzt hatte, als sie schwanger gewesen war. Er war gewachsen, war kräftig geworden, viele Blüten verschönten ihn. Wenn es keinen Frost mehr gab, würden im Herbst gute Früchte reifen.
Aus dem Augenwinkel bemerkte er eine Bewegung oben in der Schmiede und sah hinauf. Sibylla stand dort, dick eingepackt in einen pelzgefütterten Mantel. Die pelzgefütterte Kapuze hatte sie über ihr noch nicht wieder zu der ehemals vollen Länge nachgewachsenes Haar gezogen. Sie war in Palästina geboren worden. Solche kalten Frühlingstemperaturen wie im nördlichen Frankreich kannte sie einfach nicht. Sie lächelte tapfer und verliebt, als sie Balian unten im Obstgarten sah. Er erwiderte ihr Lächeln und kam zu ihr hinauf.
Sie bestiegen ihre Pferde, die sie hinter dem früheren Wohnhaus angebunden hatten, dann ritten sie den Weg nach Chartres hinunter. An dem Wegkreuz, an dem Natalie begraben war, verlangsamte Balian seinen Rappen und sah voller Liebe auf ihr Grab. Sofern er die weiteren Vorbereitungen erledigt hatte, würde er sie in die neue Kirche nach Saint-Martin-au-Bois überführen lassen. Der Wind wehte seinen Umhang auf und legte den Griff des Schwertes von Ibelin frei, das er als Titularbaron* von Ibelin ebenso weiterhin trug wie auch das Kreuz von Ibelin immer noch in seinem Wappen zu finden war – rechts, auf dem Ehrenplatz im Wappen des Vizegrafen von Saint-Martin-au-Bois …
Balian hatte nach der Heirat mit Sibylla von Anjou den Titel der ausgestorbenen Linie seines Onkels, des Vizegrafen von Saint-Martin-au-Bois, als neues Lehen vom Grafen von Blois übertragen erhalten.
Nachsatz
König Richard Löwenherz konnte Jerusalem nicht zurückerobern. Seine Bemühungen endeten in einem unsicheren Waffenstillstand mit Saladin.
Und noch tausend Jahre später ist Frieden im Heiligen Land eine Illusion …
Ende
Glossar
***: Die in Kapitel 42 mit *** versehene Szene gehört eigentlich an das Ende von Kapitel 43. So ist sie auf der DVD eingeschnitten – doch mir erscheint dieser Platz nicht passend zu sein, es sei denn, sie wäre dort ausdrücklich als Rückblende eingesetzt, was aber nicht der Fall ist. Ich gehe davon aus, dass zwischen dem Kampf Balians mit den Templern/Nagelkreuzlern und Jeans Eintreffen nicht viel Zeit vergangen sein kann. In der Wüste überlebt niemand lange ohne Wasser – insbesondere in dem Zustand, in dem Balian nach dem Kampf war. Deshalb können allenfalls Stunden vergangen sein, aber sicher nicht mehr. Es wäre völlig unwahrscheinlich, dass Guy, filmreal betrachtet, innerhalb derart kurzer Zeit zunächst über den angeblichen Tod seines Rivalen informiert wird, er dann in den Kerker geht, um Reynald freizulassen und er auch noch gekrönt werden kann, bevor Balian gefunden wird …
Das halte ich für einen ernsthaften Filmfehler – ebenso wie den Umstand, dass Balian später noch mit den Kampfspuren im Gesicht und an der Kleidung bei der Versammlung der Barone auftaucht, obwohl filmreal schier Wochen vergangen sein müssen.
Achterlich: Nautischer Begriff für von hinten kommenden Wind. Achtern steht in der Seemannssprache für hinten.
al-Quds: Arabische Bezeichnung für Jerusalem.
As-Salam ’alaykum: Arabische Grußformel. Sie gilt als der eigentliche islamische Gruß in allen islamischen Sprachen und bedeutet: Der Friede sei mit euch. Als Antwort, ist darauf zu geben: „U ‘alaykum as-Salam“ (mit Euch sei der Friede).
Grundsätzlich gilt dieser Gruß nur unter Muslimen und wird auch nur von Muslim zu Muslim ausgesprochen, da er in der Tat ein Friedensgelöbnis enthält, das nur unter Muslimen gilt. Die Christen übernahmen diesen Gruß, jedoch zunächst als einfache sprachliche Eigenheit. Später, als die religiöse Bedeutung klar wurde, galt dann dieser Gruß auch in der religiösen Auffassung unter arabischen Christen (siehe Seite 133). Dass Balduin IV. und Saladin diesen Gruß ebenfalls tauschen (siehe Seite 255), ist jedenfalls für diese Zeit außergewöhnlich, aber mit dem gegenseitigen Respekt zu erklären, die beide füreinander empfanden. Das gilt auch für den Gruß zwischen Imad und Balian (siehe Seite 418) zum Abschied nach der Eroberung Jerusalems.
Ballista: ital.: Katapulte
Cathay: Alter Name für China
Eisenhut: In Königreich der Himmel sind einige Male Helme zu sehen, die verdächtige Ähnlichkeit mit britischen Stahlhelmen des I. und II. Weltkriegs haben. Diese Helmform ist keineswegs neu, sie existierte tatsächlich unter dem Begriff „Eisenhut“ bereits im 12. Jh. Insofern hat der Designer der britischen Stahlhelme des 20. Jh. von denen des 12. Jh. abgekupfert und nicht umgekehrt der Produktionsdesigner Arthur Max von der Moderne. Die Stadt Landshut in Bayern hat drei solcher Eisenhüte im Wappen, das damit zu den so genannten „redenden“ Wappen gehört.
Elle: alte Maßeinheit, ca. 50 – 80 cm. Es handelt sich um eines der ältesten Naturmaße, die der Mensch mit sich herumträgt und das deshalb je nach Körpergröße recht variabel sein kann. Als Elle gilt der Abstand zwischen Ellbogen und Mittelfingerspitze. Bis heute werden Stoffe mit einem 50 cm langen Holzstab abgemessen, der das moderne Pendant zur alten Schneiderelle ist.
Die von der deutschen Synchronisation Balian in den Mund gelegten „paar Meter Seide“ sind zeitlich unpassend gewählt, da diese Maßeinheit erst Ende des 18. Jh. In Gebrauch kam. Ich habe mir deshalb erlaubt, hier ein historisch passendes Maß zu verwenden. Im englischen Original spricht Balian von Yards. Dieses Maß gab es bereits seit dem 11. Jh. in England und ist deshalb historisch angemessen.
Faden: Engl. Tiefenmaß in der Seefahrt. 1 Faden = 6 Fuß ~ 1,83 m. Zehntausend Fuß oder zweitausend Faden entsprechen rd. 3.000 m.
Franken: Für die Araber waren alle europäischen Kreuzfahrer Franken, unabhängig davon, ob sie tatsächlich Angehörige des Stammes der Franken waren oder nicht. Diese Bezeichnung resultiert aus den ersten Begegnungen der Araber mit den Franken Karls des Großen im 8. Jh., als die Araber die iberische Halbinsel eroberten und auch versuchten, die Pyrenäen zu überqueren, um Frankreich zu erobern. Da die größten zusammenhängenden Territorien Europas, Frankreich und das Heilige Römische Reich, aus dem Reich der Franken hervorgegangen waren und einen Großteil der Kreuzritter stellten, ist die Bezeichnung auch nicht völlig falsch,
Gambeson: Wattiertes Wams, ab dem 10. Jh. zunächst als eigenständige textile Rüstung entwickelt, die in England im 12. Jh. sogar den freien Bürgern neben Spieß und eisernem Helm als Grundausrüstung vorgeschrieben war. Später wurde der Gambeson auch als Schutzbekleidung gegen Quetschungen und Druckstellen unter der Rüstung getragen.
Gestech: Art des ritterlichen Zweikampfs; beide Kontrahenten sind beritten und reiten mit eingelegter (unter dem rechten Arm eingeklemmter) Lanze aufeinander zu und versuchen, sich mit der Lanze gegenseitig aus dem Sattel zu heben. Die Ritter sind dabei durch eine durchgehende Schranke (eine Art Leitplanke) voneinander getrennt, so dass sie sich nicht gegenseitig niederreiten können. Bei sportlichen Wettkämpfen war die Lanzenspitze in der Regel durch ein Krönlein ersetzt, damit die Lanze nicht den Gegner durchbohren konnte.
Gönner, Rock der: Die Tempelritter waren Mönche und hatten die Mönchsgelübde – Armut, Keuschheit, Gehorsam – abgelegt. Wären Guy und Reynald tatsächlich Templer, dürfte Guy nicht verheiratet sein und Reynald nicht mit einem eigenen Lehen versehen sein. Daher gehe ich davon aus, dass sie dem Orden zwar geistig verbunden sind, dessen Ziele nach Kräften fördern und deshalb das Recht erhalten haben, den Waffenrock der Templer zu tragen; dass sie selbst dem Orden aber nicht angehören.
Gugel: Typisches Winterkleidungsstück einfacher Menschen im Mittelalter. Es handelt sich um einen Umhang mit angeschnittener Kapuze, der im Rückenbereich unterschiedlich lang ist – von gut unterhalb der Schulterblätter bis zu den Kniekehlen, je nach Geschmack und Geldbeutel des Besitzers. Vorn reicht die Gugel allenfalls bis zu den Ellbogen oder dem halben Oberarm, um Bewegungsfreiheit für die Arme zu haben, aber gleichzeitig ausreichend zu wärmen.
Klafter: Altes Längenmaß, ca. 1,8 Meter
Klüverbaum: Rundholz an der vorderen Spitze eines Schiffes, das den Steven (Spitze des Schiffes) noch weiter verlängert. Am Klüverbaum kann an einer Rah (einem Querholz) ein kleines Vorsegel, das so genannte Galion, befestigt werden. Unter dem Klüverbaum befindet sich in der Regel die so genannte Galionsfigur, eine meist weibliche Figur, die auch auf den Namen eines Schiffes Bezug nehmen kann.
Konstabler: Nicht zu verwechseln mit dem untersten Polizeidienstgrad in Großbritannien! Eines der ständigen Ämter des Königreichs Jerusalem. Der Konstabler (im Film Statthalter genannt) war für die Armee und die Verwaltung zuständig. Auf heutigen Sprachgebrauch bezogen, ist der Konstabler mit dem Verteidigungsminister vergleichbar.
Kotau: Im Orient und in Fernost gebräuchlicher Gruß, bei dem sich der Grüßende dem Höhergestellten zu Füßen wirft und mit der Stirn den Boden berührt. Von der Haltung her ist der Kotau etwa vergleichbar mit der Gebetshaltung der Muslime, wenn sie sich kniend mit dem Kopf bis auf den Boden neigen. In extremen Fällen bedeutet Kotau auch, sich vor dem Herrscher auf den Bauch zu legen.
Lanze: Kleinste Einheit ritterlicher Truppen von unterschiedlicher Stärke, mindestens aber aus dem Ritter selbst, dem Knappen, Degenkämpfer, Bogenschützen, Knecht und evtl. Fußvolk bestehend (Quelle: L. u. F. Funcken, Waffen u. Rüstungen, S. 90 f Orbis Verlag 1990).
Mullah: Islamischer Geistlicher
Nasalhelm: Konischer, offener Helm mit langem Nasenschutz; gilt als typisch für normannische Ritter des 11. Jh. und wurde – zumindest von französischen Rittern – auch noch während der Kreuzzüge getragen.
Nubier: dunkelhäutiges Volk im heutigen Sudan. Nubien ist eine alte Bezeichnung für die Gegend, die heute der Sudan ist.
Rabenschnabel: Streithammer, dessen schmales Ende scharf wie ein Dolch angespitzt ist. Mit einem Rabenschnabel lässt sich ein Panzer oder Helm punktuell durchschlagen und kann tiefe Wunden reißen, selbst Knochen durchschlagen. Schläge mit dieser Waffe auf den Kopf sind in der Regel tödlich.
Richard, König von England: Ein kleiner, historischer Fehler… Balduin V. war zwischen dem 16. März 1185 und dem 20. September 1186 König von Jerusalem. Zu diesem Zeitpunkt war noch Henry II. König von England und führte gegen seinen Sohn Richard und dessen Brüder einen heftigen Kampf um den englischen Thron auf französischem Boden… Erst am 5. Juli 1189 unterlag Henry gegen Richard und musste ihm die Krone überlassen. Am 7. Juli 1189 starb Henry, möglicherweise als Folge eines Herzinfarktes.
Sergeant: Heute ein Unteroffiziersdienstgrad in anglo- und frankophonen Ländern, gab es diese Bezeichnung zumindest im französischen Sprachraum bereits im Mittelalter für nichtadlige berittene Kriegsknechte. Sie erhielten einen besseren Sold als Fußsoldaten und standen in der Hierarchie des Söldnerheeres höher. Die Johanniter kannten ebenfalls eine Unterscheidung in adlige Ritterbrüder und nichtadlige Sergeantenbrüder.
Schmiede und Erfindungen: Es ist in der Folge der Kinoversion des Films immer wieder bezweifelt worden, dass ein einfacher Schmied wie Balian einfach so aus dem Stand heraus solche Konstruktionen produziert. Schmiede waren im Mittelalter nicht nur in ihrem speziellen Handwerk tätig (die Spezialausrichtungen wie Hufschmied oder Waffenschmied hatten sich noch nicht voll entwickelt; gerade Dorfschmiede machten alle Metallarbeiten, auch wenn sie sich – wie Balian – hauptsächlich mit Hufbeschlag beschäftigten), sie waren sehr oft auch geniale Erfinder. Balians Fähigkeiten in dieser Hinsicht, die im Director’s Cut ergänzend erklärt werden, sind also keineswegs aus der Luft gegriffen.
Söldner: Heute ein abwertender Begriff für den käuflichen Kämpfer, war es im Mittelalter eine wertneutrale Bezeichnung für nur zeitweise im Dienst eines Adligen stehende Kämpfer, der gegenüber seinen Untertanen auch Schutzfunktion hatte. Stehende Heere gab es nicht, die Lehensinhaber waren nur für maximal vierzig Tage im Jahr dienstpflichtig für den Lehnsherrn. Bei Bedarf wurden daher Söldner angeworben.
Titularbaron: Baron ohne zugängliches territoriales Lehen.
Alle im Heiligen Land angenommenen und verliehenen Titel, deren Territorien nach der Eroberung durch die Sarazenen verloren gingen, bestanden mit dem Präfix „Titular…“ in dieser Form bis etwa ins erste Drittel des 14. Jh. weiter. Nachdem mit dem Verlust von Akkon, der letzten christlichen Bastion, am 19. Mai 1291 die christliche Herrschaft in Palästina endgültig beendet war und eine Erneuerung mangels weiterer Kreuzzugsbereitschaft des europäischen Adels auch nicht möglich schien, erloschen diese Titel mit dem Tod desjenigen Titularinhabers, der den Titel noch vor 1291 angenommen oder verliehen erhalten hatte. Lediglich der Königstitel Jerusalems wird bis in die Gegenwart in den Häusern Bourbon, Habsburg, Wittelsbach sowie im Haus Baccari vererbt. Das Haus Baccari ist eine uneheliche Seitenlinie des Hauses de Lusignan …
Trébuchet: Auch Blide genannt. Dreibeiniges Belagerungsgerät, das am eigentlichen Wurfarm zusätzlich eine sehr lange Schleudervorrichtung aus Seilen und einer Art Sack hat, mit der das Geschoss (meist aus Stein) über größere Entfernungen geschleudert werden kann.
Turkopolen: Leichte Reiterei der Christen im Heiligen Land während der Kreuzzüge, spezialisiert auf die Kampfweise der Sarazenen (sie konnten vom galoppierenden Pferd Pfeilhagel abschießen und verstanden sich auf den Angriff mit der leichten Lanze oder dem Wurfspeer). Es handelte sich um im Land geborene Männer, die nicht einmal unbedingt Christen sein mussten.
Vexillum (Pl. dt.: Vexillen): Fahne, die an einer Querstange hängend an einem Fahnenstock befestigt wird. Vexillen sind die ältesten bekannten Fahnen und wurden schon in der römischen Armee verwendet. Von dem Begriff leitet sich auch Vexillologie als Wissenschaft von Fahnen und Flaggen ab.
Vier bis fünf Tage: Macht sich dramaturgisch gut, ist historisch aber falsch. Die Schlacht bei Hattin fand am 4. Juli 1187 statt, Jerusalem wurde von Saladin und seinen Truppen aber erst am 20. September 1187 erreicht. Der historische Balian von Ibelin hatte also gut zwei Monate Zeit, um eine Verteidigung zu organisieren …
Widder: Hölzerner Rammbock, dessen Rammspitze mit einem Widderkopf aus Metall – meist Bronze oder Eisen – verstärkt ist.
Zeit, die verging: Sowohl der Film in der Kino- und der Director’s-Cut-Fassung als auch die mir vorliegenden Drehbücher ergeben außer der anfangs genannten Jahreszahl 1184 und den vier bis fünf Tagen, die Raymond von Tiberias nennt, keine weiteren Zeitangaben. Balian muss Jerusalem noch vor dem 16. März 1185 erreicht haben, denn König Balduin IV. starb am 16. März 1185. Balduin V. war von diesem Zeitpunkt bis zum 20. September 1186 König, Guy de Lusignan nach der Krönung durch Sibylla (historisch) bis 1192 König von Jerusalem (falls er die Hiebe Balians überlebt hat, gilt das auch für den Film…). Richard Löwenherz brach im Juli 1190 von Burgund aus gemeinsam mit König Philippe II. August von Frankreich zum Kreuzzug auf, also fast drei Jahre nach dem Fall Jerusalems. Da Balian im Film Jerusalem unmittelbar nach dem Fall verlässt, müssen bis zum Besuch Richards bei ihm in Saint-Martin-au-Bois gut zwei Jahre vergangen sein …
Besetzungsliste
(in der Reihenfolge des Auftretens im Film)
| Rolle | Darsteller(in) | Quelle |
| François, Totengräber | Martin Hancock | Drehbuch |
| Père Michel, Priester | Michael Sheen | G. Wessel |
| Natalie, Balians Frau | Natalie Cox | G. Wessel |
| Firuz | Eriq Ebouaney | imdb |
| Odo | Jouko Ahola | imdb |
| Jean, Johanniterritter | David Thewlis | G. Wessel |
| Kevin, englischer Sergeant | Kevin McKidd | G. Wessel |
| Godfrey von Ibelin | Liam Neeson | imdb |
| Philippe, Godfreys Knappe | Philip Glenister | G. Wessel |
| Guillaume, Bischof | Bill Paterson | G. Wessel |
| Hugo du Puiset, Godfreys älterer Bruder | Richard Pugh | historisch |
| Balian von Ibelin | Orlando Bloom | imdb |
| Alter Wächter | Tim Barlow | imdb |
| Balians Lehrling | Bronson Webb | imdb |
| Nicolas, Dorfsheriff, Godfreys Neffe | Nicolaj Coster-Waldau | G. Wessel |
| Paul, Sohn von Roger de Cormier | Paul Brightwell | G. Wessel |
| Priester mit der Engelsstimme | Steven Robertson | imdb |
| Alter Pilger | Peter Copley | imdb |
| Guy de Lusignan | Marton Csokas | imdb |
| Imad ad-Din | Alexander Siddig | Drehbuch |
| Mohammed al-Faes, sarazenischer Ritter | Moustapha Touki | Dialog |
| Almaric | Velibor Topić | imdb |
| Michel, junger Sergeant | Michael Shaeffer | G. Wessel |
| Sibylla | Eva Green | imdb |
| Raymond von Tiberias | Jeremy Irons | Drehbuch |
| Nasser, Muslimischer Grande | Nasser Memeriay | G. Wessel |
| Heraclius, Patriarch von Jerusalem | Jon Finch | historisch |
| König Balduin IV. | Edward Norton | imdb |
| König Balduin V. | Alexander Potts | imdb |
| Latif, alter Haushofmeister von Ibelin | Lofti Yahya Jedidi | Dialog |
| Samira, Sibyllas Zofe | Samira Draa | G. Wessel |
| Gérard de Ridefort, Templergroßmeister | Ulrich Thomsen | historisch |
| Reiter | Matthew Rutherford | imdb |
| Saladin | Ghassan Massoud | imdb |
| Khaled Ibn Jubayr, Mullah | Khaled Nabawy | Drehbuch/Wessel |
| Saladins Schwester | Giannina Facio | imdb |
| Sarazenischer Bote | Karim Saleh | imdb |
| Raschid, sarazenischer Maschinist | Emilio Doorgasingh | Dialog |
| Pierre, Bauernjunge/Diener des Patriarchen | Peter Cant | G. Wessel |
| Richards Ritter | Angus Wright | imdb |
| Richard Löwenherz | Iain Glen | imdb |
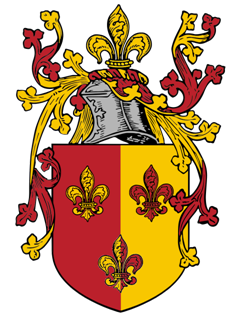

Schreibe einen Kommentar