Prolog
Jonas Mönke bekam ein breites Grinsen, als er den Brief öffnete und das Schreiben las. Es hatte geklappt! Der Felder-Verlag in Hamburg hatte sein Manuskript „Die Glocke des Todes“ akzeptiert. Seit Jahren frönte Jonas der Schreibleidenschaft, aber Anerkennung hatte er dafür nur innerhalb einiger Fanfiction-Seiten im Internet bekommen – und auch nur dann, wenn er wirklich Fanfiction schrieb, also bekannte Filme oder Bücher weiterdachte. So etwas konnte man nur als kostenloses Lesematerial veröffentlichen. Verkaufen war unmöglich, weil das augenblicklich Urheberrechtsstreitigkeiten hervorgerufen hätte.
Die Geschichte, die sein Großvater Hinnerk Trojan ihm erzählt hatte, hatte aber offenbar etwas an sich, was auch einen professionellen Verlag dazu brachte, das Manuskript in ein Buch zu verwandeln – und zwar gegen Bezahlung. 5.000 € bot der Verlag für die erste Auflage von zweitausend Exemplaren sowie 0,50 € Tantiemen vom Verkaufspreis, der in der Taschenbuchversion pro Exemplar mit 10 € angesetzt war, falls mehr als die zunächst geplanten zweitausend Exemplare verkauft würden. Die Rechte verblieben bei Jonas als Autor, er würde darüber frei verfügen können, falls eine Verarbeitung des Stoffes in einem anderen Medium – zum Beispiel einem Film – erfolgen sollte. Der Verlag verlangte jedoch eine ausdrückliche Erklärung, dass eventuelle Urheberrechtsstreitigkeiten allein vom Autor zu bereinigen seien. Die Erklärung verlangte auch, dass in einem solchen Fall seine Adresse dem Anspruchserhebenden bekannt gegeben werden durfte.
Die verlangte Erklärung schreckte Jonas nicht. Die Geschichte war schlimmstenfalls Volksgut, bestenfalls beruhte sie auf Forschungen seines Urgroßvaters Boris Trojan, der gewiss nichts dagegen gehabt hätte, diesen Stoff romanhaft aufzubereiten. Auch das Titelbild hatte Jonas selbst als Computergrafik gezeichnet – kopiert von einem Bild seines Großvaters, das er vergeblich zu digitalisieren versucht hatte. Der Scanner hatte sich beharrlich geweigert, die wirklich großformatige Zeichnung so zu kopieren, dass eine nahtlose Abbildung möglich gewesen wäre.
Dass die Glocke auf dem Titelbild einem Requisit, das für den Film Mykene des deutschen Regisseurs Peter Wolfson angefertigt worden war, bis ins Detail glich, störte Jonas nicht. Der Produktionsdesigner des Films hatte sich wahrscheinlich an einem sehr ähnlichen antiken Stück orientiert. Jonas wusste von seinem Großvater, dass Urgroßvater Boris Trojan eben diese Glocke noch vor oder während des Krieges im Museum für Hamburgische Geschichte gesehen hatte. Er hatte davon auch Fotos gemacht, aber die waren wohl in den Wirren des Krieges verschollen – ebenso wie das druckfertige Manuskript der Forschungsarbeit, die sein Urgroßvater im Auftrag der Regierung des Dritten Reichs gemacht hatte, deren Ergebnis ihn aber hatte in Ungnade fallen lassen, weshalb er im KZ Trassenheide gelandet war, das er nicht mehr lebend verlassen hatte. Er war im August 1943 beim Angriff der Alliierten ums Leben gekommen.
Das Bild, auf dem Jonas‘ Computergrafik beruhte, hatte sein Großvater über fünfzehn Jahre zuvor gezeichnet, denn seit 1998 war Hinnerk Trojan blind.
Jonas las sich den Vertrag dennoch dreimal durch, bevor er ihn dann doch unterschrieb. Als Schadensachbearbeiter bei der Hamburger Niederlassung einer Kölner Versicherung war er es gewohnt, nach rechtlichen Haken zu suchen. Er fand keine. Den unterschriebenen Vertrag steckte er in ein großes Briefkuvert, adressierte den Brief an den Felder-Verlag, frankierte ihn und trug ihn noch schnell zum Briefkasten vor dem kleinen Eckladen auf der anderen Seite der Straße, in der er wohnte, der um 17.00 Uhr noch geleert wurde. Auf dem Rückweg ging er nicht ins Haus zurück, sondern öffnete die Tiefgarage, die unter dem achtstöckigen Haus lag, in dem er im Hamburger Stadtteil Farmsen wohnte, eilte zu seinem Auto und fuhr gleich zu seinem Großvater, der seit einigen Jahren im Altenheim in der Berner Allee lebte.
Hinnerk Trojan war ein zäher Mann. Am 29. März 2012 war er 92 Jahre alt geworden. Er hatte gelernt, mit der ewigen Dunkelheit klarzukommen, die ihn im Juni 1998 von einer Minute auf die andere ereilt hatte, als der Sehnerv infolge eines Infarktes zerstört worden war. Seine Wohnung in der Ebeersreye in Farmsen, eine Eigentumswohnung, hatte er zwar aufgeben müssen, aber seine Tochter Britta hatte ihn zu sich in die große Wohnung am Schierenberg in Berne genommen, wo er Wand an Wand mit seinem Enkel Jonas gewohnt hatte. Die anfängliche Angst, die er gehabt hatte, wegen seiner Blindheit ständig irgendwo buchstäblich anzuecken hatten Britta, Schwiegersohn Bernd Mönke und Enkel Jonas ihm nehmen können. Jonas, der damals noch ein Junge von neun Jahren gewesen war, hatte schnell herausgefunden, dass sein Großvater erstens mit einem fantastischen Gedächtnis gesegnet war, zweitens sehr feinfühlige Finger hatte und drittens das Orientierungsvermögen einer Fledermaus hatte. Es war Jonas‘ Idee gewesen, seinem Opa besondere Leitfäden aus verschiedenen Leinen in Handhöhe an die Flurwand zu montieren. Anhand der unterschiedlichen Materialien konnte der Blinde schnell erlernen, ob er sich auf dem Weg zur Küche, zu seinem Zimmer oder zur Toilette befand.
Für Jonas selbst hatte die Blindheit seines Großvaters bedeutet, dass er von eben auf jetzt hatte Ordnung halten müssen, denn Blinde finden Dinge nur dann, wenn sie stets am selben Ort deponiert sind. Er hatte es so gut gelernt, dass es selbst seinen Eltern gelegentlich zu viel geworden war, wenn der Sohn den Eltern hinterher geräumt hatte. Hinnerk hatte sich bedankt, indem er seinem extrem interessierten Enkel sehr viel erzählt hatte. Irgendwann hatte Jonas angefangen, alles aufzuschreiben, was Hinnerk ihm erzählte. Dann hatte er ihm vorgelesen, was er aufgeschrieben hatte, sein Großvater hatte interessiert zugehört und bemerkt, dass sein Enkel Schreibtalent hatte. Während Bernd Mönke – obwohl als Journalist selbst zur schreibenden Zunft gehörig – die Schreiberei seines Sohnes eher als kindliches Hirngespinst abgetan hatte, hatte Hinnerk Jonas in dieser Hinsicht gefördert, wo es nur ging.
Hinnerk Trojan war gelernter Fischer, hatte sein Handwerk in seinem Heimatort Koserow auf Usedom gelernt. Nach dem Krieg, der seinen älteren Bruder Hannes und seinen Vater das Leben gekostet hatte, hatte er mit seinem Fischerboot nicht nur für das Überleben seiner Mutter und sein eigenes sorgen können, sondern auch für andere Leute im Dorf. Als die Fischer sich ab 1952 mehr oder weniger freiwillig zu Fischereiproduktionsgenossenschaften der See- und Küstenfischer zusammenschlossen, gehörte der immer etwas vorlaute Hinnerk bald zu deren einflussreicheren Mitgliedern.
Womit er sich überhaupt nicht abfinden konnte, war der 1954 in der DDR eingeführte Straftatbestand „Republikflucht“. Nach Hinnerks Meinung waren Menschen frei und konnten reisen, wohin es ihnen beliebte. Ein Staat, der seine Bürger innerhalb der eigenen Grenzen einsperrte, ihnen verbot, das Land zeitweise oder dauerhaft ohne eine ausdrückliche Genehmigung zu verlassen, handelte gegen die Menschenrechte – etwas, das die Kommunisten sich doch gerade auf die Fahnen geschrieben hatten.
Trojan hatte auf seine Weise gegen diese ihm unmenschlich erscheinende gesetzliche Regelung opponiert: Wer im Bezirk Rostock, zu dem die Insel Usedom seinerzeit gehört hatte, „rübermachen“ wollte, wie Flucht aus dem so genannten Arbeiter- und Bauernstaat in den vermeintlich „goldenen Westen“ genannt wurde, der hatte sicher sein können, dass er in Koserow Hilfe fand. Fast jeden Monat hatte Hinnerk Trojan zwei bis drei Personen weit genug in die Ostsee hinausgefahren, dass ein zwischen Bornholm und dem westdeutschen Niendorf/Ostsee fahrender Schleuser die Flüchtlinge aufnehmen konnte. Das war relativ lange gut gegangen, insbesondere deshalb, weil Trojan gerne weiter nach Osten in polnische Gewässer fuhr. Doch etwa ein Jahr nach dem Mauerbau in Berlin und der kompletten Abriegelung der Westgrenze der DDR war aus dem Nebel wie aus den Wellen gewachsen ein Schnellboot der Volksmarine erschienen, hatte dessen Crew Trojans Boot gestoppt, ihn und seine Mitfahrer verhaftet.
Was immer Hinnerk Trojan sein Eigen genannt hatte, war konfisziert und enteignet worden – Boot, Haus, Fischerhütte am Strand, Grundstücke. Seine Familie – seine Frau Eva und seine knapp sechs Monate alte Tochter Britta – war nach Magdeburg zwangsumgesiedelt worden, Hinnerk selbst in Bautzen im „gelben Elend“ eingekerkert worden, dem wohl berüchtigtsten Gefängnis der DDR. Erst zehn Jahre später, als er seine Haft wegen „Beihilfe zum ungesetzlichen Grenzübertritt“ abgesessen hatte, hatte er seine Familie wiedergesehen. Hinnerk war als politischer Häftling freigekauft worden und hatte 1973 mit seiner Familie die DDR verlassen können.
In der Bundesrepublik hatte Trojan mit seiner Familie in Niendorf/Ostsee gelebt und hatte wieder als Fischer gearbeitet. Eva hatte einen Bungalow im Garten als Ferienwohnung vermietet. Die Hamburger Familie Mönke hatte zu den Feriengästen gehört, die ab 1974 regelmäßig bei den Trojans Urlaub an der Ostsee gemacht hatten. Bernd, der Sohn der Familie, der mit knapp 14 Jahren kaum zwei Jahre älter war als Trojans Tochter Britta, hatte sich mit ihr angefreundet, hatte fast jede Möglichkeit genutzt, nach Niendorf zu kommen, war auch mit Hinnerk zum Fischen gefahren. Aus einer Urlaubsbekanntschaft war eine Brieffreundschaft geworden, die sich zu Liebe ausgewachsen hatte. Am 8. August 1988 hatten Britta und Bernd geheiratet und waren nach Hamburg in die Ebeersreye 110 in Hamburg-Farmsen umgezogen. Als sich Jonas angekündigt hatte, war das junge Ehepaar in die deutlich größere Wohnung eines Angestellten der Abteilung Seeverkehr des Bundesverkehrsministeriums an den Schierenberg in Hamburg-Berne umgezogen, der zur Zentrale seines Ministeriums nach Bonn versetzt worden war. Drei Jahre später, nachdem Berlin neue deutsche Hauptstadt geworden war und die die ersten Planungen für den Umzug der Ministerien von Bonn nach Berlin aufkamen, hatte der Mann den Mönkes die Wohnung zum Kauf angeboten, weil sein Arbeitsplatz dauerhaft außerhalb Hamburgs bleiben würde.
Fast zum gleichen Zeitpunkt verkaufte die Versicherungsgesellschaft, der die Wohnblocks gehörten, in denen die Mönkes zuvor gewohnt hatten, die Wohnungen dort einzeln als Eigentumswohnungen. Britta, die nach dem Tod ihrer Mutter inzwischen von Hamburg aus die Ferienwohnungsvermietung in Niendorf betrieb, sah die Chance, ihren inzwischen 71-jährigen Vater nach Hamburg zu holen, dessen Haus in Niendorf ebenfalls als Ferienwohnung zu vermieten. Die Mönkes schlugen also richtig zu, kauften ihre eigene Wohnung am Schierenberg und ihre frühere Wohnung in der Ebeersreye. Hinnerk war nach Farmsen gezogen, nur sieben Kilometer von seiner Tochter entfernt.
Jonas war am 9. November 1989 geboren worden, jenem denkwürdigen Tag, als Günter Schabowski, seinerzeit Sekretär für Informationswesen in der DDR, anlässlich einer Pressekonferenz eher versehentlich eine neue Regelung für Reisen nach dem Ausland verkündete und diese auf Nachfrage als „sofort, unverzüglich“ wirksam bezeichnete. Es war der Tag, an dem die Mauer fiel, der wirkliche Anfang vom Ende der DDR. Schon wegen dieses Geburtstages hatte sich bei Jonas frühzeitig historisches Interesse entwickelt, der seinen Eltern und seinem Großvater schier Löcher in den Bauch gefragt hatte.
Weil sein Vater als Journalist oft unterwegs war und seine Mutter ebenfalls häufig wegen der Ferienwohnungen an der Ostsee außer Haus war, hatte Hinnerk seinen Enkel schon betreut, als der noch im Kindergarten gewesen war. Hinnerk, der sich als Rentner nicht wirklich ausgefüllt gefühlt hatte, hatte sich als der Märchenerzähler in Jonas‘ Kindergarten erwiesen – als Märchenerzähler, der mit ein paar Strichen die Geschichte auch noch illustrieren konnte, die er erzählte. Von ihm hatte Jonas auch gelernt, nach der Natur zu zeichnen. Nachdem er dann in der Schule deutlich besser gezeichnet hatte als seine Mitschüler, hatte Jonas auf Nachfrage erklärt, sein Großvater habe ihm das beigebracht. Der Rektor hatte Hinnerk daraufhin angeboten, eine Zeichen AG am Nachmittag zu veranstalten, was der auch gerne gemacht hatte – bis zum Juni 1998, als er so plötzlich blind geworden war.
Doch auch danach war Hinnerk Trojan häufig in der Schule gewesen – als Märchenerzähler, wie schon im Kindergarten. Hier hatte Jonas auch zum ersten Mal von der Glocke von Vineta gehört, die bei Gefahr aus der Tiefe des Meeres läutet.
Und nun hielt er diese Geschichte als fertiges Buch in der Hand, von ihm selbst geschrieben, das Bild von ihm selbst nach der Vorlage seines Großvaters gezeichnet, korrekturgehört von Hinnerk, korrekturgelesen von seiner Mutter Britta, von seinem Vater als nutzloser Spinnkram verspottet.
Als Jonas mit dieser Nachricht seinen Großvater im Pflegeheim Berne besuchte, weinte der alte Mann vor Glück. Jonas war dabei, seinen Urgroßvater zu rehabilitieren.
Kapitel 1
Böse Überraschung
Ein Jahr verging. Das Buch verkaufte sich gut. Inzwischen war die zweite Auflage mit deutlich mehr Exemplaren in den Buchhandlungen.
Als Jonas am Abend nach Hause kam und in den Briefkasten neben der Haustür sah, war außer Reklamewurfsendungen auch ein Brief von einem Rechtsanwalt Simeon Lupus darin. Jonas konnte sich zunächst keinen Reim darauf machen, weshalb er persönlich Post von einem Rechtsanwalt bekam, den er zwar beruflich kannte, mit dem er privat aber nichts zu tun hatte. Aber als er den Brief in seiner Wohnung öffnete, fiel er vor Schreck mehr in den Sessel, als dass er sich bewusst setzte. Er hielt eine Abmahnung in der Hand!
Der Anwalt trug vor, dass er von der Agamemnon Filmgesellschaft beauftragt sei, ihn, Jonas Mönke, wegen der widerrechtlichen Verwendung einer Zeichnung abzumahnen.
Der Brief lautete:
Hamburg, den 22. Februar 2013
Sehr geehrter Herr Mönke,
die Agamemnon Filmgesellschaft, 20149 Hamburg, Herwardeshuder Weg 25[1] hat mich mit der rechtlichen Vertretung bezüglich der Verwertungsrechte des ihr am Film Mykene zustehenden Urheberrechtes beauftragt. Diese Rechte erstrecken sich sowohl auf den veröffentlichten Film als auch auf die Entwürfe der Abteilung Produktionsdesign, die für Kulissen, Kostüme und Ausstattung verwendet wurden.
Namens und im Auftrag meiner Mandantschaft mahne ich Sie gem. § 97 a UrhG wegen der widerrechtlichen Verwendung des Abbildes der im Auftrag meiner Mandantschaft entworfenen Glocke als Titelbild Ihres Buches „Die Glocke des Todes“ ab.
Sie werden hiermit gem. § 98 UrhG aufgefordert, die weitere Verwendung dieses Abbildes zu unterlassen und Ihr Buch „Die Glocke des Todes“ mit einem anderen Titelbild zu versehen. Soweit bereits Exemplare Ihrer Bücher verkauft wurden, verlangt meine Mandantschaft gem. § 98 UrhG, dass diese Exemplare zurückgerufen und vernichtet werden.
Anliegend erhalten Sie eine strafbewehrte Unterlassungerklärung, die Sie bitte innerhalb einer Woche unterzeichnet zurücksenden wollen. Sie haben die Kosten meiner Inanspruchnahme zu tragen.
Entgegenkommenderweise bietet meine Mandantschaft Ihnen einen Vertrag über die Nutzung des Abbildes der Glocke gegen Lizenzgebühren an. Für den Fall, dass Sie dieses Vertragsangebot annehmen, ist meine Mandantschaft bereit, auf die Unterlassung und den Rückruf zu verzichten. Den Vertrag finden Sie in der Anlage.
Sollte nach Ablauf der Frist weder die Unterlassungserklärung noch der angebotene Vertrag unterzeichnet bei mir vorliegen, wird meine Mandantschaft Klage erheben.
Hochachtungsvoll
Lupus
Rechtsanwalt
Anlagen: anwaltliche Vollmacht, Unterlassungserklärung, Vertragsangebot
Die beigefügte Unterlassungserklärung enthielt tatsächlich die Forderung, sämtliche bereits verkauften Exemplare zurückzurufen und zu vernichten, der angebotene Vertrag verlangte eine pauschale Lizenzgebühr für die bereits verkauften Bücher in Höhe von zehntausend Euro und eine weitere Mindestgebühr von eintausend Euro pro Jahr, wenn nicht mehr als tausend Exemplare pro Jahr verkauft würden. Den Nachweis über die verkauften Exemplare sollte Jonas spätestens einen Monat nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres erbringen.
Er schnaufte. Wenn er diesen Vertrag unterschrieb, zahlte er für seine Arbeit noch drauf, denn jedes verkaufte Exemplar würde fünfzig Cent Kosten verursachen, statt sie einzubringen … Im ersten Impuls wollte er einen gepfefferten Brief an den Anwalt schreiben, der ihm schon beruflich ein Dorn im Auge war, genoss Lupus doch den Ruf, hauptsächlich Betrüger zu vertreten. Er hielt sich gerade noch zurück und wählte dann die Nummer seines Freundes Leon Hameister, der Anwaltsgehilfe bei Rechtsanwalt Ralf Schmidt war, einem der Hausanwälte der Sperling Assekuranz, bei der Jonas als Sachbearbeiter in der Kraftfahrt-Schadenabteilung arbeitete.
„Hi, Leon. Ich brauche die Hilfe deines Chefs“, sagte er.
Ralf Schmidt las die Abmahnung, als Jonas sie ihm am folgenden Tag nach Feierabend in die Kanzlei trug.
„Mal wieder typisch Lupus …“, kommentierte er das Anwaltsschreiben. „Ich nehme nicht an, dass Sie auf diese Forderung eingehen wollen“, mutmaßte er.
„Nein, weshalb sollte ich? Erstens habe ich keine Ahnung, wie ich es anstellen soll, etwa zehntausend Bücher zurückzuholen, von denen ich nicht weiß, an wen sie verkauft wurden. Zweitens: Selbst wenn das möglich wäre, würde ich damit etwa hunderttausend Euronen löhnen, wenn nicht mehr, schließlich hat der Verlag ja auch Kosten gehabt, die ich dann wohl auch ersetzen müsste. Drittens habe ich die Kohle nicht und viertens ist das mit der Urheberrechtsverletzung Quatsch mit Soße. Das Bild habe ich nicht von der Filmglocke abgepinselt.“
„Welchen Beweis können wir vorlegen, dass du diese Glocke nicht von den Produktionsfotos abgezeichnet hast?“, hakte Leon nach, der bei dem Gespräch dabei war.
„Ich habe diese Zeichnung meines Großvaters als Vorlage verwendet“, sagte Jonas und präsentierte seinem Freund und dem Anwalt eine Tuschezeichnung, die mit Hinnerk Trojan gezeichnet war.
„Von wann ist diese Zeichnung?“, hakte Schmidt nach.
„Die muss von vor 1998 sein, denn Opa hat in dem Jahr einen Sehnervinfarkt gehabt und ist seitdem blind“, erklärte Mönke.
„Das heißt: Er würde die Zeichnung heute nicht mehr als seine erkennen“, konstatierte Ralf.
„Nein, das nicht“, räumte Jonas ein. „Aber er könnte dem Gericht vortragen, wann er die Zeichnung gemacht hat – und worauf er sich dabei möglicherweise gestützt hat. Sehen Sie: Opas Zeichnung ist praktisch identisch mit der Glocke auf den Filmfotos.“
„Versteh‘ meine Frage jetzt bitte nicht falsch: Kennst du den Film?“, fragte Leon.
Jonas sah seinen rechtskundigen Freund an, als wären ihm Hörner gewachsen.
„Wir waren da zusammen drin, Leon!“, erinnerte er verstört.
„Logo. Wir waren auch zusammen in der Requisitenausstellung, die ein halbes Jahr nach dem Kinostart in London war“, erwiderte Leon seufzend. „Und ich erinnere mich, dass du das alles wie blöd fotografiert hast. Jonas, wir müssen beweisen können, dass diese Zeichnung hier“, er wedelte mit dem Blatt, „die alleinige Grundlage für dein Titelbild ist. Du bist ein guter Zeichner. Diese Zeichnung könntest du theoretisch selbst gemacht haben – das jedenfalls würde der Anwalt der Gegenseite dir sicher vorhalten, wenn wir das so vortragen.“
„Mein Großvater könnte aussagen, dass er vor 1998 eine antike Glocke gezeichnet hat, dass er zu dem Zeitpunkt noch gesehen hat. Und er könnte mit ärztlichen Unterlagen belegen, dass er seit 1998 blind ist – von eben auf jetzt duster. Der Film ist erst 2004 in die Kinos gekommen.“
„Okay, ich benenne ihn als Zeugen“, sagte Schmidt. „Aber …“
„Was?“
„Noch besser wäre, wenn wir den Beweis führen könnten, dass diese Glocke im Film gar nicht das geistige Eigentum des Produktionsdesigners ist, sondern dass sich beide an einer realen Glocke orientiert haben“, sinnierte Ralf. „Haben Sie ’ne Ahnung, woher Ihr Großvater die Idee hatte?“
„Er hat mir mal von der Vineta-Sage erzählt und diese Glocke schon vor wenigstens zwanzig Jahren so beschrieben, wie sie hier ist. Woher er wusste, wie die aussieht, habe ich als kleines Kind nicht gefragt“, erklärte Mönke. Der Rechtsanwalt nickte.
„Ich werde den Anspruch in Ihrem Namen zurückweisen“, erwiderte er. „Aber Ihnen ist schon klar, dass eine Filmgesellschaft sich davon nicht beeindrucken lassen wird, oder?“
Jonas nickte seinerseits.
„Klar wie Kloßbrühe.“
„Sie haben doch bestimmt ’ne Rechtsschutzversicherung, oder?“
„Ja, bei meinem geliebten Arbeitgeber. Rechtsschutz ist allerdings in der Zentrale in Köln.“
Jonas nahm einen Schnellhefter aus seiner Aktentasche, der die Prämienrechnungen seiner Versicherungen enthielt und gab sie seinem Freund. Leon suchte darin nach der Sparte Rechtsschutz und schrieb die Versicherungsscheinnummer ab.
„Ich setz‘ mich mit denen in Verbindung. Gib mir noch die Adresse deines Großvaters“, sagte er schließlich
„Schiet, die hab‘ ich nicht hier. Der ist im Altenheim in Berne. Ich funk‘ dir das nachher durch.“
„Altenheim? Wie alt ist Ihr Großvater?“, erkundigte sich Ralf.
„Dreiundneunzig.“
„Oha!“
Rechtsanwalt Simeon Lupus bekam ein breites Grinsen, als er drei Tage später zu der Abmahnungssache Agamemnon Film folgenden Brief erhielt:
Hamburg, den 26. Februar 2013
Sehr geehrter Herr Kollege,
Herr Jonas Mönke hat mich mit seiner rechtlichen Vertretung in obengenannter Sache beauftragt. Den weiteren Schriftwechsel wollen Sie daher bitte mit mir führen. Eine auf mich lautende Vollmacht ist als Anlage beigefügt.
Zum Sachverhalt: Mein Mandant sieht sich nicht veranlasst, die von Ihnen namens und im Auftrag der Agamemnon Filmgesellschaft gem. § 98 UrhG erhobenen Ansprüche zu befriedigen. Die auf dem Cover seines Buches „Die Glocke des Todes“ abgebildete Glocke ist weder von der im Film Mykene Ihrer Mandantschaft abgezeichnet noch ist diese im Film Ihrer Mandantschaft deren geistiges Eigentum. Mein Mandant hat die Glocke von einer Tuschezeichnung seines Großvaters digitalisiert und nicht von Screenshots des Films oder von eventuell davon existierenden Fotos. Diese Zeichnung hat der Großvater meines Mandanten vor 1998 gefertigt, da er eben seit 1998 erblindet ist. Vom Großvater meines Mandanten stammt im Übrigen auch die dem Roman zugrunde liegende Geschichte.
Unter diesen Umständen wird mein Mandant weder eine Unterlassungserklärung abgeben noch einen Vertrag unterschreiben, der ihn zur Zahlung von Lizenzgebühren zwingen würde. Auf die Frage, ob die verlangte Gebühr überhaupt der Höhe nach gerechtfertigt wäre, gehe ich an dieser Stelle nicht ein, da ein solcher Anspruch schlicht nicht besteht.
Mit kollegialem Gruß
Schmidt
Rechtsanwalt.
Anlage: Vollmacht
Er nahm den Telefonhörer und rief Hauke Schiemann an, den Leiter der Hamburger Vertretung der Agamemnon-Filmgesellschaft an.
„Moin, Herr Schiemann. Ich habe gerade die Antwort von Mönkes Anwalt bekommen. Erwartungsgemäß will er nicht zahlen“, sagte er, als er den Manager am Apparat hatte.
„Kenn‘ ich“, erwiderte Schiemann. „Wenn die Klage auf dem Tisch liegt, ziehen sie alle den Schwanz ein. Wer legt sich schon mit einer Filmgesellschaft an, deren Zentrale in Hollywood ist … Lassen Sie die Klage los!“
„Wird umgehend geschehen, wiederhören“, sagte Lupus zu. Als er aufgelegt hatte, ging er in das vor seinem eigenen Büro liegende Büro der Sekretärinnen.
„Frau Leipold, die Klage in der Sache Agamemnon gegen Mönke muss noch raus!“, rief er. Frau Leipold wedelte mit einem dicken Briefumschlag, der an das Landgericht Hamburg adressiert war.
„Is‘ eingetütet, Chef!“
Klagen können lange Beine haben, aber einmal in die Spur gesetzt, beginnen sich die Mühlen der Justiz unwiderruflich zu drehen. Die Agamemnon-Filmgesellschaft hatte einen so genannten Streitwert von mindestens 10.000 € angegeben. Damit war das Landgericht die erste Instanz, die sich mit dem Streit zu befassen hatte. Die Klage erreichte das Landgericht am 1. März 2013, durchlief den Verwaltungsweg, bekam ihre Stempel und landete am 4. März auf dem Tisch des zuständigen Rechtspflegers, der die für den Beklagten mitgegebene Kopie der Klage und die Kopien der schriftlichen und bildlichen Beweise, die die Klägerin vorlegte, zusammenheftete, ein Formblatt mit dem Aktenzeichen des Gerichtes und entsprechenden Texten versah, die dem Beklagten darlegten, dass und von wem gegen ihn Klage erhoben worden war und er innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung eine Verteidigungsanzeige durch einen Rechtsanwalt vorzulegen hatte und innerhalb von weiteren drei Wochen auf die Klage erwidern sollte. Der erste Verhandlungstermin sollte am 7. Mai 2013 im Landgerichtsgebäude am Sievekingplatz in Hamburg sein.
Als Jonas am 6. März 2013 nachmittags nach Hause kam, fand er eine vom Postboten ausgestellte Niederlegungsnachricht in seinem Briefkasten, die bedeutete, dass Agamemnon Pictures Ernst machte, Klage erhoben hatte und diese Klage bei der Postfiliale im Einkaufszentrum Farmsen niedergelegt war. Er sah auf die Uhr. Es war gerade halb fünf am Nachmittag, so dass die Post noch geöffnet hatte. Er drehte um, ging zurück in die Garage und fuhr sofort zum Einkaufszentrum. Es war Mittwoch und volle Einkaufszeit, aber er fand auf dem Parkdeck des Einkaufszentrums dennoch halbwegs schnell einen Parkplatz und hatte eine halbe Stunde später den gelben Briefumschlag, den er aus seinem beruflichen Alltag nur gar zu gut kannte, in der Hand.
Am folgenden Morgen rief er gleich um neun Uhr bei Leon an, um einen Termin zur Besprechung zu bekommen.
„Heute ist alles dicht und heute Abend hat der Chef eine Beurkundung, die länger dauern wird. Gib mir mal das Aktenzeichen, dann lasse ich heute noch die Verteidigungsanzeige los“, sagte er. Jonas nannte ihm das Aktenzeichen des Gerichtes.
„Okay, ich mache das gleich fertig. Morgen Nachmittag um halb fünf? Kriegst du das hin?“
„Ja, ich bin um halb fünf bei euch“, sagte Jonas. „Ich habe hier noch einen anderen Prozess, den ich euch auch gerne geben würde. Auch von unserem Freund Lupus. Der Lump hat wieder mal nur den Fahrer verklagt, aber der war wenigstens schlau genug, bei unserem Kunden anzurufen und das rechtzeitig einzustöpseln. Verteidigungsanzeige ist raus, ist ‘ne Amtsgerichtssache in Schwarzenbek. Das kann ich dann als Dienstgang erledigen.“
„Mach‘ ich. Bis morgen.“
Jonas nahm sich die Schadenakte mit dem Prozess vor, den Rechtsanwalt Lupus gegen den Fahrer des bei Sperling-Assekuranz versicherten Mietwagenunternehmens angestrengt hatte, schrieb im Computer den Brief an Schmidts Kanzlei mit dem Prozessauftrag, druckte ihn aus und ging mit der Akte zum Büro seines Chefs Gunnar Mahnke, der drei Zimmer weiter saß.
„Chef, die Sache Thiensen Mietwagen, in der Freund Lupus den Fahrer verklagt hat, habe ich soweit fertig. Ich würde den Prozess gern aufnehmen und die Sache dem Schmidt in Reinbek geben“, sagte er, als er eintrat.
„Diese Autobahngeschichte an der Raststätte Gudow?“, fragte sein Chef.
„Genau die. Ich würde morgen gern zu Herrn Schmidt fahren und ihm die Akte persönlich in die Hand drücken. Um halb fünf könnte ich bei ihm sein.“
„Ist gut. Anschreiben fertig?“
„Ja, bitte noch einmal unterpinseln.“
Mahnke unterschrieb den Prozessauftrag, den Jonas ihm vorlegte.
„Wann bist du morgen weg?“
„Halb vier.“
Am folgenden Tag fuhr Jonas nachmittags um halb vier mit der prozessfertigen Schadenakte und der Klage in seinem eigenen Prozess zu Rechtsanwalt Ralf Schmidt. Die Schadensache nahm Ralf an und sagte umgehende Klagerwiderung zu. Dann nahm er sich die Klage der Agamemnon Pictures vor.
Die Gesellschaft trug – via Rechtsanwalt Lupus – vor, dass der Produktionsdesigner Marcus D. Brown in seiner Eigenschaft als Angestellter der Agamemnon Pictures im Jahr 2002 für die Ausstattung des Films Mykene die Bronzeglocke entworfen habe, deren genaue technische Daten dem Entwurf in der Anlage zu entnehmen seien. Ebenfalls sei ein Foto der Glocke zur Visualisierung beigefügt. Die Nutzungsrechte an dieser Glocke und natürlich dem dazugehörigen Entwurf lägen gemäß § 43 UrhG (Urheberrechtsgesetz) bei der Agamemnon-Filmgesellschaft, deren Angestellter der Zeuge Brown sei, was mit einem anliegenden Vertrag in englischer Sprache nebst Übersetzung in die deutsche Sprache belegt werde. Der Urheber übertrage der nutzungsberechtigten Gesellschaft ausdrücklich das alleinige Recht, eine weitere Nutzung seines Werkes vertraglich zu regeln oder – bei unerlaubter Nutzung – einen diesbezüglichen Rechtsstreit zu führen. In dem Fall stehe er natürlich als Zeuge der Klägerin zur Verfügung.
Diesen Entwurf – ohne Maße – habe der Beklagte, Jonas Mönke, für die Illustration des Buchcovers seines Romans genutzt, ohne den Urheber Marcus Brown oder die nutzungsberechtigte Gesellschaft Agamemnon Pictures um eine entsprechende Erlaubnis zu bitten oder ein Vertragsangebot über die Nutzungserlaubnis abzugeben. Der Beklagte sei darauf gemäß § 97 a UrhG abgemahnt worden, gemäß § 98 UrhG sei verlangt worden, die weitere Verwendung des missbräuchlich genutzten Bildes zu unterlassen, die bereits ausgelieferten Bücher zurückzurufen und zu vernichten, wobei mit der Abmahnung entgegenkommenderweise ein Vertragsangebot übersandt worden sein, das es dem Beklagten ermöglicht habe, ohne einen Rechtsstreit gegen Zahlung einer Lizenzgebühr von einem Euro pro verkauftem Buch und einer einmaligen Zahlung von zehntausend Euro für die bereits verkauften Bücher weiterhin zu verwenden.
Dies habe der Beklagte mit Schreiben vom ausdrücklich abgelehnt, so dass nun Klage geboten sei.
Man werde beantragen, den Beklagten zu einer Zahlung von mindestens zehntausend Euro zu verurteilen und festzustellen, dass er verpflichtet sei, je weiterem verkauften Exemplar eine Gebühr von nicht unter einem Euro an die Klägerin zu zahlen. Für den Fall, dass der Beklagte nicht rechtzeitig seine Verteidigungsabsicht anzeige oder die gerichtliche Frist zur Abgabe der Klageerwiderung verstreichen lasse, werde ein Versäumnisurteil beantragt.
Ralf nickte.
„Das entspricht der Abmahnung. Ich werde wie in der Ablehnung der Abmahnung erwidern und Ihren Großvater als Zeugen für Ihren Vortrag benennen. Da Ihr Großvater ja nicht mehr ganz neu ist: Wer könnte noch bezeugen, dass er diese Zeichnung vor 1998 gemacht hat?“, fragte er.
„Meine Eltern“, sagte Jonas. Seufzend setzte er hinzu: „Nur werden die nicht begeistert sein, zu hören, dass es wegen dieses Bildes einen Prozess gibt. Aber ich muss sie leider sowieso einweihen, weil meine Mutter wegen Opas Blindheit sein rechtlicher Betreuer ist.“
„Dann sprechen Sie mit Ihren Eltern, bevor ich sie als Zeugen benenne und sie dann aus allen Wolken fallen, wenn ihnen eine Ladung des Gerichts ins Haus flattert. Die Adresse Ihrer Mutter brauche ich auf alle Fälle, denn wenn sie rechtliche Betreuerin ist, muss sie angeschrieben werden, wenn es um Ihren Großvater als Zeugen geht“, sagte Ralf. „Machen Sie das noch heute!“
„Okay, werde ich machen. Äh, Sie hatten in der Ablehnung bei der Abmahnung die Höhe der Forderung weggelassen. Ich denke, es wäre besser, das Gericht darauf hinzuweisen, dass ich für jedes Buch nur fünfzig Cent bekomme und die Forderung schon deshalb unmäßig ist, weil sie von mir verlangt, für meine Arbeit auch noch draufzuzahlen. Und wenn Sie es nur als hilfsweise deklarieren, falls das Gericht zu der Auffassung gelangt, dass ein grundsätzlicher Anspruch der Klägerin gegeben ist, auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann“, erwiderte Jonas.
„Gut, mache ich. Wir haben noch Zeit. Die Verteidigungsanzeige ist raus. Aber spätestens eineinhalb Wochen vor Ablauf der Erwiderungsfrist würde ich gern die Erwiderung abschicken. Aber da ist noch Ostern. Besser Montag, den 18. März, okay?“
„Alles klar“, bestätigte Jonas.
Kapitel 2
Beweise gesucht …
Bernd Mönke schüttelte nur noch den Kopf.
„Hab‘ ich dich nicht gewarnt, die Zeichnung als Titelbild zu verwenden?“, grollte er, als sein Sohn ihm von der Klage erzählte. „Und Opa da reinzuziehen, ist wirklich nicht das Gelbe vom Ei!“
„Opas Zeichnung ließ sich nicht vernünftig digitalisieren. Nach vier Anläufen mit dem Scanner habe ich aufgegeben und es lieber abgezeichnet. Aber ich habe das von seiner Zeichnung, nicht von den Fotos, die ich in der Ausstellung damals gemacht habe“, wehrte sich Jonas.
„Du hättest sie besser verändert!“, beharrte Bernd Mönke.
„Wieso hätte er das tun sollen? Wir haben doch Papas Zeichnung. Mit der sollte sich doch belegen lassen, dass Jonas nicht das Foto der Ausstellung als Vorbild genommen hat“, stand Britta Mönke ihrem Sohn bei.
„Schatz, dein Vater ist dreiundneunzig und ziemlich tüdelig. Du bist nicht ohne Grund seine rechtliche Betreuerin. Du kannst doch von dem alten Herrn nicht erwarten, dass er Jonas‘ Angaben vor Gericht stützen wird!“
„Paps, ich erwarte nicht, dass ihr mir in dem Prozess helft, auch wenn es toll wäre, wenn ihr – falls Opa nicht gehört werden kann oder ihr ihm das nicht zumuten wollt – als Zeugen meine Version dazu bestätigen könntet. Aber ohne Mutti kann Opa nicht mal als Zeuge geladen werden.“
„Du und deine Schreiberei!“, knurrte Bernd Mönke. „Das musste ja irgendwann Ärger geben!“
„Paps, es geht nicht um den Inhalt meines Buches, es geht um das Titelbild, das ursprünglich Opa gezeichnet hat“, versetzte Jonas. „Und diese Dödel behaupten, ich hätte den Entwurf ihres Produktionsdesigners benutzt. Das ist einfach nicht wahr, und das will ich auch nicht auf mir sitzen lassen – oder auf Opa. Mir ist ohnehin schleierhaft, wie es möglich ist, dass deren Glocke der Zeichnung von Opa gleicht wie ein Ei dem anderen.“
„Du lieber Himmel! Opa hat eine Glocke gezeichnet, die ihm sein Vater mal beschrieben hat! Der war Archäologe! Solche Glocken gibt’s doch sicher mehrfach!“, entgegnete sein Vater.
„Na ja, wenn das so wäre, dass der Produktionsdesigner sich eine antike Glocke vorgeknöpft hat und die abgezeichnet hat … wäre das dann überhaupt sein geistiges Eigentum, was ja Voraussetzung für eine Urheberrechtsverletzung wäre?“, schaltete sich Britta Mönke ein. „Und es hilft jetzt nichts, zu sagen, er hätte besser etwas verändert. Die Klage ist da, der Prozess läuft. Die Alternative zu einer Aussage wäre, dass Jonas bezahlt. Du kannst dir leicht ausrechnen, dass eine Erfüllung der Forderung bedeutet, dass er mehr Geld bezahlen müsste, als er überhaupt bekommen kann, ganz abgesehen von den Kosten. Wer kämpft, kann verlieren, aber wer gar nicht erst anfängt zu kämpfen, der hat von vornherein verloren!“
„Blöder Spruch“, entgegnete Bernd. „Na schön. Aber ich gebe nichts dazu, wenn’s schief geht. Dann muss er das Lehrgeld eben bezahlen und wird hoffentlich einsehen, dass er das nächste Mal auf einen Rat von mir hört. Hast du das verstanden, Jonas?“
„Ja, habe ich. Dass es dir nicht schmeckt, dass ich schreibe und damit versehentlich Erfolg habe, habe ich begriffen, Paps.“
„Wieso willst du – wenn du schon schreiben musst – nicht für eine ordentliche Zeitung arbeiten, statt dir diesen Quatsch aus den Fingern zu saugen?“, knurrte Bernd Mönke. „Nein, mein Herr Sohn musste ja einen Bürojob haben, der ihm immer schön einen pünktlichen Feierabend garantiert.“
„Hör‘ endlich auf, an meinem Hobby und meinem Beruf herumzumäkeln!“, entgegnete Jonas scharf. „Ich hatte nach dem Praktikum, zu dem du mich genötigt hast, einfach keine Ohren, mich ständig hetzen zu lassen, Artikel fertig zu bekommen!“
„Du schreibst ja auch mit der Dynamik einer Rolle Schlaftabletten!“, ätzte Bernd Mönke. Jonas schnaufte.
„Bitte, Mama, gib mir die Unterschrift, dass Opa als Zeuge benannt werden kann. Dann bin ich auch schon wieder weg“, sagte er, an seine Mutter gewandt.
„Toll, Jungs! Ihr beide in einem Raum, das geht nicht gut. Komm, Schatz, dein Vater ist heute nicht gut drauf“, sagte Britta Mönke kopfschüttelnd und lotste ihren Sohn an ihrem Mann vorbei in den Flur.
„Ja, mach‘ nur. Puder‘ ihm den Hintern, dem verwöhnten Bengel!“, knurrte Bernd hinterher.
„Einer seiner Artikel ist beim Chefredakteur nicht gut angekommen“, entschuldigte Britta die schlechte Laune ihres Mannes.
„Wenn er den mit der gleichen Laune geschrieben hat, die er mir gerade um die Ohren gehauen hat, wundert es mich nicht“, seufzte Jonas. Seine Mutter las das Schreiben an das Gericht durch, nickte und unterschrieb.
„Danke, Mutz!“, sagte Jonas und gab seiner Mutter einen Kuss.
„Jonas, warte mal“, sagte sie, als er gleich gehen wollte. „Opa geht es nicht gut. Er ist ein Kämpfer, nur deshalb ist er überhaupt so alt geworden. Bitte, reg‘ ihn nicht zu sehr auf, ja?“
„Es ist seine Geschichte, Ma. Es ist die Geschichte seines Vaters. Er hat sich wahnsinnig gefreut, als ich ihm davon erzählt habe, dass die Geschichte verlegt wird und ich für das Buch nichts bezahlen muss, sondern sogar noch Geld kriege. Ich hätte ihm diese Unannehmlichkeit gerne erspart, denn er hat im Laufe seines Lebens wirklich genug durchgemacht. Dass es wegen dieser blöden Glocke Kabbel gibt, wollte ich nicht“, sagte Jonas mit einem Seufzen. „Es ist so ungerecht: Paps hat mich ja schon immer mit meiner Schreiberei aufgezogen, weil er nicht verstehen kann, wie man sich Geschichten ausdenken kann und nicht haarklein irgendwelche Sensationsgeschichten recherchieren will, um Politikern an die Hose zu pinkeln. Das ist einfach nicht meine Welt, immer nur das Schlechteste von Menschen zu glauben. Und kaum habe ich tatsächlich Erfolg mit dem, was ich gerne tue, behauptet so ein Filmfuzzi, dass diese Glocke sein geistiges Eigentum ist. Muss ich das kapieren?“
„Nein. Und du solltest dem Anwalt auch sagen, dass es dir spanisch vorkommt, weshalb diese Glocke im Film der, die Opa so detailliert beschrieben hat, bis ins letzte Feld gleicht. Mir kommt das auch sehr seltsam vor. Wann fährst du zu Opa?“
„Jetzt gleich. Wieso?“
„Ich wäre gerne dabei“, sagte Britta. Jonas seufzte erneut.
„Okay, wann kannst du?“
Seine Mutter lächelte.
„Jetzt“, sagte sie.
Eine Viertelstunde später waren sie bei Hinnerk Trojan.
„Britta? Bist du das? Jonas?“, fragte der blinde alte Mann, als Mutter und Sohn sein Zimmer betraten.
„Ja, Papi, alle beide“, sagte Britta. Hinnerk streckte die Arme aus. Tochter und Enkel umarmten ihn, gaben ihm einen Kuss.
„Opa, ich brauch‘ deine Hilfe“, sagte Jonas. Der alte Mann bekam ein verschmitztes Grinsen.
„Was hast du ausgefressen, hm?“, fragte er.
„Nix. Aber jemand meint, mir Ärger machen zu müssen, weil ich deine Zeichnung dieser antiken Glocke für das Buch benutzt habe.“
Hinnerk seufzte.
„Immer dasselbe Lied. Die Glocke bringt Unglück. Ich hätte es wissen müssen“, sagte er.
„Opa, das ist doch nur eine Legende!“, wehrte Jonas ab.
„Legende? Wenn eine Stadt betroffen wäre, ja, dann würde ich das auch denken, mien Jung. Aber alles was du geschrieben hast, was ich dir erzählt habe, hätte dich eines Besseren belehren müssen. Troja, Sarmatien, der Hunnensturm anne Weichsel, Vinetas Untergang, der Untergang Rungholts und Hamburgs – nee, mien Jung, dat sind keine Zufälle nich‘ mehr. Dat is‘ Ernst“, entgegnete sein Großvater. „Nu weiß ich auch, dass ich die Glocke neulich wirklich hab‘ läuten hör’n.“
„Du hast …?“, fragte Britta schluckend.
„Jau, mien Deern. Bloß kann ich das hier kein ein vertell’n, sonst stecken die mich doch noch inne Klapsmühle“, erwiderte Hinnerk bestimmt.
„Opa, diese Glocke, die du mal gezeichnet hast, die ist genau in der Form in einem Film vorgekommen. Kann es so eine Glocke tatsächlich geben?“
„Jonas, es hat sie gegeben, so wahr ich hier sitze. Ich habe diese Glocke selbst im Museum in Hamburg gesehen, wo mein Vater Fotos davon gemacht hat.“
„Im Hamburg-Museum … ist die da immer noch?“, fragte Jonas.
„Nee, nachdem Hamburg von den Alliierten plattgemacht worden war, hat einer von diesen braunen Schwachköpfen befohlen, sie zu zerstören und wegzuschmeißen. Keine Ahnung, wo die sein kann.“
„Die Fotos, Opa, wo sind die?“, fragte Jonas.
„Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass mein Vater sie versteckt hat, ebenso wie das Manuskript für seine Veröffentlichung, aber ich weiß nicht wo.“
„Okay, alles gut, Opa. Wegen dieser Glocke habe ich einen Prozess am Hals. Würdest … würdest du …?“
„Zeuge? Aber so was von! Den‘n werd‘ ich schon erzählen, wo Bartel den Most holt!“, sagte er bestimmt. „Für dich tu‘ ich fast alles, das weißt du doch, mien Jung!“
„Danke, Opa. Dann werde ich meinem Anwalt sagen, dass er dich als Zeugen benennen kann. Wir kriegen dich schon heil ins Gericht und wieder zurück, keine Sorge.“
„Weißt, mien Jung‘, ich hab‘ schon wildfremde Leute in mei’m Boot ausse DDR gebracht. Da steh‘ ich für mein’n Enkel erst recht da. Keine Sorge, mein Lütt’n. Ward all’ns god.“
Er drückte Jonas fest an sich.
„Danke, Opa!“, bedankte Jonas sich.
„Wat’n kräftigen Druck. Sach‘ ma‘ wie groß bist du eigentlich?“
„Einssechsundachtzig, Opi“ grinste Jonas.
„Einssechsundachtzig? Hoppla, größer als ich! Und wie alt bist du jetzt?“
„Ich werde vierundzwanzig, Opa.“
Hinnerk lachte herzhaft.
„Ja, ja, in dem Alter wollte ich auch immer gern ein Jahr älter sein. Das gibt sich später, mien Jung. Aber was ich in deinem Alter erlebt habe, wünsche ich dir nicht. Immer auf der Flucht vor Tieffliegern … Du lebst in besseren Zeiten, vergiss das nie!“
„Das werde ich nicht, Opa.“
Hinnerk hob die rechte Hand, Jonas klatschte ihn ab.
„Wir packen das!“, bekräftigte der alte Mann.
„Wir packen das!“, bestätigte Jonas.
Am folgenden Tag rief Jonas Leon an und sagte ihm, dass er seinen Großvater als Zeugen benennen könne.
„Da ist noch was: Die Glocke selbst. Ich habe sie definitiv nicht von der aus Mykene kopiert. Das schwöre ich bei Gott und allen Heiligen. Aber wie, zum Teufel, ist es möglich, dass ein Produktionsdesigner einer Filmfirma genau diese Glocke zeichnet, die auch mein Opa auf Papier gezaubert hat? Da muss es doch ein Vorbild gegeben haben!“, sagte er, als er die Adresse durchgegeben hatte.
„Du meinst, der hat das irgendwo abgepinselt? Das wäre natürlich der beste Aufhänger, um die mit Dreck zu bewerfen. Hat dein Opa dir dazu auch was sagen können?“, erkundigte sich Leon.
„Er hat mir gesagt, dass er diese Glocke im Museum für Hamburgische Geschichte gesehen hat.“
„Äh, wie soll die denn dahin gekommen sein?“, fragte Leon verblüfft.
„Als er mir das erste Mal davon erzählte, dass diese Glocke auch Hamburg Unglück gebracht hat, habe ich das zwar so übernommen und, das auch so im Roman geschrieben, aber ich habe das eher für Kokolores gehalten, gebe ich zu. Jetzt seh‘ ich das etwas anders. Uropa hat wohl herausgefunden, dass diese Glocke von einem Rungholter Schiffer nach Hamburg gebracht werden sollte, als sie gerade noch vor dem Untergang von Rungholt gerettet werden konnte. Die Rungholter hatten Handelskontakte nach Hamburg. Zudem ist um die Zeit etwa die Nikolaikirche in Hamburg gebaut worden, für die sie angeblich bestimmt war – sie kam hier nur nie an, weil das Schiff in einem Sturm gesunken ist – und zwar vor der Insel Neuwerk, die schon damals zu Hamburg gehörte und immer noch das älteste Gebäude von Hamburg hat, nämlich den Leuchtturm. Sie soll wohl bei Baggerarbeiten in der Elbmündung im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts dort gefunden worden sein und nach Hamburg ins Museum gebracht worden sein. Uropa hat sie angeblich im Museum besucht, samt seinem Sohn. Er soll sie da sogar fotografiert haben, aber die Fotos hat er laut Opa ebenso versteckt wie sein Manuskript, damit es den Nazis nicht in die Hände fällt. Nur hat er vergessen, seinem Sohn zu sagen, wo er das vergraben hat. Aber Opa wird das im Prozess so bestätigen können.“
„Is‘ ja abenteuerlich … Das wäre ein Fall für einen Archäologen, oder?“, hakte Leon nach.
„Jetzt müsste man Indiana Jones zur Hand haben …“, seufzte Jonas.
„Vergiss es! Dann hast du auch noch Ärger mit dem Spielberg!“, lachte Leon. „Aber du hast Recht. Das ist ein seltsamer Zufall, dass die Glocke haarklein der aus dem Film entspricht. Der Produktionsdesigner wird natürlich behaupten, dass er sich das ausgedacht hat. Aber wenn man ihm beweisen könnte, dass es vielleicht noch so eine Glocke gibt, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, ihn dahin zu bringen, dass er einräumt, eine andere Glocke als Vorbild genutzt zu haben. Ich geb‘s dem Chef weiter und rege an, dass wir ein Sachverständigengutachten durch einen Archäologen beantragen. Aber vorher rede ich mal mit deiner Rechtsschutzversicherung, ob die dafür geradestehen“, erwiderte Leon. „Das Beste wäre, wenn das Hamburg-Museum dazu was sagen könnte, ob es diese Glocke da wirklich gegeben hat oder ob deinem Opa da die Pferde durchgegangen sind.“
„Ich sehe zu, dass ich in dieser Woche noch ins Museum komme“, erwiderte Jonas.
Zwei Tage später fuhr er nach Feierabend zum Hamburg-Museum am Gorch-Fock-Wall. Er stellte schnell fest, dass eine Glocke, deren einziger Bezugspunkt zu Hamburg war, auf hamburgischem Gebiet gefunden worden zu sein, in keine der Dauerausstellungen gepasst hätte, die es in diesem Museum gibt. Von den Sammlungen wären wohl Bauschmuck und Bauteile, Kunsthandwerk sowie Schifffahrt und Verkehr in Betracht gekommen. Er wandte sich schließlich an einen Museumsmitarbeiter:
„Ich hab‘ da mal ’ne Frage …“
„Ja?“
„Ein Fundstück, das auf hamburgischem Gebiet – zum Beispiel vor der Insel Neuwerk – entdeckt würde, das als Fracht eines Schiffes, von dem man annehmen könnte, dass es Hamburg zum Ziel hatte, identifiziert werden könnte – wo würde das im Museum für Hamburgische Geschichte landen?“
„Was für eine Fracht wäre das gewesen – zum Beispiel?“, fragte der Mitarbeiter.
„Eine Glocke zum Beispiel. Richtig antik, schätzungsweise dreieinhalbtausend Jahre alt und möglicherweise aus dem kleinasiatischen Raum“, antwortete Jonas.
„Ehrlich gesagt, wüsste ich nicht, dass wir hier so was haben …“, erwiderte der Museumsangestellte.
„Falls so was da wäre, wo würde man es unterbringen? Bauteile und –schmuck, weil es vielleicht eine Kirchenglocke sein könnte? Kunsthandwerk, weil es ein toller Bronzeguss ist? Schifffahrt und Hafen, weil es aus der Elbmündung geborgen wurde?“, hakte Jonas nach.
„Hm … Abteilung Bauteile und Bauschmuck betrifft nur solche Bauteile, die auch an oder in Hamburger Häusern waren. Kunsthandwerk bezieht sich auf solches, das in Hamburg hergestellt worden wäre. Schifffahrt und Hafen vielleicht noch am ehesten, wenn es mal Schiffsladung gewesen wäre. Aber … wie gesagt … so etwas ist derzeit nicht in unserem Haus.“
„Wenn es mal in Ihrem Haus gewesen wäre – vor 1945 – wie könnte man es finden, auch wenn es – zum Bespiel auf Befehl der Nazis – aus dem Museum entfernt wurde?“
„Gott, Sie können Fragen stellen …! Ich denke, da müssten wir eine Registriernummer haben, um das nachvollziehen zu können. Haben Sie so etwas?“
„Nein, leider nicht. Nur die Aussage meines Großvaters, dass eine antike Glocke so um 1930 bei Baggerarbeiten vor Neuwerk gefunden wurde und hier im Museum bis etwa 1943 ausgestellt gewesen sein soll. Mein Urgroßvater soll sie hier auch fotografiert haben, aber die Fotos existieren wohl nicht mehr“, erwiderte Jonas.
„Sorry, das würden wir so nicht mehr finden. Aber eine Möglichkeit gäbe es vielleicht noch. So ein Fund würde bestimmt durch die Presse geistern. Wenn es das gegeben hat, könnte Ihnen die Staatsbibliothek Hamburg vielleicht helfen. Die haben sämtliche seit 1696 in Hamburg erschienen Druckerzeugnisse als Pflichtexemplare archiviert“, erwiderte der Museumsangestellte.
„Vielen Dank für den Tipp. Dann werde ich mich mal in der Stabi umsehen“, erwiderte Jonas, dem allerdings auch gleich schwante, dass das eine Menge Zeit kosten würde.
„Probieren Sie’s mal im Internet. Die vorhandenen Zeitungsbestände sind digitalisiert“, gab der Museumsmitarbeiter noch einen ergänzenden Hinweis.
„Noch besser. Vielen Dank“, erwiderte Jonas, wohl wissend, dass auch das nicht ohne Zeitverlust abgehen würde.
Wieder zu Hause begann Jonas zu forschen. Die Staatsbibliothek Hamburg erklärte auf der Seite „Pflichtexemplare von Hamburger Publikationen“, dass im Juli 1943 infolge der Bombardierung der Bibliothek der größte Teil des Pflichtexemplarbestandes vernichtet worden sei, dass aber nach dem Krieg in „vielen Fällen“ Ersatz beschafft werden konnte. Die nächsten Tage war er jeden Abend nach Feierabend mehrere Stunden beschäftigt, die alten Zeitungen durchzugehen. Die Staatsbibliothek Hamburg leitete weiter zur European Library.
Nach einer ganzen Woche hatte er die Publikationen durch, was auch an oftmals elend langen Ladezeiten der viel frequentierten European Library lag. Er hatte keinen Artikel zu einer antiken Glocke gefunden, weder im Hamburger Anzeiger, noch in den Hamburger Nachrichten, dem Hamburger Correspondent, Hamburger Neueste Zeitung oder der Neuen Hamburger Zeitung. Allerdings war keine der Zeitungen des Jahrgangs 1928 wirklich vollständig, auch wenn es 1.761 Seiten waren, die er nach Eingabe von „Hamburger + 1928“ erhielt. Die elektronische Bibliothek listete nämlich nicht nur Ergebnisse aus dem Jahr 1928 auf, sondern auch aus späteren Jahren.
„Also“, sagte er, als er am Morgen nach dem letzten Forschungsabend Ralf Schmidt anrief, „nix. Im Museum können sie es nicht ohne eine Registriernummer nachvollziehen, ob dort tatsächlich jemals eine kleinasiatische Glocke aus der Bronzezeit gewesen ist. Ich habe die Hamburger Zeitungen bei den Pflichtexemplaren bis zum letzten vorhandenen Buchstaben durchforstet. Nichts. Aber die Bestände sind durch den Krieg ziemlich gerupft, also nicht vollständig. Ich wüsste nicht, wo ich jetzt noch suchen sollte.“
„Okay, wir haben es versucht. Die Rechtsschutz hat die Kostenübernahme für ein archäologisches Gutachten bestätigt. Vielleicht bringt uns das weiter. Ich mache die Klagerwiderung fertig.“
Kapitel 3
Ein Unglück kommt selten allein
Rechtsanwalt Ralf Schmidt schrieb dem Gericht:
***
Klagerwiderung
In der Sache
Agamemnon Pictures Ltd.
Sunset Boulevard
Los Angeles/California
Vertreten durch
Agamemnon Pictures Deutschland
Herwardeshuder Weg 25
20149 Hamburg
(Klägerin)
Gegen
Jonas Mönke
Ebeersreye 110
22159 Hamburg
(Beklagter)
Erwidert der Beklagte auf die Klage vom 1. März 2013 wie folgt:
- A) Es ist unzutreffend, dass der Beklagte für die Titelillustration seines Romans „Die Glocke des Todes“ den Entwurf des bei der Klägerin angestellten Produktionsdesigners Marcus D. Brown verwendet hat, der für ein Requisit für den Film „Mykene“ gefertigt wurde, den die Klägerin produziert hat und der im Jahr 2004 veröffentlicht wurde. Es ist wohl zutreffend, dass der Entwurf des Produktionsdesigners Brown und die Titelillustration mit dem Titelbild des Buches nahezu identisch sind. Der Beklagte bestreitet jedoch, sich dieses Entwurfes bedient zu haben. Er hatte auch gar keinen Zugang zu den Entwürfen des Produktionsdesigners Marcus Brown, die allein von der Klägerin verwahrt werden. Die Klägerin mag darlegen, wie der Beklagte denn auf einen Entwurf hätte zugreifen sollen, der nicht veröffentlicht ist.
Der Beklagte hat vielmehr eine bereits vor dem Juni 1998 entstandene Tuschezeichnung seines Großvaters Hinnerk Trojan zu diesem Zweck digitalisiert und dem Felder-Verlag zur Verfügung gestellt.
Beweis: Signierte Tuschezeichnung des Hinnerk Trojan (als Kopie beigefügt). Original wird im Termin vorgelegt.
Beweis: Zeugnis des Hinnerk Trojan, geb. 29.03.1920, wohnhaft Seniorenwohnanlage Walddörfer, Berner Allee 3, 22159 Hamburg, rechtlich betreut durch Britta Mönke, Schierenberg 67, 22145 Hamburg.
Die Tuschezeichnung ist signiert, jedoch undatiert. Die Tuschezeichnung wurde jedoch vor dem Juni 1998 angefertigt, da der Zeuge Hinnerk Trojan seit eben Juni 1998 erblindet ist.
Beweis: Anliegendes ärztliches Attest des Augenarztes Dr. Thomas Milz, Alaskaweg 9, 22145 Hamburg
Die zweifellos erhebliche Ähnlichkeit der Zeichnung des Großvaters des Beklagten und des Entwurfs wirft für den Beklagten die Frage auf, ob es sich bei dem Entwurf des Produktionsdesigners Marcus Brown tatsächlich um dessen eigene Idee handelt oder ob er selbst eine tatsächlich existierende Bronzeglocke nachgestaltet hat, die er im Zuge seiner Recherchen möglicherweise in einem der einschlägigen Museen gesehen hat, die Artefakte der Bronzezeit ausstellen.
Der Zeuge Trojan hat die Zeichnung nach der Beschreibung seines Vaters gefertigt. Bei dem Vater des Zeugen handelt es sich um Professor Boris Trojan, der bis 1942 an der Universität Berlin ordentlicher Professor für Archäologie war. Er hatte auch die Möglichkeit, die Glocke persönlich in Augenschein zu nehmen. Der Zeuge hat die Glocke, die 1928 bei Baggerarbeiten in der Elbmündung vor der Insel Neuwerk gefunden wurde und bis 1943 im Museum für Hamburgische Geschichte ausgestellt gewesen ist, dortselbst gesehen, als sein Vater für eine Forschungsarbeit Fotos von der ausgestellten Glocke machte.
Beweis: Wie vor.
Ob die seinerzeit im Museum für Hamburgische Geschichte ausgestellte Glocke einzigartig war, ist unklar. Sie ist auch seit dem Krieg verschollen. Da die Glocke ein Bronzeguss war (wie es auch das für den Film „Mykene“ gestaltete Requisit ist), ist es deshalb denkbar, dass der angestellte Produktionsdesigner der Klägerin eine gleichartige Glocke in einem anderen Museum gesehen und sich daran orientiert hat. Wäre dies der Fall, wäre der Entwurf kein geschütztes Werk des angestellten Produktionsdesigners Brown im Sinne von § 2 Abs. 1 (7) und Abs. 2 UrhG, da hier bestimmt ist, dass es sich um persönliche geistige Schöpfungen handeln muss. Ein Entwurf, der lediglich ein bereits existierendes, wenn auch gemeinfreies Werk kopiert, ist keine eigene geistige Schöpfung.
Da zwei augenscheinlich nahezu identische Zeichnungen eines solchen Objektes existieren, von denen das ältere Werk eine Abzeichnung einer real existierenden Glocke war, erscheint es unwahrscheinlich, dass dies rein zufällig geschehen ist und der Produktionsdesigner Brown den Entwurf für das Filmrequisit ausschließlich selbst entworfen hat.
Der Beklagte beantragt deshalb ein archäologisches Gutachten, das klären soll, ob
- a) es historische Vorbilder zu der vom Produktionsdesigner Marcus D. Brown entworfenen Glocke gibt,
- b) es weitere solche real existierenden Glocken gibt,
- c) Übereinstimmungen der von Produktionsdesigner Brown entworfenen Glocke mit historischen Vorbildern vorhanden sind;
- d) die von Produktionsdesigner Brown entworfene Glocke als dessen alleinige Erfindung gelten kann, wenn es möglicherweise keine weiteren Glocken dieser Art gibt;
- e) die Glocke auf dem Bucheinband tatsächlich mit der als Requisit für den Film „Mykene“ entworfenen und tatsächlich hergestellten Glocke identisch ist
- f) sie zum kulturellen Raum passt, in dem der Film „Mykene“ spielt oder – falls nicht – welchem kulturellen Raum, ggf. welcher Zeit sie tatsächlich zuzuordnen ist.
- B) Die Klägerin verlangt vom Beklagten eine pauschale Lizenzgebühr von 10.000 (in Worten: zehntausend) Euro, sofern nicht mehr als zehntausend Exemplare pro Jahr verkauft werden und darüber hinaus je weiterem verkauften Buch eine Lizenzgebühr von 1 (einem) Euro.
Unabhängig von der Frage, ob der Klägerin überhaupt ein Anspruch auf Zahlung von Lizenzgebühren zusteht, ist diese Forderung als solche unverhältnismäßig. Der Beklagte hat für die Erstauflage ein Grundhonorar von 5.000 (in Worten fünftausend) Euro erhalten, für jedes darüber hinaus verkaufte Exemplar erhält er 0,50 Euro.
Beweis: Vertrag des Beklagten mit dem Felder-Verlag Hamburg
Diese Beträge sind von ihm selbst zu versteuern. Im Hinblick auf den Umstand, dass er ledig ist, ist er in die Steuerklasse I eingestuft. Er hat zu den Einkünften aus nichtselbstständiger Tätigkeit das Verlagshonorar hinzuzurechnen. Nach Steuern für das Jahr 2012 werden ihm von seinem Honorar von insgesamt 10.000 (in Worten: zehntausend) Euro gerade 6.000 (in Worten sechstausend) Euro verbleiben.
Beweis: Ermittlung des Steuerbüros Nelkenbaum, Böttgerstraße 4, 20148 Hamburg (Anlage)
Die Klägerin verlangt aber schon allein für die Erstauflage von zehntausend Exemplaren zehntausend Euro. Der Kläger würde schon für 2012 viertausend Euro mehr bezahlen, als ihm überhaupt an Honorar verbleiben wird. Er würde für seine Arbeit, die mit dem Film von Agamemnon Pictures nichts zu tun hat, schlichtweg bestraft, denn die Titelillustration ist nur ein unwesentlicher Teil seines Buches, das immerhin rund fünfhundert Seiten umfasst.
Nicht zu vergessen ist dabei, dass es sich um das Erstlingswerk des Beklagten handelt. Bei einer ersten Buchveröffentlichung hat der Schriftsteller noch keinen Namen, die Veröffentlichung ist für den Verlag mit noch nicht genau kalkulierbaren Risiken behaftet, die regelmäßig ein geringeres Honorar für den Autor nach sich ziehen. Dem Beklagten wäre deshalb nicht etwa vorzuwerfen, dass er mit geschickterer Verhandlung ein höheres Entgelt hätte erwirken können. Nachverhandlungen über ein höheres Honorar kann der Beklagte erst zum Ablauf des aktuellen Vertrages führen, der noch bis 2016 läuft. Die Klägerin will sich hier einfach auf Kosten des Beklagten bereichern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Beklagte sich bei der Titelillustration seines Buches nicht des Entwurfes von Marcus D. Brown bedient hat, den er mangels Zugang zu den Archiven der Klägerin gar nicht kennen konnte, sondern eine bereits seit mindestens 1998 im Familienbesitz des Beklagten befindliche Tuschezeichnung seines Großvaters Hinnerk Trojan dafür nutzte, die er digitalisierte. Ob er dessen Einverständnis hatte, ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Ferner ist die Forderung der Klägerin bezüglich der geltend gemachten Lizenzgebühren unverhältnismäßig und würde zu ungerechtfertigter Bereicherung der Klägerin führen, da die Titelillustration nur ein unwesentlicher Teil der Arbeit ist, für die der Beklagte Honorar erhalten hat.
Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen und der Klägerin die insoweit entstandenen Kosten der Rechtsverfolgung aufzuerlegen.
Gez.
Ralf Schmidt, Rechtsanwalt
Anlagen:
2 Ausfertigungen der Klageerwiderung für die Klägerin und das Gericht
Vollmacht
Kopie der Tuschezeichnung des Hinnerk Trojan (2x)
Ärztliches Attest Dr. Milz (2x)
Kopie des Vertrages des Beklagten mit dem Felder-Verlag Hamburg (2x)
Ermittlung des Steuerbüros Nelkenbaum bezüglich der zu entrichtenden Steuern des Beklagten (2x)
***
Das Landgericht Hamburg versandte Anfang April 2013 erwartungsgemäß eine Ladung an den Zeugen Hinnerk Trojan über dessen rechtliche Betreuerin Britta Mönke und veranlasste auch ein archäologisches Gutachten, mit dem der an der Universität Hamburg lehrende Archäologieprofessor Roland Bluhm beauftragt wurde.
Der Brief, den Professor Roland Bluhm auf seinem Schreibtisch in der Universität Hamburg fand, gehörte zu den eher seltenen in seinem Beruf als Professor der Archäologie: Das Landgericht Hamburg bestellte ihn zum Gutachter in einem Urheberrechtsprozess. Das Gutachten sollte er bis spätestens zwei Wochen vor dem Termin einreichen, also bis zum 23. April 2013.
Als er Zeichnung sah, die das Gericht der Bestellung und dem Auftrag beigefügt hatte, erinnerte er sich an einen Film, den er Jahre zuvor gesehen hatte: Mykene, ein Film von Peter Wolfson, einem der wenigen Deutschen, die in den USA Karriere gemacht hatten. Er erinnerte sich auch, dass er die Kulissen schon damals als passabel recherchiert betrachtet hatte – aber nicht ganz als zum griechischen Kulturraum der Bronzezeit passend erachtet hatte. Er hätte die Glocke, an die er sich dunkel erinnerte, eher in den ostasiatischen Raum verwiesen. Damals hatte er sich keine Gedanken dazu gemacht. Wolfsons Film war ein Unterhaltungsfilm, keine historische Dokumentation … Erst ein paar Tage zuvor hatte er in einer Buchhandlung auf dem Cover eines Taschenbuchs eine Glocke gesehen, die ihn an die aus Mykene erinnert hatte. Der Autor war ein Jonas Mönke – und das Buch „Die Glocke des Todes“ war dessen Erstling.
Und jetzt stritt sich die Filmfirma Agamemnon Productions mit eben diesem Jonas Mönke um die Rechte an der Glocke.
„Die spinnen, die Griechen!“, kommentierte er die Ladung.
Professor Bluhm schrieb eine E-Mail an die deutsche Vertretung der Produktionsfirma und bat um Übersendung einer möglichst hochaufgelösten Datei mit dem Entwurf des Requisits. Jonas‘ Telefonnummer bekam er vom Gericht. Er rief bei ihm an, bat um Sendung der Covergrafik in möglichst hoher Auflösung, die Jonas auch zusagte und am selben Abend per E-Mail übersandte. Von Agamemnon Productions erhielt Bluhm die Antwort, dass Entwürfe von Requisiten keinesfalls in andere Hände als die des mit der Herstellung von Requisiten beauftragten Unternehmens gegeben würden. Der Mail war eine .jpg-Datei eines Fotos beigefügt, das die fragliche Glocke unter Glas in einem Ausstellungsraum zeigte.
Bluhm studierte die Bilder, die ihm nun zur Verfügung standen. Die Glocken auf den Bildern glichen sich stark. Allerdings war die .jpg-Datei nicht detailreich genug, um wirklich die letzten Einzelheiten der bildlichen Darstellungen sehen zu können. Zudem verzerrte das Glas des Ausstellungskastens die Ränder der Glocke zusätzlich, während die Coverzeichnung des Buches diese Randverzerrung nicht hatte. Dennoch war für ihn offensichtlich, dass die Zeichnung auf dem Umschlag des Buches mit dem Film-Requisit praktisch identisch war – mit einer kleinen Ausnahme: Auf der Glocke und der Cover-Zeichnung war am unteren Rand an der rechten Seite der Glocke eine Art Markierung zu erkennen. Bluhm nahm eine Lupe zur Hand und konnte die Markierung auf dem Foto immer noch nicht genau erkennen. Die Computergrafik und die Tuschezeichnung ließen zu seiner Überraschung erkennen, dass es sich um Keilschriftzeichen handelte, die dem hethitischen Raum zuzuordnen waren. Die Schriftzeichen auf der Coverzeichnung ergaben sogar Sinn: Danach war die Glocke ein Geschenk des hethitischen Königs an den König von Taruiša. Taruiša galt als hethitische Bezeichnung für Troja.
Er schrieb erneut an Agamemnon Productions Deutschland und bat darum, das Foto als wirklich hochauflösende .bmp-Bilddatei per E-Mail geschickt zu bekommen.
Am folgenden Tag hatte er das Foto als .bmp-Datei mit hoher Auflösung. Er vergrößerte den entsprechenden Ausschnitt und wunderte sich nicht schlecht, dass die Schriftzeichen nicht identisch abgebildet waren. Die Keilschriftzeichen auf dem Foto sahen denen der Zeichnung zwar halbwegs ähnlich, ergaben aber keinen erkennbaren Sinn, weil durch die Randverzerrung am unteren Rand Keile fehlten, womit der Sinn der Zeichen verändert wurde.
‚Wie kommen Keilschriftzeichen auf eine Glocke, die für einen Film hergestellt wird, der im antiken Griechenland spielen soll? Und wieso sind sie nicht identisch, wenn die Coverzeichnung das Produkt einer möglichen Urheberrechtsverletzung sein soll? Hat Mönke die Glocke im Original ohne den Kasten gesehen und die Schriftzeichen ergänzt?
Nach zwei Wochen hatte er seine Recherchen erledigt. Die Glocken der Zeichnung und des Fotos entsprachen weder den bekannten Artefakten der Bronzezeit noch war ein solches Exemplar aus Griechenland oder anderen Anrainern des Mittelmeeres bekannt. Auf dem digitalen Foto hatte er im Hintergrund einen Mann erkennen können. Die Glocke war mindestens so hoch wie der Mann im Hintergrund. Die schiere Größe der Glocke ließ ihn eher an buddhistische Glocken aus dem China des 15. Jahrhunderts denken. Die Keilschriftzeichen am unteren Rand der Glocke waren in keiner Weise mit dem griechischen Kulturraum in Verbindung zu bringen, sahen sich aber etwas ähnlich, so dass die Möglichkeit bestand, dass der Zeichner die Glocke ohne den Glaskasten gesehen hatte und die Zeichen ergänzt hatte. Das würde dann auch die unverzerrten Ränder der Glocke auf der Zeichnung erklären.
Bluhm schrieb sein Gutachten mit dem unguten Gefühl, dass der junge Schriftsteller mit einiger Sicherheit würde bluten müssen.
Unabhängig vom Gutachtenauftrag bat er seine Studenten, die ausgestellte Glocke abzuzeichnen. Das Ergebnis ließ ihn stutzen. Irgendetwas stimmte hier nicht. Er beschloss, dies aber erst im Termin ins Gutachten einzuflechten.
Als Jonas am 30. April 2013 vom Gericht das Gutachten bekam, wurde er blass. Die Glocke würde verdammt teuer werden. In dem Moment war er versucht, seine Eltern dazu zu bringen, die Wohnung in der Ebeersreye, die er ja irgendwann ohnehin erben würde, schon jetzt auf ihn zu überschreiben, damit er einen Kredit aufnehmen konnte, um die gar zu wahrscheinlich gewordenen Lizenzgebühren und die Kosten des Prozesses bezahlen zu können.
Er rief dennoch zuerst Ralf Schmidt an.
„Moin, Herr Schmidt“, sagte er, als er durchgestellt wurde. „Das Gutachten sieht schlecht für mich aus.“
„Sehen wir mal. Im Grunde ergibt sich ja nur, dass die Glocke nicht zur griechischen Bronzezeitkultur passt. Die Glocken mögen identisch sein, aber es bleibt fraglich, woher Brown so ganz zufällig eine Glocke zeichnet, die haargenau der entspricht, die Ihr Großvater schon lange vorher dargestellt hat. Ihr Großvater wird aussagen. Vielleicht kriegen wir sie wirklich bei der Büx, woher Brown die Vorlage gehabt hat. Machen Sie sich jetzt keine Sorgen“, beruhigte der Anwalt seinen Mandanten.
Doch es sollte noch schlimmer kommen. Jonas hatte kaum aufgelegt, als das Telefon wieder klingelte.
„Sperling-Assekuranz, Kraftfahrt Schaden, Mönke, guten Tag“, meldete er sich.
„Hallo, Jonas“, hörte er am anderen Ende seine Mutter. „Opa geht es schlecht. Ich bin mir nicht sicher, ob er zum Termin kommen kann. Ich glaube, seine Aussage sollte vorsorglich protokolliert werden – und zwar hier im Altenheim.“
„Oh, ver …!“, fluchte Jonas unterdrückt. „Ich ruf‘ gleich mal Leon an. Sein Chef ist ja auch Notar. Ich meld‘ mich wieder.“
Hörer hinlegen, Hörer hochnehmen und die Nummer von Ralf Schmidt wählen, war eine fließende Bewegung.
„Hi, Leon. Kommt noch dicker: Opa ist krank und kann vielleicht nicht zum Termin kommen. Dein Chef ist doch Notar, kann der seine Aussage protokollieren?“, fragte er den Anwaltsgehilfen.
„Im Prinzip ja, aber die Sache hat den Haken, dass unsere Kanzlei nicht in Hamburg ist. Er kann dich zwar anwaltlich vertreten, aber ein Notar muss immer aus demselben Bundesland sein, in dem das, was zu beurkunden ist, auch stattfindet. Und Rechtsanwälte und Notare sind in Hamburg zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Bei euch dürfte er nur eins von beiden sein. Nee, da muss ein Hamburger Notar ran. Sein ehemaliger Sozius Heiner Kiwus hat sein Notariat am Neuen Wall. Wende dich an ihn, der müsste das noch hinkriegen. Bestell‘ ihm einen schönen Gruß vom Chef.“
Er gab Jonas die Telefonnummer, die der auch gleich wählte. Notar Kiwus hatte allerdings mehr als genug zu tun und sah sich nicht in der Lage, mal eben zwischendurch eine Zeugenaussage notariell zu beurkunden, noch dazu bei einem kranken alten Herrn, der im Pflegeheim war. Er konnte aber seinen Sozius Dieter Langermann vermitteln, der am Freitag, den 3. Mai, vormittags um elf Uhr im Pflegeheim Walddörfer sein wollte, um zusammen mit Jonas und Britta Mönke die Aussage von Hinnerk Trojan aufzunehmen und zu protokollieren.
Am folgenden Tag fuhr Jonas nur ungern zu seinen Eltern zum feiertäglichen Mittagessen. Dass er mit seiner Ahnung Recht gehabt hatte, bewies ihm die missmutige Miene seines Vaters, als er in die Wohnung kam.
„Moin! Bist du nun zufrieden? Opa geht es schlecht – deinetwegen, du Dummbeutel!“, fuhr Bernd ihn an. Jonas sah ihn an. Er wirkte bleich und verstört.
„Danke, Paps!“ knurrte er. „Danke für deine aufbauenden Worte. Weißt du was? Ich hab‘ genug Probleme im Moment. Ich muss mir nicht auch noch einen freien Tag damit versauen lassen, dass ich noch mehr ungerechtfertigte Vorwürfe um die Ohren gehauen bekomme. Tschüß!“
Damit wandte er sich ab und verließ eilig das Haus.
„Jonas!“, rief sein Vater hinterher, aber die Tür fiel ins Schloss, ohne dass Jonas zurückkam.
„Gratuliere. So schnell hattest du ihn noch nie aus dem Haus!“, versetzte Britta. „Du stichelst nicht nur an seinem Hobby herum, nein, wenn er wirklich Hilfe braucht, stößt du ihn vor den Kopf und willst ihm die Verantwortung dafür zuschieben, dass es meinem Vater schlecht geht.“
„Wenn der dumme Bengel ihn in so eine fiese Sache reinzieht, dann regt mich das auf!“, grollte Bernd zurück. „So ‘ne Aufregung kann man so einem alten Herrn nicht zumuten!“
„Ach, Quatsch!“, widersprach Britta. „Soll ich dir was sagen? Mein Vater wäre schon längst unter der Erde, wenn Jonas nicht mit dem Schreiben angefangen hätte und die Geschichten, die Papa ihm erzählt hat, aufgeschrieben hätte; wenn er nicht einen Verlag gefunden hätte, der doch tatsächlich Geld dafür bezahlt, dass Jonas das Buch dort verlegen lässt. Hast du eifriger Spiegelleser eigentlich mal die Hitliste der Bücher in letzter Zeit gesehen? Nein, klar, sonst wüsstest du, dass Jonas‘ Buch aktuell in den Top 20 ist! Aber das ist ja nur Spinnkram, völlig bedeutungslos und irrelevant, denn es zählt nur die ungeschminkte Wahrheit in Form von Zeitungsartikeln! Du lässt keinen Tag vergehen, an dem du ihn nicht einen legal herumlaufenden Banditen nennst, weil er bei einer Versicherung arbeitet. Bernd, unser Sohn ist auch nur ein Mensch! Er hat Nerven – und die werden momentan mehr als nur strapaziert, weil ihm ein Filmkonzern wegen einer Zeichnung, die er angeblich geklaut haben soll, den Prozess macht! Du forschst bei jedem noch so kleinen Fehler eines Lokalpolitikers solange, bis du ihn lang machen kannst. Kannst du das auch mal für deinen Sohn tun? Kannst du ihm einmal die Hilfe sein, die ein Sohn von seinem Vater erwarten kann? Nein, du blaffst ihn an, da hat er noch nicht mal die Türschwelle übertreten! Und das auch noch ohne jeden Grund! Frag‘ dich bitte mal, wie Jonas eigentlich an einen Entwurf für ein Filmrequisit gekommen sein könnte, das im ganzen Film zehn Sekunden zu sehen ist? Bernd, das ist vollkommener Humbug! Wenn du schon auf deine Fahne geschrieben hast, die ganze bittere Wahrheit herauszufinden, mein lieber Investigativjournalist, dann bohr‘ doch mal bei dem Filmkonzern, woher die eigentlich diese Glocke haben. Die müssen doch ’ne Leiche im Keller haben! Es kann doch kein Zufall sein, dass dieser Produktionsdesigner ausgerechnet eine Glocke entworfen haben will, die der aufs Haar gleicht, von der Papa schon vor Jahrzehnten gesprochen hat!“
„Soll ich ihn zurückholen?“, fragte Bernd, über den heftigen Ausbruch seiner Frau doch recht erschrocken.
„Nein, den wirst du erst einmal nicht wiedersehen. Wenn du das geradebiegen willst, rate ich dir, dich mal für unseren Sohn zu engagieren, statt ständig auf ihm rumzuhacken“, erwiderte Britta. „Vielleicht kannst du deine intensiven Internetrecherchen mal dazu nutzen, um zu prüfen, ob diese Entwürfe überhaupt öffentlich zugänglich sind.“
Jonas fuhr mit Tränen in den Augen zurück nach Farmsen. Seit er nach dem Praktikum bei der Redaktion seines Vaters erklärt hatte, lieber Zitronen am Nordpol züchten zu wollen, als Journalist in der Redaktion zu werden, in der auch Bernd Mönke tätig war, stand er mit seinem Vater auf Kriegsfuß. Seither war er Blitzableiter für alle Widrigkeiten, die einem Zeitungsschreiber so über den Weg laufen können. Ob es sein Bürojob als solcher war oder die Tatsache, dass er in einer Branche arbeitete, die für den Normalbürger eher etwas undurchsichtig war, weil dort mit Geschäftsbedingungen gearbeitet wurde, die für einen Durchschnittsdeutschen nur schwer verständlich waren. Jonas hatte den Beruf gelernt, sah sich als jemand, der half, denn Versicherungen sind dazu da, die Folgen von bestimmten Unglücksfällen zu beseitigen oder doch wenigstens zu mindern. Er hatte auch Kollegen, die so taten, als wäre jeder, der einen Schaden meldete, die Ausgeburt der Hölle, mindestens aber ein berufsmäßiger Betrüger. Die gab es auch – und die Versuche, sich auf Kosten einer Versicherung zu bereichern, stiegen immer noch – aber Jonas gehörte nicht zu den Sachbearbeitern, die hinter jedem Busch einen Banditen vermuteten. Es gab gewisse Kriterien, die einen Betrugsversuch nahelegten. Sie bei der Prüfung einer Schadenanzeige anzuwenden war eine Notwendigkeit. Aber bei ungefähr tausend Schäden, die Sachbearbeiter wie Jonas im Jahr zu bearbeiten hatten, kamen vielleicht fünfzig zusammen, bei denen sich Betrugsabsicht konkretisierte. Für seinen Vater waren Versicherer aber Geldgeier, die munter kassierten, sich aber mit aller Vehemenz sträubten, wenn es ans Bezahlen ging. Es war – wie Jonas nur zu gut wusste – eine ebenso von Vorurteilen zugestellte Sicht wie die seiner Kollegen, die in jedem Versicherungsnehmer oder Anspruchsteller nur Betrüger sahen.
Der Beruf war mit Stress verbunden, besonders da, wo es um Schäden an Autos ging, denn der deutsche Michel ist und bleibt ein Autonarr, der sein liebstes Spielzeug nicht gern im kaputten Zustand sieht, dem eine Schadenregulierung nie schnell genug geht. Der zusätzliche Stress durch den Prozess, dem Jonas sich schuldlos ausgesetzt sah, hatte sein berufsbedingt strapaziertes Nervenkostüm noch dünner geschliffen. Dabei hatte er mit dem Schreiben angefangen, um einen Ausgleich zu den immer aggressiver reagierenden Kunden und Geschädigten zu haben.
Er war fertig mit der Welt und wusste im Moment nicht, was er tun sollte. Jetzt allein zu sein, hätte ihn in tiefster Grübelei versinken lassen. Mit anderen den 1. Mai zu feiern, dazu fehlte ihm komplett die Lust. Er wollte seinen kranken Großvater nicht auch noch mit seinen persönlichen Problemen belasten, also fuhr er an der Abzweigung der Berner Allee vorbei, den Berner Heerweg weiter nach Farmsen zu seiner Wohnung. Dort angekommen, warf er sich eilig seine Sportsachen an und lief die Treppe hinunter, hinaus aus dem Haus und über die Straße zum Kupferteich, um ein paar Runden um den kleinen See zu laufen, in der Hoffnung, den Kopf wieder halbwegs frei zu bekommen und die Sticheleien seines Vaters verdauen zu können.
Am folgenden Morgen saß er wieder früh um sieben in seinem Büro am Kapstadtring. Als er sich seinen Kaffee machte, kam kurz nach ihm seine Kollegin Marina Bergmann, setzte ebenfalls ihren Kaffee in die Spur und stellte schon mal den Anrufbeantworter an, um nötige Rückrufe zu notieren. Plötzlich brach sie in helles Gelächter aus.
„Was ist?“ fragte Jonas und sah um die Ecke der Pantry zum Arbeitsplatz seiner Kollegin im Großraumbüro.
„Das musst du dir anhören! Die Schwachmaten werden doch echt nicht alle!“
Jonas ging zu ihr, sie spulte die Aufnahme zurück. Ein Anrufer hatte am Vortag – am 1. Mai, einem bundesweiten gesetzlichen Feiertag – wenigstens viermal angerufen und um umgehenden Rückruf gebeten. Mit jedem Anruf war er galliger geworden, bis er schließlich mit einer Vorstandsbeschwerde drohte, wenn nicht innerhalb von nun fünf Minuten der Rückruf erfolgte. Jonas und Marina bogen sich vor Lachen. Manche Leute hatten wirklich keinen blassen Schimmer, was sich in der Welt außerhalb ihrer vier Wände tat.
„Ich geb‘ das Gunnar. Das ist das gefundene Fressen für ihn!“, jubelte Marina und schrieb eine Notiz an Gunnar Mahnke, den Abteilungsleiter. Mahnke war ein Bär von einem Mann, der seine Mitarbeiter sehr schätzte, aber wenig von dem zu sehen bekam, was sie machten, weil er meinte, dass die schon wussten, was sie taten. Außer bei Prozessen, deren Beauftragungsschreiben er mitunterzeichnen musste, bekam er Akten nur dann zu sehen, wenn etwas schiefgelaufen war.
Drei Stunden später dröhnte die weittragende Stimme von Abteilungsleiter Mahnke aus dessen Zimmer bis in die letzte Ecke des Großraumbüros der Sachbearbeiter, die die einfachen Schäden bearbeiteten, als er den grantigen Anrufer sehr deutlich darauf hinwies, dass seine Mitarbeiter an einem gesetzlichen Feiertag nicht arbeiten würden, weil sie eben nicht bei der Polizei, der Feuerwehr, in einem Krankenhaus, der Bahn oder bei Rundfunk und Fernsehen arbeiteten. Als der Anrufer dann auch noch den Fehler machte, anzumerken, dass er für sein Geld arbeiten würde, während Versicherungsfuzzis Gehalt bekämen, schien die Tür aus der Füllung zu fliegen, als Gunnar Mahnke diesen Typen richtig rund machte und für diese Entgleisung eine ausdrückliche Entschuldigung verlangte. Nachdem er diese Entschuldigung bekommen hatte, stellte er den Anrufer an Jonas weiter.
„Für dich, Jonas. Der ist jetzt so klein, der spaziert samt Hut unter’m Teppich ohne Beulen zu hinterlassen!“, sagte er.
„Danke, Chefchen“, erwiderte Jonas und nahm den nun zahmen Anspruchsteller entgegen. Der junge Sachbearbeiter konnte dem Mann auch noch helfen, indem er ihm mitteilte, dass sein Schaden am 30. April bezahlt worden sei.
Der Tag, der so gut angefangen hatte, ging allerdings nicht so schön weiter. Eine halbe Stunde später rief seine Mutter an und musste ihm mitteilen, dass sein Großvater in der Nacht zuvor gestorben war. Jonas war wie vom Donner gerührt. Nicht nur, dass der Einzige, der wirklich hatte bezeugen können, dass die Zeichnung, die Jonas digitalisiert hatte, sein eigenes Werk war, nicht mehr war; für Jonas war der Tod seines Großvaters auch menschlich eine richtige Katastrophe, weil sein Opa ihm näher gestanden hatte als sein eigener Vater.
Jonas‘ haltloses Schluchzen nach dieser Nachricht alarmierte nicht nur seine Kollegin Marina, sondern auch andere Kollegen einschließlich seines Chefs.
„Was is‘ los?“, fragte Mahnke, als er um die Ecke kam.
„Jonas‘ Opa ist heute Nacht gestorben. Er war ihm mehr Vater als sein Vater“, sagte Marina, die Jonas tröstend im Arm hielt.
„Willst du nach Hause fahren?“, fragte Gunnar Mahnke. Jonas schüttelte heulend den Kopf und nickte gleichzeitig. Sein Chef nickte.
„Neben der Spur!“, sagte er. „Wohnt Matthias nicht in deiner Nähe?“
Wieder ein schluchzendes Nicken.
„Matthias, fahr‘ den Jungen nach Hause!“, wies Mahnke einen älteren Kollegen an, der in Volksdorf wohnte.
Kapitel 4
Auf in den Kampf
Matthias Brückner war – abgesehen von der Tatsache, dass er Volljurist war – auch der Ausbildungsbeauftragte der Abteilung und hatte Jonas zu dem Versicherungskaufmann ausgebildet, der er war. Er hatte an dessen gutem Abschluss einen gehörigen Anteil. Obwohl er gute zwanzig Jahre älter als Jonas war, war er mit dem jungen Mann befreundet, was wohl auch daran lag, dass Jonas und sein eigener Sohn Max Schulkameraden gewesen waren.
Jonas, der über sein Hobby nicht gern sprach, weil sein Vater darüber nur spottete, schüttete dem vertrauten Kollegen sein Herz aus. Matthias hatte schon früh gemerkt, dass Jonas gut formulieren konnte und einen großen Wortschatz hatte. Bei jungen Leuten seiner Generation war das nicht zwangsläufig der Fall.
„Sag mal, Max hat mir von deinem Großvater mal erzählt. War der nicht so ein genialer Geschichtenerzähler?“, fragte Matthias auf der Fahrt.
„Ja, das war er. Er hat mir die Geschichte von Vineta erzählt und auch die Zeichnung geliefert, die ich dann für das Cover verwendet habe – und nun hat mich eine Filmgesellschaft wegen angeblicher Urheberrechtsverletzung verklagt. In vier Tagen ist Termin. Opa hätte aussagen sollen – und nun kann er das nicht mehr. Aber das ist nicht der Grund, dass ich völlig fertig bin. Opa war schon im Kindergarten meine eigentliche Bezugsperson. Er war immer für mich da. Klar, er war dreiundneunzig, er war blind, aber immer noch klar im Kopf und mein bester Freund. Und ich habe mich nicht mal von ihm verabschieden können, weil ich ihn gestern nicht mit meinen Problemen belämmern wollte. Das tut mir so Leid, Matthias!“
„Nein, gräm‘ dich nicht. Auch wenn es ihm schlecht ging, war es für dich nicht abzusehen, dass er es nicht mehr zum Prozess schaffen würde. Max könnte dir vielleicht helfen. Er könnte bestimmt etwas zu dem aussagen, was dein Opa in der Schule mit euch gemacht hat. Soll ich ihn fragen?“, bot Brückner an.
„Ja, das wäre gut“, sagte Jonas, der sich langsam beruhigte. „Ich werde aber mal den Schmidt anrufen und fragen, ob der Termin wegen des Trauerfalls verschoben werden kann.“
„Vergiss es. Dein Opa wird als Zeuge gestrichen, das wird alles sein“, erwiderte Matthias. „Rede mit Max. Die Angelegenheit wird wohl kaum in einem Termin abzuhaken sein. Dann kann Max noch als Zeuge nachbenannt werden.“
Brückner brachte Jonas in die Wohnung seiner Eltern am Schierenberg. Seine Mutter war noch verweinter als Jonas. Auch sein Vater wirkte regelrecht geschockt, hatte er seinen Schwiegervater doch sehr geschätzt.
„Es tut mir so Leid für dich, Jonas“, sagte er und nahm seinen Sohn in den Arm. Der sah ihn verwirrt an.
„Was? Sonst pflaumst du mich regelmäßig an!“, wunderte er sich.
„Ja, das stimmt“, räumte Bernd Mönke schuldbewusst ein. „Und auch das tut mir Leid. Mutti hat mich gestern richtig zusammengefaltet und mich dazu verdonnert, für dich zu recherchieren. Und sie hat gut daran getan. Wenn wir beim Bestatter waren, werde ich dir das zeigen. Komm.“
Am späten Nachmittag waren die Mönkes vom Bestattungsunternehmen wieder zurück. Jonas rief trotz des Hinweises seines Kollegen beim Anwalt an, um nach einer möglichen Terminverschiebung zu fragen.
„Oh, meine Güte! Mein Beileid, Herr Mönke. Ich weiß von Herrn Hameister, wie sehr Sie Ihren alten Herrn gemocht haben. Das ist – trotz seines hohen Alters – fürchterlich“, sagte der Anwalt mitfühlend. „Ich versuche es, und frage bei Gericht nach, ob eine Terminverschiebung möglich ist, auch wenn ich es nicht wirklich annehme.“
Nicht lange danach rief Ralf zurück und musste mitteilen, dass eine Verschiebung des Termins nicht in Betracht kam, weil der Zeuge der Klägerseite aus den USA anreisen musste, wegen des Termins andere Termine verschoben hatte und eine nochmalige Verschiebung zu Vertragsstrafen geführt hätte. Mit hängenden Schultern schlich Jonas ins Wohnzimmer und ließ sich in den Sessel fallen.
„Nix. Der Termin wird stattfinden“, seufzte er. „Was wolltest du mir zeigen, Paps?“, fragte er dann. Sein Vater winkte ihn an den Computer in seinem Arbeitszimmer.
„Ich habe mal geforscht, wie zugänglich die Entwürfe von dem Brown sind. Gibt ja einige Produktionsdesigner, die ihre Portfolios im Internet veröffentlichen. Brown gehört nicht dazu. Auch die Filmgesellschaft weist auf ihrem Internetauftritt ausdrücklich darauf hin, dass Entwürfe zu den Produktionen nicht veröffentlicht werden, sondern ihre Ausstattungen außerhalb der Filme nur in kommerziellen Ausstellungen gezeigt werden – und zwar nur unter Sicherheitsglas. Da habe ich dann auch ein Foto von der Glocke gefunden. Sieh mal:“
Bernd Mönke präsentierte das von der Internetseite der Agamemnon Productions kopierte Bild.
„Was fällt dir auf?“, fragte er, vergrößerte das Foto und legte die digitalisierte Zeichnung von Jonas daneben. Jonas sah die Bilder an, aber er kam nicht darauf, worin der gravierende Unterschied bestand.
„Versteh‘ nich‘“, sagte er.
„Sieh dir die Ränder mal genau an“, sagte sein Vater.
„Die sind ‘n büschen verzerrt“, erkannte er schließlich.
„Guuut!“, lobte Bernd. „Stell‘ dir vor, du solltest dieses Foto in eine Zeichnung umsetzen. Du würdest sie doch genauso abzeichnen, wie sie hier zu sehen ist, oder?“
Bei Jonas fiel der Groschen zwar in Scheinen, aber er begriff langsam.
„Du meinst … ich würde die Verzerrung … in die Zeichnung übernehmen?“
„Pling! Groschen gefallen!“, lachte sein Vater. „Genau das! Die fehlen aber auf deiner Zeichnung. Du hast Opas Zeichnung exakt kopiert. Opa hat sie entweder nach Uropas Beschreibung oder sogar nach einem freistehenden Original gezeichnet, also ohne den Glaskasten und ohne die Verzerrungen. Und da die Glocke von der Gesellschaft nie ohne schützende Hülle ausgestellt wird, die Entwürfe der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, sie im Film nur in drei Einstellungen bei Tageslicht zu sehen ist und dann auch nur ohne die Kuppel, kannst du diese Glocke nicht von der ausgestellten Glocke abgezeichnet haben!“
Bernd Mönke suchte im Speicher des PCs die Screenshots, die Jonas von der DVD des Films gemacht hatte. Insgesamt vier Einstellungen fanden sich, in denen sie zu sehen war: Einmal bei Dämmerung, drei weitere Male bei Tageslicht. Auf einer der Tageslichtaufnahmen fehlte nur die Kuppel, die beiden anderen zeigten zwar Details des unteren Drittels, aber sonst nur noch die Soldaten, die angestrengt den waagerechten Klöppel schwangen.
„Na ja, die Glocke ist bis fast zur Kuppel sichtbar“, brummte Jonas. „Man könnte mir unterstellen, den Rest aus der Ausstellung hinzugefügt zu haben. Das Muster der Kuppel ist auf dem Foto gut erkennbar, ebenso die spezielle Aufhängung.“
„Sieh dir nochmal das Foto an:“, sagte sein Vater und holte wieder das Foto der Glocke aus der Ausstellung auf den Bildschirm. „Die Kuppel ist nur teilweise sichtbar, weil die Glocke schon mindestens einen Meter über dem Boden endet. Die Verzierung um die Aufhängung ist aus dieser Perspektive gar nicht sichtbar, es bleiben Lücken, egal wie man die Screenshots zusammenstellt. Um sie so zu zeichnen, wie du es gemacht hast, benötigt man die detaillierte Beschreibung, die du von Opa hattest.“
Jonas angelte nach seinem Mobiltelefon und rief erneut Ralf Schmidt an, gab ihm die Entdeckung seines Vaters weiter.
„Das ist doch schon mal was“, sagte der Anwalt. „Können Sie mir das ‘rüberfunken? Dann kann ich das in der mündlichen Verhandlung mit anbringen.“
„Logo, mach‘ ich“, erwiderte Jonas. Er schrieb eine E-Mail an die Adresse des Anwaltsbüros und hängte die entsprechenden Dateien an.
Der Termin am 7. Mai kam. Anwalt Ralf Schmidt und Jonas Mönke nahmen mit dessen als Zeugen geladenen Eltern im Flur vor dem Saal des Landgerichts Hamburg Platz. Prozesse sind öffentlich, aber bei Zivilprozessen sind nur selten Leute anwesend, die mit den Prozessbeteiligten nichts zu tun haben. Es war bei diesem Prozess nicht anders.
Rechtsanwalt Lupus und ein weiterer Mann setzten sich auf die andere Seite des Gerichtsflurs. Jonas hatte vom Konzeptkünstler Marcus Brown zwar gehört, aber er hatte ihn nie gesehen, noch nicht einmal auf Fotos. Ein weiterer Mann, der auf dem Gerichtsflur war, forderte dafür umso mehr Jonas‘ Aufmerksamkeit, weil er eine unglaubliche Ähnlichkeit mit Jonathan Blanchard hatte, einem britischen Schauspieler, der Jonas‘ erklärter Lieblingsschauspieler war und auch in Mykene mitgewirkt hatte. Der Typ hier auf dem Gerichtsflur hätte mindestens sein Zwillingsbruder sein können. Hatte die Produktion etwa einen ganz prominenten Zeugen aufgeboten? Er haderte fünf Minuten mit sich, dann nahm er seinen ganzen Mut zusammen und trat auf den Mann zu.
„Excuse me … are you really … äh … Jonathan Blanchard?“, fragte er stotternd.
„Nein“, lächelte der Angesprochene verbindlich. „Mein Name ist Bluhm, Roland Bluhm, Professor für Archäologie, Universität Hamburg.“
Jonas wurde rot bis unter die Haarwurzeln.
„Öh, Entschuldigung. Tut mir Leid, Herr Professor“, brummelte Jonas.
„Das muss Ihnen nicht Leid tun. Sie sind beileibe nicht der Erste, dem eine gewisse Ähnlichkeit mit Mr. Blanchard auffällt. Der Witz ist, dass wir sogar am selben Tag Geburtstag haben. Seit der Mann richtig bekannt ist, werde ich vor Kinos richtig belagert“, grinste Bluhm. „Hin und wieder gebe ich dann auch schon mal Autogramme“, ergänzte er augenzwinkernd.
„Sie sind als Gutachter hier, nicht wahr?“, fragte Jonas.
„Stimmt.“
Mönke seufzte.
„Ihr Gutachten könnte für mich ziemlich teuer werden.“
Der Professor lächelte erneut.
„Möglich. Aber wenn diese Glocke, die Sie beschreiben, zu finden wäre und tatsächlich aus dem Ort kommt, auf den ein kleines Detail hinzuweisen scheint, wäre das eine wissenschaftliche Sensation. Deutlicher möchte ich jetzt nicht werden, sonst wird der Anwalt der Klägerseite mir noch Parteinahme vorwerfen. Er guckt schon so komisch.“
Ein Gerichtsdiener erschien und bat die Prozessbeteiligten und die Zeugen in den Saal
Der Vorsitzende Richter, Dr. Hugo Marquardt, eröffnete die Sitzung:
„Zur Verhandlung kommt die Sache Agamemnon Productions Deutschland gegen Jonas Mönke. Geladen sind: Die Klägerin, vertreten durch den Geschäftsführer Hauke Schiemann, vertreten durch Rechtsanwalt Simeon Lupus sowie der Beklagte Jonas Mönke, vertreten durch Rechtsanwalt Ralf Schmidt. Geladen sind ferner die Zeugen Marcus Brown, Hinnerk Trojan, Britta Mönke und Bernd Mönke sowie der Sachverständige, Professor Roland Bluhm, und der Dolmetscher Carsten Berger. Der Zeuge Hinnerk Trojan ist am 2. Mai 2013 verstorben, wie dem Gericht mittels Kopie des Totenscheines angezeigt wurde und fehlt daher entschuldigt. Ich bitte die Zeugen, den Gerichtsaal nunmehr zu verlassen und erst auf Aufruf den Saal wieder zu betreten und hier vorn am Zeugentisch Platz zu nehmen. Wenn Sie Ihre Aussage getätigt haben dürfen Sie natürlich im Publikum Platz nehmen.“
Die Eheleute Mönke, Brown, der Dolmetscher und der Archäologe verließen den Saal und nahmen auf dem Flur wieder Platz. Als die Tür geschlossen war, forderte der Richter den Klägervertreter zum Vortrag der Klage auf.
Simeon Lupus erhob sich und trug die Klage vor:
„Die Agamemnon Filmproduktion verlangt vom Beklagten Jonas Mönke Lizenzgebühren für die Verwendung des Titelbildes für seinen im Jahr 2012 im Felder-Verlag erschienen Roman Die Glocke des Todes. Die auf dem Titelbild gezeichnete Glocke entspricht bis ins Detail dem Entwurf des bei der Klägerin angestellten Produktionsdesigners Marcus Dwight Brown, die der Zeuge Brown für den von meiner Mandantin produzierten Film Mykene im Jahr 2002 gefertigt hat. Der Beklagte hat sie entweder von Bildern aus dem Film abgezeichnet, der seit November 2004 als DVD im Handel erhältlich ist oder er hat die Glocke in der Requisitenausstellung abfotografiert, die im Jahr 2005 in London und in Düsseldorf im Jahr 2006 stattfand und dieses Foto als Kopiergrundlage für seine Titelillustration genutzt.
Da die Entwürfe des Zeugen Brown zweifellos früher entstanden sind als das vom Beklagten verfasste Buch veröffentlicht wurde, kann es keinen Zweifel daran geben, dass der Zeuge Marcus Brown zunächst als Urheber der speziell für die Filmproduktion gefertigten Entwürfe und damit des Erscheinungsbildes der Glocke zu betrachten ist. Der Zeuge Brown wird dies als Zeuge bestätigen. Der Zeuge Brown ist jedoch Angestellter der Agamemnon Filmproduktion und hat sie in seiner Eigenschaft als Produktionsdesigner und im Auftrag dieses Unternehmens entworfen, so dass die Rechte für die Verwertung eines für seine Arbeitgeberin gefertigten Entwurfes gemäß § 43 UrhG bei der Agamemnon Filmproduktion liegen. Beweis hierfür ist die Kopie des Arbeitsvertrages des Zeugen Brown in beglaubigter Übersetzung.
Der Beklagte wurde zunächst gemäß § 97a UrhG abgemahnt und schriftlich aufgefordert, die Rechte der Klägerin anzuerkennen und entsprechende Gebühren zu leisten. Ferner wurde er gemäß § 98 UrhG aufgefordert, die weitere Verwendung des Bildes zu unterlassen, die bereits ausgelieferten Bücher zurückzurufen und zu vernichten. Da der Klägerin aber sehr wohl bewusst war, dass dies schwierig werden könnte, bot sie dem Beklagten gleichzeitig einen Lizenzvertrag an, mit dem gegen eine einmalige Zahlung von zehntausend Euro sowie jeweils einen Euro Lizenzgebühr für jedes weitere verkaufte Exemplar die bereits getätigte und künftige Nutzung des Bildes genehmigt würde. Beweis: Mein Schreiben vom 22.02.2013 im Auftrag der Klägerin. Das Schreiben hat der Beklagte auch erhalten, da er durch seinen Anwalt darauf ablehnend geantwortet hat, so dass nunmehr Klage geboten ist, um die Rechte der Klägerin zu wahren.
Die Klägerin beantragt, den Beklagten zu einer Mindestlizenzgebühr von 10.000 Euro sowie zu einer Mindestlizenzgebühr von einem Euro pro weiterem verkauftem Exemplar zu verurteilen. Diese Größenordnung scheint angesichts des Erfolges der schriftstellerischen Tätigkeit des Beklagten durchaus angemessen. Dass er nach seinem Vortrag weniger Geld für sein veröffentlichtes Buch erhält, kann nicht das Problem des Rechteinhabers seiner Titelillustration sein. Hätte er sich vor der missbräuchlichen Nutzung des urheberrechtlich geschützten Werkes um eine Lizenz bemüht, hätte er möglicherwiese günstigere Konditionen aushandeln können oder die Klägerin hätte ihn bei den Honorarverhandlungen gar unterstützt.
Die Behauptung des Beklagten in der Ablehnung, er habe eine deutlich früher entstandene Zeichnung seines Großvaters als Vorlage genutzt, ist ersichtlich eine Schutzbehauptung, da die mit der Klagerwiderung übersandte Kopie der fraglichen Zeichnung zwar signiert, aber nicht datiert ist. Diese Zeichnung kann der Beklagte ebenso gut selbst gefertigt haben. Er gibt an, die Zeichnung als Computergrafik angefertigt zu haben, weil sich die Tuschezeichnung nicht digitalisieren ließ. Also hat er offensichtlich die Fähigkeit exakt abzuzeichnen. Das wird ihm dann auch von einer eigenen Zeichnung gelungen sein.
Fakt ist, dass der Film Mykene 2004 veröffentlicht wurde und der Beklagte seinen Roman Die Glocke des Todes erst 2012 veröffentlicht hat. Wann die Zeichnung, die mit Hinnerk Trojan signiert ist, tatsächlich entstanden ist, ist derzeit unklar. Ebenso ist unklar, ob sie überhaupt von besagtem Hinnerk Trojan stammt und nicht etwa vom Beklagten selbst. Die angebotenen Beweise des Beklagten werden hier nicht verfangen, da der angebliche Zeuge verstorben ist und nicht mehr aussagen kann. Zum Tod des Großvaters des Beklagten spreche ich dem Beklagten auch im Namen meiner Mandantin mein Beileid aus. An der Zahlungsverpflichtung des Beklagten wird dies jedoch nichts ändern.
Der Beklagte wird daher wie beantragt zu verurteilen sein. Er hat entsprechend seinem Unterliegen auch die Kosten des Prozesses zu tragen.“
Der Richter nahm den Klagevortrag zur Kenntnis und forderte Ralf als Beklagtenvertreter auf, zu erwidern.
„Der Beklagte Jonas Mönke beantragt, die Klage abzuweisen und der Klägerin die Kosten des Prozesses aufzuerlegen. Zum Sachverhalt: Es ist unzutreffend, dass der Beklagte sich für die Titelzeichnung seines Romans Die Glocke des Todes an der vom angestellten Produktionsdesigner der Klägerin für den Film Mykene entworfenen Glocke orientiert oder sie gar vollständig abgezeichnet hat. Er hatte es nicht nötig, sich der geistigen Schöpfung des Produktionsdesigners zu bedienen, weil die Tuschezeichnung des leider verstorbenen Zeugen Trojan bereits aus der Zeit vor dem Jahr 1998 stammt und ihm folglich sehr viel früher bekannt war, als der Film der Klägerin überhaupt veröffentlicht wurde. Zeugen dafür, dass die Zeichnung vom verstorbenen Zeugen Trojan stammt, sind die Zeugen Britta und Bernd Mönke, die Eltern des Beklagten. Britta Mönke ist die Tochter des verstorbenen Zeugen Trojan. Sie können auch bezeugen, dass Hinnerk Trojan seit 1998 blind war und danach nicht mehr zeichnen konnte.
Dass der eigentliche Urheber der Tuschezeichnung seinerzeit nicht gegen die Klägerin wegen Urheberrechtsverletzung vorgegangen ist, lag zum einen daran, dass der verstorbene Zeuge Trojan den Film eben nicht mehr sehen konnte, weil er bereits vorher erblindet war und zum anderen, dass er sich die Form und Gestaltung der Glocke nicht etwa erdacht hat, sondern sie nach der Erinnerung an eine in den Dreißigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts im Museum für Hamburgische Geschichte ausgestellte Bronzeglocke gezeichnet hat. Er war der Ansicht, dass damit kein eigenes Werk entstanden war, das urheberrechtlich geschützt sein konnte. Er hatte damit sogar Recht, denn ein Werk, das ein anderes, sei es auch gemeinfrei wie eine antike Glocke, schlicht kopiert, ist eben gemäß § 2, Satz 2 UrhG keine persönliche geistige Schöpfung.
Deshalb bestreitet mein Mandant auch, dass der Zeuge Brown die Glocke ohne jedes Vorbild selbst entworfen hat. Er geht vielmehr davon aus, dass der Produktionsdesigner sich selbst einer antiken Glocke als Vorlage bedient hat und diese wider besseres Wissen als eigene Schöpfung ausgibt. Die Klägerin mag darlegen, wie der Produktionsdesigner bei seinem angeblichen Entwurf auf Muster kommt, die eher mit dem fernen Orient oder allenfalls Kleinasien korrespondieren als dem bronzezeitlichen Griechenland.
Der Beklagte hätte auch gar nicht einen Entwurf des Zeugen Brown kopieren können, denn die Entwürfe dieses Produktionsdesigners sind der Öffentlichkeit überhaupt nicht zugänglich. Dies ergibt sich so aus den Angaben der Agamemnon-Filmgesellschaft auf deren eigener Webseite. Einen entsprechenden Screenshot des Seiteninhaltes einschließlich des Abrufdatums 3. Mai 2013 lege ich dem Gericht als Urkundenbeweis vor.“
Ralf trat hinter dem Tisch hervor und legte einen Computerausdruck auf den Tisch des Richters. Er kehrte in die Bank zurück und fuhr fort:
„Die Glocke aus dem Film Mykene wurde zwar – wie der Klägervertreter auch vorgetragen hat – in öffentlich zugänglichen Ausstellungen in London und Düsseldorf präsentiert; sie war allerdings stets unter Sicherheitsglas ausgestellt und wurde nie ohne den Glaskasten gezeigt. Natürlich hätte der Beklagte sie dort fotografieren können. Das Ergebnis wäre jedoch nicht dasselbe gewesen. Das Sicherheitsglas verzerrt nämlich die Randstrukturen. Wenn die Klägerin dem Beklagten schon zugesteht, sehr gut nach der Natur zeichnen zu können, dann hätte er in seiner Zeichnung diese Verzerrungen übernommen. Auch hierzu hat der Beklagte einen Screenshot von der Webseite der Beklagten gefertigt, der dem anderen beigeheftet ist.
Eine Abzeichnung nach Screenshots aus dem Film Mykene scheidet ebenfalls aus. Der Film zeigt die Glocke in gerade vier Sequenzen. In keiner davon ist die Glocke ganz zu sehen. Die Verzierung am oberen Abschluss ist in einer der Sequenzen zwar theoretisch sichtbar, aber eben nur theoretisch, denn diese Einstellung ist im Dämmerlicht, das eine detaillierte Abbildung der oberen Kuppelverzierung nicht zulässt. Diese Kuppelverzierung ist auch auf dem wirklich hochauflösenden Bild aus der Ausstellung nicht zu sehen, denn sie ist aus der normalen Bodenperspektive nicht sichtbar, weil die Glocke selbst mannshoch ist und samt Sockel schon mindestens einen Meter über dem Boden steht. Wie auf dem Bild ebenfalls erkennbar ist, befand sich die Glocke bei den Ausstellungen in einem abgedunkelten Raum, in dem Scheinwerfer die Glocke anstrahlen und so erst richtig zur Geltung kommen lassen. Die Kuppel verschwindet aber fast völlig im Halbdunkel. Sie wäre also auch nicht von einer erhöhten Warte – etwa einer Empore – so zu fotografieren gewesen, dass die obere Kuppelverzierung und insbesondere die figürlichen Darstellungen der oberen Aufhängung detailliert sichtbar gewesen wären.
Nach allem ist erwiesen, dass der Beklagte sich eines Entwurfs des angestellten Produktionsdesigners Marcus Brown weder hätte bedienen können noch müssen, um die Titelillustration seines Buches zu fertigen. Die Klage ist daher abzuweisen.“
Der Richter sah sich die Ausdrucke an, gab sie an seine Beisitzer weiter, die sie sich ebenfalls ansahen.
„Die Einwände scheinen plausibel. Wie soll der Beklagte die Glocke denn so nachgezeichnet haben, wenn die einzigen ihm zugänglichen Vorlagen so aussehen wie diese hier?“, fragte Dr. Marquardt den Anwalt Lupus und zeigte ihm die Ausdrucke.
„Nun, dass die Entwürfe aktuell nicht zugänglich sind, muss ja nicht bedeuten, dass sie es nie waren“, erwiderte Lupus. „Und dass der Beklagte nicht fähig sein soll, aus den Filmbildern nicht die ganze Glocke abzuzeichnen, halte ich angesichts seines zweifellos vorhandenen Zeichentalents für unwahrscheinlich. Das hätte er auch aus den einzelnen Bildern zusammentragen können. Ich schlage vor, wir hören den Zeugen Brown.“
„Sie sind also der Meinung, dass sich jemand für die Titelillustration eines Buches, dessen Inhalt mit dem Film Ihrer Mandantschaft bestenfalls den Breitengrad des ersten Schauplatzes gemein hat, die Mühe macht, aus einzelnen Bildern, die nicht mal wirklich zusammenpassen, eine dort in eher untergeordneter Bedeutung vorhandene Glocke so zurechtzupuzzeln, dass sie dem Entwurf Ihres Mandanten, der nicht öffentlich zugänglich ist, bis ins Detail gleicht? Herr Kollege, das glauben Sie doch selber nicht!“, bemerkte Ralf.
„Nun, die Tatsache, dass die Glocke nur wenig zu sehen ist, könnte ihn dazu verleitet haben, dass es schon nicht auffallen würde, wenn er sie dort einfach abkupfert“, erwiderte Lupus spitz.
„Hätte er sie einfach abgekupfert, verehrter Herr Kollege, hätte er sie schlicht nach dem Foto abgezeichnet – und zwar samt den Randverzerrungen. Eine solche Mühe, das alles zusammenzusuchen, macht man sich nicht – besonders, wenn es das Bild schon mindestens sechs Jahre länger in der Familie gibt als der Film alt ist!“
„Über die Motivation Ihres Mandanten, sich des Entwurfs des Zeugen Brown zu bedienen, kann ich naturgemäß nichts sagen. An Spekulationen beteilige ich mich nicht“, versetzte Lupus kalt.
„Sehen wir, welches Licht die Zeugen ins Dunkel bringen können“, sagte der Richter. „Den Zeugen Marcus Brown und den Dolmetscher, bitte.“
Kapitel 5
Zeugenbefragung
Der Zeuge Marcus Brown betrat zusammen mit dem Dolmetscher den Gerichtssaal. Zunächst wurde der Dolmetscher Carsten Berger vereidigt, um dann die Aussage des Zeugen zu übersetzen. Über den Dolmetscher wandte sich der Vorsitzende Richter an den Zeugen:
„Bitte nennen Sie uns Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und den Ort Ihrer Geburt“, forderte der Richter ihn auf, um die Personalien festzustellen.
„Mein Name ist Marcus Dwight Brown, geboren am 11. Februar 1956 in Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika“, übersetzte Dolmetscher Berger.
„Herr Rechtsanwalt Lupus, Sie haben den Zeugen benannt. Bitte“, forderte der Richter den Anwalt zur Befragung auf. Lupus stand auf und nahm die Kopie des Entwurfs, den Brown gefertigt hatte, vom Richtertisch.
„Was ist Ihr Beruf?“, fragte Lupus.
„Ich bin Produktionsdesigner und Konzeptdesigner bei Agamemnon Productions in Los Angeles“, erklärte Brown durch den Dolmetscher.
„Seit wann arbeiten Sie für diese Gesellschaft?“, fragte der Klägervertreter weiter.
„Die Gesellschaft wurde 1999 gegründet. Seitdem bin ich dort als Produktionsdesigner und Konzeptdesigner angestellt.“
„Bitte erklären Sie dem Gericht, was dies hier ist“, fuhr Lupus fort und hielt ihm den Entwurf vor.
„Das ist der Entwurf für die Glocke von Mykene, die ich für den Film Mykene entworfen habe, der im Mai 2004 veröffentlicht wurde. Da steht auch meine Signatur und das Datum drunter“, antwortete der Zeuge in der Übersetzung.
„Wann haben Sie diesen Entwurf gemacht?“
„Die Dreharbeiten waren ein Jahr zuvor. Den Entwurf habe ich schon in der Planungsphase des Films gemacht. Das war 2002, schätze ich“, übersetzte Dolmetscher Berger die auf Englisch gemachte Aussage.
„Aha. Und was ist das hier?“, hakte Lupus nach und präsentierte Jonas‘ Computergrafik.
„Das sieht aus, als hätte jemand meine Glocke abgezeichnet“, ließ der Zeuge übersetzen. „Sie ist – von der Form, der Aufteilung der Felder und der einzelnen in den Feldern befindlichen Mustern – praktisch identisch.“
„Sie sagen: praktisch identisch. Was ist anders?“, hakte Lupus nach. Brown sah sich nach der Übersetzung beide Zeichnungen nochmals gründlich an.
„Hier unten rechts. Da stimmt die Kopie nicht mit meiner Zeichnung überein“, sagte er und wies auf Keilschriftzeichen am unteren Glockenrand. „Bei der Kopie ist da unten jeweils eine Zeile Keile ergänzt.“
„Aber sonst ist sie identisch?“
„Ja. Sonst stimmt alles mit meinem Entwurf überein.“
Der Anwalt nahm das ausgedruckte Foto zur Hand.
„Was ist das?“, fragte er
„Das ist die fertige Glocke. Sie wurde in zwei Requisiten-Ausstellungen präsentiert“, erklärte der Zeuge via Dolmetscher.
„Wer hat diese Glocke gefertigt?“
„Das hat Weta Digital nach meinem Entwurf gemacht. Sie besteht aus Bronze, passend zu der Zeit, in der der Film spielt.“
„Wäre es denkbar, dass die Kopie auch nach der ausgestellten Glocke gemacht worden sein könnte?“, fragte Lupus.
„Klar, warum nicht? Wer das hier gezeichnet hat, der ist schon ein guter Zeichner. Ein guter Zeichner könnte auch die Verzerrungen hier und hier ausgleichen“, erwiderte Brown per Übersetzung und wies auf die Randverzerrungen.
„Danke, keine weiteren Fragen“, sagte Lupus mit einen sanften Lächeln.
„Herr Rechtsanwalt Schmidt: Fragen an den Zeugen?“, erkundigte sich der Richter.
„Ja, danke, Herr Richter. Herr Brown, diese Glocke scheint – von den Mustern her und dem Material, das als Bronze bezeichnet wird – antik zu sein. Woher hatten Sie die Idee, die Glocke so zu gestalten?“, fragte Ralf.
„Na ja, der Film Mykene spielt in der Bronzezeit im Mittelmeerraum. Das gab schon mal das Material vor, mit dem Weta Digital die Glocke nach meinem Entwurf hergestellt hat. Für die Muster und die Form der Glocke habe ich mich in diversen Museen inspirieren lassen“, erklärte Brown.
„Welche Museen waren das?“, hakte Schmidt nach.
„Da bin ich durch die halbe Welt gereist. Ich war in Kairo im Ägyptischen Museum, in der Türkei in Hissarlik, wo ich hoffte, konkrete Muster zu finden. Das Pferd hier zum Beispiel, das habe ich in ähnlicher Form in Ausgrabungen in Hissarlik gefunden. Ich war in Paris im Louvre, wo auch Fundstücke aus Ägypten sind, im British Museum in London und natürlich im Pergamon-Museum in Berlin. Mir ist es sogar gelungen, den Schatz des Priamos in Sankt Petersburg sehen zu können. Dort habe ich die Vorlage für den Kopfschmuck einer mykenischen Hofdame finden können“, ließ Brown durch den Dolmetscher sagen.
„Interessant. Wie sind Sie auf Ägypten oder Troja gekommen? Der Film spielt doch im antiken Griechenland“, bemerkte Ralf.
„Ich bin weder Historiker noch Archäologe. Insofern traue ich mir nicht zu, griechischen Stil vom trojanischen oder ägyptischen zu unterscheiden. Da waren die Museen natürlich die besten Inspirationsmöglichkeiten. Mir ging es auch darum, etwas Einzigartiges zu entwerfen, etwas, das immer mit dem Film Mykene in Verbindung gebracht werden würde, was aber in den Mittelmeerraum passte.“
„Wie … bedeutend ist die Glocke innerhalb des Films?“, fragte Ralf.
„Ach, die war letztlich nur in wenigen Einstellungen zu sehen. Aber viele Zuschauer haben sie dennoch bemerkt und mit Mykene in Verbindung gebracht. Darum wurde sie auch in der Requisitenausstellung recht prominent gezeigt“, übersetzte Carsten Berger die Aussage Browns.
„Diese Zeichnungen sind in der Tat nahezu identisch“, räumte Ralf Schmidt ein. „Wie zugänglich sind oder waren Ihre Entwürfe für die Öffentlichkeit?“
„Ich gebe meine Entwürfe nur an meinen Auftraggeber und veröffentliche keine meiner Entwürfe als … Portfolio, wie es manche meiner Berufskollegen tun. Ich bin seit Jahren festangestellter Produktionsdesigner und arbeite ausschließlich für Agamemnon Productions. Insofern habe ich es nicht nötig, im Internet für mich Reklame zu machen und dafür meine Arbeiten öffentlich auszuhängen“, erwiderte Brown. Der Übersetzer blieb im Ton neutral, während Brown eher unwirsch auf die Frage reagiert hatte.
„Und wie es sollte jemandem, der Ihren Entwurf nie gesehen haben kann, dann gelungen sein, Ihren Entwurf fast auf den Strich genau zu kopieren?“, hakte Ralf nach.
„Die Zeichnung ist toll. Aber die Glocke ist ja in den Ausstellungen zu sehen gewesen und ist auch im Film zu sehen. Wenn jemand so gut zeichnet, kriegt er das hin“, ließ Brown den Übersetzer sagen. Ralf nahm die ausgedruckten Screenshots zum Foto der Webseite hinzu.
„Allein von diesen Vorlagen sollte das möglich sein?“, fragte er.
„Ja, da bin ich sicher. Wenn jemand wirklich gut zeichnet, dann ist das möglich.“
„Der obere Teil der Glocke ist nie wirklich scharf zu sehen. Dennoch sind auch die feinsten Strukturen dort nahezu identisch. Wie geht das?“
„Die Strukturen sind identisch. Fragen Sie doch Ihren Mandanten, wie er das hinbekommen hat. Der hat das gezeichnet“, versetzte Brown via Dolmetscher.
„Hmm, was sagt Ihnen der Name Boris Trojan?“, fragte Ralf.
„Der Name tut nichts zur Sache!“, fuhr Klägervertreter Lupus dazwischen.
„Der Name tut sehr wohl etwas zur Sache, denn mein Mandant trägt vor, dass sein Großvater Hinnerk Trojan diese Zeichnung hier“, er nahm den Ausdruck der Computergrafik zur Hand, „vor 1998, also noch bevor Sie bei Agamemnon Productions angefangen haben, nach Beschreibungen seines Vaters Boris Trojan, seines Zeichens Professor für Archäologie in Berlin, gefertigt hat.“
„Wobei nicht unerwähnt bleiben sollte, dass der Großvater Ihres Mandanten unglücklicherweise ein paar Tage vor dem Termin verstorben ist und dies nicht mehr bestätigen kann“, versetzte Lupus spitz.
„Das ist in der Tat ein Unglück, Herr Kollege, das meinen Mandanten und seine Familie in Trauer zurücklässt, auch wenn Herr Trojan mit dreiundneunzig Jahren ein durchaus gesegnetes Alter erreicht hatte“, grollte Ralf. „Das sollte zu unpassendem Spott keinen Anlass geben!“
„Aber es ist doch Fakt, dass der alte Herr die Behauptungen Ihres Mandanten nicht mehr bestätigen kann, oder?“, beharrte Lupus.
„Das bleibt es, keine Frage. Aber ihr Spott, der ist hier fehl am Platz!“
„Wenn Ihr Mandant den Beweis nicht führen kann, weil der angebliche Urheber dieser Zeichnung verstorben ist, weiß ich nicht, weshalb Ihr Mandant sich weigert, anzuerkennen, dass der Zeuge der Klägerin mit seinem Entwurf nun einmal schneller war und die Veröffentlichung des Buches Ihres Mandanten erst danach erfolgte“, wandte Lupus ein.
„Ihre Mandantin klagt wegen Verletzung des Urheberrechtes, nicht, dass sie bezüglich der Veröffentlichung schneller war. Und diese Verletzung, die bestreitet mein Mandant!“, entgegnete Schmidt scharf.
„Moment!“, fuhr Richter Dr. Marquardt dazwischen. „Beantworten Sie die Frage des Beklagtenvertreters, Herr Brown!“, wies er den Zeugen an. Noch bevor der Dolmetscher übersetzen konnte, erwiderte Brown:
„Der Name sagt mir nichts“, was Berger pflichtschuldigst übersetzte.
„Dann habe ich keine weiteren Fragen an den Zeugen“, sagte Ralf. „Ich bitte, die Eltern des Beklagten als Zeugen zum Alter der Zeichnung zu hören.“
„Als ob die was anderes sagen würden, als Ihr Mandant ihnen eingetrichtert hat!“, ließ Lupus eine erneute Spitze los.
„Herr Rechtsanwalt, die Beweiswürdigung ist Sache des Gerichtes!“, wies Richter Marquardt Simeon Lupus zurecht. „Herr Brown, Sie sind als Zeuge entlassen. Sie dürfen natürlich gern im Publikum Platz nehmen. Die Zeugin Britta Mönke, bitte.“
Berger übersetzte für Brown, der sich bedankte und mit dem Dolmetscher den Raum verließ.
Britta Mönke erschien auf den Aufruf, betrat den Gerichtssaal und nahm auf Aufforderung des Richters am Zeugentisch Platz.
„Nennen Sie uns bitte Namen, Geburtsdatum und Geburtsort“, forderte der Richter sie auf.
„Mein Name ist Britta Mönke, geborene Trojan, geboren am 3. Oktober 1961 in Koserow auf Usedom“, antwortete sie.
„Sie sind mit dem Beklagten verwandt oder verschwägert?“, fragte der Richter weiter.
„Jonas ist mein Sohn.“
„Ich weise Sie darauf hin, dass Sie als Verwandte die Aussage verweigern können. Wenn Sie von Ihrem Aussageverweigerungsrecht keinen Gebrauch machen wollen, muss ich Sie darauf hinweisen, dass Sie vereidigt werden können und dass eine unwahre eidliche oder uneidliche Aussage strafbar ist. Wollen Sie aussagen?“, fuhr der Richter fort.
„Das will ich, Euer Ehren“, erwiderte Britta Mönke.
„Danke, aber das gibt’s vor deutschen Gerichten nicht. Herr Richter genügt völlig“, grinste Dr. Marquardt. Er nickte Ralf zu.
„Sie haben die Zeugin benannt, Herr Rechtsanwalt Schmidt. Bitte, befragen Sie die Zeugin.“
„Danke, Herr Richter. Frau Mönke, was hat es mit dieser Zeichnung auf sich?“, fragte Ralf und zeigte Britta Mönke die Tuschezeichnung.
„Das ist eine Zeichnung, die mein Vater Hinnerk Trojan vor Jahren gemacht hat“, sagte sie.
„Woran erkennen Sie das?“
„Nun ja, sie ist mit seinem Namen signiert. Aber ich habe diese Zeichnung auch in seiner Wohnung gesehen. Nachdem er zu uns in die Wohnung gezogen ist, hat er sie meinem Sohn geschenkt. Ab da hing sie in dessen Zimmer. Als er dann ausgezogen ist, hat er sie mitgenommen.“
„Wann hat Ihr Vater diese Zeichnung gemacht?“, fragte Ralf weiter.
„Auf jeden Fall vor 1998, denn in dem Jahr ist er erblindet. Seit 1991 lebte er in Hamburg, 1995 zog er zu uns, weil er sich nicht mehr alleine versorgen konnte. Diese Zeichnung hing noch in seiner eigenen Wohnung, also ist sie nach 1991, aber vor 1995 entstanden“, erklärte Britta.
„Ist dies das einzige Bild, das Ihr Vater gezeichnet hat?“
„Nein, es gibt eine Menge Zeichnungen von ihm.“
„Wie oft hat Ihr Vater gezeichnet?“
„Eigentlich ständig. So, wie mein Sohn praktisch nie ohne Schreibzeug ist, hatte mein Vater irgendwie immer Papier und Bleistift bei sich. Wann immer er Zeit fand, hat er gezeichnet.“
„Tat er das aus Neigung oder verdiente er seinen Lebensunterhalt damit?“, fragte Ralf weiter.
„Mein Vater war ursprünglich Fischer. Seit 1985 war er in Rente und konnte sich seinem Hobby widmen. Selbst wenn er zum Angeln ging, hatte er immer einen Zeichenblock und Stifte dabei.“
„Wie oft hat er Tuschezeichnungen gemacht?“, hakte Ralf nach.
„Wenn ihm eine Zeichnung besonders gut gefallen hat, hat er sie in Tusche nachgezeichnet. Diese war eine seiner liebsten Zeichnungen.“
„Woher hatte er die Idee dazu? So eine Glocke ist eher ungewöhnlich“, bemerkte Ralf.
„Nun ja, die ganze Geschichte dazu ist ungewöhnlich. Ich weiß nur nicht, ob das hier an diesen Ort gehört.“
„Erzählen Sie, was Sie dazu wissen“, forderte Ralf sie auf. Britta atmete tief durch.
„Mit dieser Glocke ist die Geschichte der untergegangenen Stadt Vineta verbunden.“
Simeon Lupus lachte laut auf.
„Märchenstunde!“, prustete er.
„Herr Rechtsanwalt, unterlassen Sie die unpassenden Zwischenrufe!“, wies der Richter ihn zurecht. „Also, was hatte diese Glocke, die ja eher nach Orient auszusehen scheint, mit Vineta zu tun?“, wandte er sich an die Zeugin.
„Mein Vater erzählte mir, dass es diese Glocke gegenständlich gegeben hat. Sie war bei Baggerarbeiten vor Neuwerk gefunden worden, das zu Hamburg gehört. Sie war ins Museum für Hamburgische Geschichte gebracht worden. Weil sie dort nicht hinzupassen schien, war mein Großvater schon vor 1930 vom Museum damit beauftragt worden, nachzuforschen, wo sie einzuordnen war. Dann kam die Weltwirtschaftskrise und das Projekt wurde mangels Geld eingestampft. Dann kamen die Nazis an die Macht und räumten alles aus den Museen weg, was den Anschein erweckte, jüdisch zu sein. Mein Großvater sollte die Glocke in deren Auftrag Hamburg begutachten. Er meinte, dass er diese Glocke schon auf einem uralten Holzschnitt gesehen hatte, der die Legende von Vineta darstellte. Das war eine Handelsstadt in der Ostsee, die bei der Allerheiligenflut im Jahr 1304 unterging. Der Legende nach wurde Vineta von Gott gestraft, weil die Einwohner so gottlos waren. Die Glocke soll drei Monate, drei Wochen und drei Tage vor dem Untergang geläutet haben, ohne dass sie angestoßen worden war. Bei dem Begriff Vineta wurden die Bonzen hellhörig. Mein Großvater bekam den Auftrag, genau nachzuforschen. Die hatten die Idee, dass sich die Vineter als nordeuropäisches Volk erweisen würden. Auf Usedom ist das eine recht präsente Legende, denn Vineta soll vor der Südostspitze von Rügen gewesen sein. Die Greifswalder Oie ist angeblich dessen letzter Rest. In den damaligen Archiven fanden sich Hinweise, dass die Glocke von einem seefahrenden Kaufmann namens Reimers noch aus dem Meer geborgen werden konnte. Weil Vineta nicht mehr existierte, schipperte Kaufmann Reimers in die Nordsee und ließ sich in Rungholt nieder. Sechzig Jahre später ging auch Rungholt unter, bei der Marcellusflut, der Großen Mandränke des Jahres 1362, aber auch dieses Mal konnte die Glocke geborgen werden, von einem Nachfahren des Kaufmanns Reimers, der dann nach Hamburg übersiedeln wollte. Die Glocke wollte er der Nikolaikirche stiften. Er selbst kam mit einem seiner beiden Schiffe an, aber das zweite, die Vineta, auf der sich die Glocke befand, erreichte Hamburg nicht – jedenfalls nicht den Hafen.
Mein Großvater war ziemlich verblüfft, weil die Darstellungen auf der Glocke nur sehr oberflächlich zu figürlichen Darstellungen der Wikinger passten. Sie sahen eher orientalisch aus. Manche der Figuren schienen mit Verzierungen zusammenzupassen, die sich auf Stücken fanden, die Heinrich Schliemann im Hügel von Hissarlik ausgegraben hatte. Das schien mit Ostseehandel auf den ersten Blick wenig zu tun zu haben. Andererseits ist Bernstein bis nach Kleinasien gehandelt worden. Warum also nicht auch Bronzegegenstände nach Norddeutschland? Mein Großvater bekam das Okay aus Berlin und konnte schließlich ermitteln, dass es vielleicht die erste Glocke dieser Größe im kleinasiatischen Raum war, die … in … Troja gehangen hatte und von den Trojanern nach dem trojanischen Krieg auf ihrer Wanderung mitgenommen worden war. Über mehrere Jahrhunderte hinweg kam die Glocke immer weiter nach Norden, bis sich die letzten Nachfahren dieses Volkes auf dem Südostzipfel Rügens niederließen, wo sie sich vor Verfolgung sicher fühlten, nachdem die Hunnen sie dorthin getrieben hatten.
Die Schlussfolgerung, dass die Glocke eben doch aus einer Gegend stammte, die von Semiten bevölkert war, ernüchterte die Nazis. Das Ergebnis wollten sie nicht wahrhaben. Mein Großvater wurde emeritiert. Das Manuskript sollte er zur Vernichtung abliefern. Er weigerte sich und versteckte es samt den dazugehörigen Fotos, die er im Museum von der Glocke gemacht hatte, bevor er abgeholt und ins KZ Trassenheide gesteckt wurde. Nur hat er niemandem verraten, wo er das versteckt hatte. Aber mein Vater hatte ihn nach Hamburg begleitet und hat die Glocke im Museum selbst gesehen, wie er betonte. Mein Vater war sehr an Geschichte interessiert und hatte als Junge die Idee, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, aber nachdem sein Bruder im Krieg gefallen war, lernte er im Interesse der Ernährung der Familie lieber Fischer. Und weil die Glocke für eine so einschneidende Veränderung verantwortlich war, ließ sie ihn nie los. Er hat sie gezeichnet, vielleicht, um das alles besser verarbeiten zu können“, erklärte Britta Mönke. „Und das dort ist die Zeichnung, die er gemacht hat; die mein Sohn für die Titelillustration seines Buches verwendet hat, weil es darin eben um diese Glocke geht.“
„Also, es gibt die Fotos, die Ihr Großvater von der Glocke gemacht, nicht mehr?“
„Nein. Falls es sie noch geben sollte, wäre jedenfalls in unserer Familie keinem bekannt, wo sie sein könnten. Wir wissen auch nicht, wo das Manuskript meines Großvaters sein könnte.“
„Wie hat Ihr Vater reagiert, als er erfuhr, dass die Glocke in dem Film Mykene der seiner Zeichnung so ähnlich war?“, fragte Ralf.
„Jonas hat ihm davon erzählt. Er meinte, das könne Zufall sein oder der Designer habe sich an ähnlichen Glocken orientiert. Er meinte auch, es sei wohl nicht schlau, sich einen Urheberrechtstreit mit einer Hollywood-Filmgesellschaft zu liefern, vor allem, weil er eine Glock abgezeichnet hatte und nie behauptet hatte, sie erfunden zu haben“, erklärte Britta.
„Danke, keine weiteren Fragen an die Zeugin“, sagte Anwalt Schmidt mit einem leichten Lächeln.
„Herr Rechtsanwalt Lupus? Fragen an die Zeugin?“, erkundigte sich der Richter.
„Ja, danke, Herr Richter. Ich hake doch gleich mal bei Ihrer letzte Aussage ein“, sagte er. „Wann hat Ihr Sohn den Film Mykene gesehen, Frau Mönke?“
Sie stutzte kurz.
„Das war kurz nach dem Kinostart, soweit ich mich erinnere. Mein Sohn ist großer Fan des Schauspielers Jonathan Blanchard, der darin eine maßgebliche Rolle spielt.“
„Aha. Der Inhalt des Buches Ihres Sohnes – wie gut ist der ihnen bekannt?“, fragte Lupus.
„Ich habe auf seine Bitte das Manuskript korrekturgelesen. Es geht genau um diese Glocke und das, was sein Urgroßvater dazu herausgefunden hatte. Nur hat mein Sohn das romanhaft aufgebaut und nicht als wissenschaftliche Arbeit“, erwidere Britta.
„Was Sie da erzählt haben … das klingt nach ziemlich spinnertem Kram, oder?“, hakte Lupus nach.
„Och, Ihre Mandantschaft lebt von spinnertem Kram, Herr Rechtsanwalt. Die verkaufen das als Fantasy. Mykene ist ja schließlich kein wissenschaftlicher Dokumentarfilm, sondern kehrt die Ereignisse der Ilias und der Odyssee um“, konterte Britta. „Für Bücher gilt dasselbe. Was mein Großvater ermittelt hat, lässt sich derzeit wissenschaftlich nicht belegen, weil seine Aufzeichnungen dazu eben verschwunden sind. Deshalb hat mein Sohn auch einen belletristischen Roman mit erfundenen Charakteren geschrieben, die diese Ereignisse erleben. Das kann als Fantasy bezeichnet werden. Fantasy als spinnerten Kram zu bezeichnen, verunglimpft jegliche Form von Belletristik und auch die Arbeit Ihrer Klientin. Die Literatur besteht nicht nur aus wissenschaftlichen Werken und Gesetzbüchern, Herr Rechtsanwalt“, versetzte sie.
„Also, Ihr Sohn hat den Film gesehen und hat später den Roman geschrieben, für dessen Titelillustration er den Entwurf des Zeugen Brown abgekupfert hat“, wollte Lupus feststellen.
„Ich habe bereits gesagt, dass mein Sohn nicht den Entwurf aus dem Hause Ihrer Klientin verwendet hat, sondern die Tuschezeichnung meines Vaters, die irgendwann zwischen 1991 und 95 entstanden ist“, entgegnete Britta.
„Was der unglücklicherweise nicht mehr bestätigen kann. Das Bild ist ja nicht mal mit einem Datum versehen.“
„Wo steht geschrieben, dass das sein muss? Er hat es signiert. Aber ich nehme an, Herr Rechtsanwalt Lupus, Sie würden die Provenienz meines Vaters auch dann noch bestreiten, wenn er ein Datum hinzugeschrieben hatte; selbst, wenn er Ihnen das persönlich hätte erklären können. Ich frage mich hingegen, woher der Konzeptdesigner haargenau diese Glocke zeichnen konnte, wenn die Fotos, die mein Großvater gemacht hat, verschwunden sind und die genaue Beschreibung allein noch meinem Vater bekannt war. Wenn er das wirklich entworfen hat, ohne diese Kenntnis zu haben, dann ist es ein ziemlicher Zufall, oder?“
„Ihre Aussage ist mit nichts überprüfbar. Alle, die Ihre Aussage bestätigen könnten, sind tot. Die Nutzung der vom Zeugen Brown entworfenen Glocke ist vor der Veröffentlichung des Buches Ihres Sohnes erfolgt.“
„Aber damit ist noch lange nicht bewiesen, dass Jonas abgezeichnet hat. Mein Mann hat im Übrigen festgestellt, dass die Entwürfe Ihres Zeugen gar nicht öffentlich zugänglich sind. Das wird auf der Webseite Ihrer Klientin ausdrücklich ausgeschlossen. Ja, Jonas ist ein wirklich guter Zeichner. Aber auch der beste Zeichner würde die Glocke, wenn er sie von dem Ausstellungsfoto abzeichnet, mit den Randverzerrungen zeichnen und nicht fehlende Felder ergänzen.“
„Ah, darüber haben Sie sich also Gedanken gemacht. Interessant. Gut abgesprochen, das muss ich Ihnen lassen. Aber klar, das ist Familiensinn“, sagte Lupus.
„Herr Rechtsanwalt, habe Sie weitere konkrete Fragen an die Zeugin oder wollen Sie sich in Mutmaßungen ergehen?“, fragte der Richter. „Ich erinnere Sie nochmals, dass die Beweiswürdigung Sache des Gerichtes ist.“
„Keine weiteren Fragen an die Zeugin“, erwiderte Lupus.
„Dann bitte den Zeugen Bernd Mönke“, wies der Richter den Saaldiener an.
Bernd Mönke erschien, seine Personalien wurden festgestellt. Auch er wurde auf sein Zeugnisverweigerungsrecht hingewiesen und wollte aussagen. Auf Befragen von Rechtsanwalt Schmidt machte er gleichlautende Aussagen zur Entstehungszeit und dem Urheber der Tuschezeichnung; dazu, dass sein Schwiegervater ein ausgesprochen fleißiger Zeichner war. Er bestätigte auch, dass er über die Ähnlichkeit der Glocke mit der aus dem Film eher schulterzuckend hinweggegangen war.
„Aber als Jonas die Zeichnung als Titelillustration verwenden wollte, da ist mir ganz anders geworden. Ich hab‘ das hier kommen sehen. Mir war klar, dass er Ärger bekommen würde. Dass mein Schwiegervater keinen Streit vom Zaun brechen wollte, weil er meinte, es lohne sich nicht, weil er selbst definitiv von einer existenten Glocke abgezeichnet hatte, dass man sich nicht mit Hollywood anlegt, weil die einfach am längeren Hebel sitzen, war eine Sache. Aber dass Hollywood nicht stillhalten würde, sondern versuchen würde, sich ein Stück vom Kuchen abzuschneiden, das war sonnenklar. Ich habe ihn gewarnt, aber er wollte nicht auf mich hören“, erklärte er.
„Aber Sie sagen, das Bild hier stammt von Ihrem Schwiegervater – und dass es das ist, was Ihr Sohn benutzte“, hielt Ralf ihm vor.
„Recht haben und Recht kriegen, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Nein, er hat nicht abgekupfert, abgesehen von der Zeichnung meines Schwiegervaters, was der ihm auch ausdrücklich erlaubt hat. Aber wenn die Bosse da in Hollywood riechen, dass irgendwo Geld zu holen ist, dann schlagen sie zu. Sehen Sie doch“, seufzte Bernd Mönke.
Die Äußerung Bernd Mönkes, er habe seinen Sohn vor der Verwendung des Bildes gewarnt, nahm Simeon Lupus als Eingeständnis, dass Jonas die Glocke aus dem Film abgezeichnet hatte.
„Das habe ich nicht gesagt“, widersprach der Vater. „Mir wäre auch vollkommen unverständlich, wie Jonas die Glocke so hätte zeichnen sollen, wenn er sie aus dem verzerrenden Foto und fünf oder sechs Filmbildern zusammengestoppelt hätte, die nie die komplette Glocke zeigen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, sie zu kombinieren.“
Er nahm aus der Tasche, die er bei sich hatte, einen Ausdruck, auf dem die Glocke aus den möglichen Filmscreenshots herausgeschnitten und diese Teile kombiniert waren. Die Glocke war auch in dieser Kombination nie vollständig, die Felder waren – weil sie aus unterschiedlichen Perspektiven gefilmt war – nie in der Anordnung, in der sie auf den übereinstimmenden Zeichnungen des Entwurfs und der Tuschzeichnung waren. Insbesondere war die Kuppel nicht sichtbar.
„Zu behaupten, mein Sohn hätte aus dieser Kombination das hier“, Mönke wedelte mit der Kopie des Entwurfs, „eine schier exakte Kopie des Entwurfs zusammenstellen können, ist Blödsinn in Büchsen. Egal, wie gut ein Zeichner sein mag: Aus diesen Vorlagen diesen Entwurf zu kopieren, ohne ihn visuell zu haben, bedarf der Hellsicht. Ich kann Ihnen versichern: Mein Sohn ist ein ziemlich normaler Mensch, aber ganz gewiss kein Hellseher, Magier oder so was in der Richtung. Dazu hätte er den Entwurf des Konzeptzeichners haben müssen, um ihn so exakt zu kopieren. Nur ist der nicht öffentlich zugänglich. Ihre Mandantin weist auf der eigenen Webseite ausdrücklich darauf hin, dass die Entwürfe ihrer Konzeptzeichner nur intern genutzt werden, eben nur zur Herstellung der Requisiten, aber nicht veröffentlicht werden. Mein Sohn hat auch nie für Ihre Mandantin gearbeitet. Wie also hätte mein Sohn an diesen Entwurf kommen sollen, um ihn zu kopieren?“
„Der Zeuge Brown meint, ein so guter Zeichner wie Ihr Sohn hätte allein aus dem Foto die Zeichnung so gestalten können“, erwiderte Lupus.
„Quatsch mit Soße. Da redet sich der Zeuge Brown bildschön heraus! Ich denke, dass eher umgekehrt ein Schuh draus wird. Ich frage mich sowieso, weshalb jemand, der eine griechische Glocke entwerfen soll, sich ausgerechnet auf Muster verlegt, die sonst wo im Mittelmeerraum zu finden sind, bloß nicht in Griechenland!“, versetzte Mönke.
„Und wie, meinen Sie, hätte der Zeuge Brown an eine nicht veröffentlichte Zeichnung Ihres Schwiegervaters kommen sollen?“, stellte Lupus die Gegenfrage. „Er ist ebenso wenig Hellseher wie Ihr Sohn, Herr Mönke. Fakt ist aber, dass der Film 2004 veröffentlicht wurde und das Buch Ihres Sohnes erst 2012. Die Wahrscheinlichkeit, dass er abgepinselt hat, ist da höher.“
„Noch mal: Mein Sohn hat die Zeichnung seines Großvaters verwendet. Den Entwurf konnte er nicht kopieren, weil er nie öffentlich zugänglich war!“
„Wollen Sie es denn als puren Zufall deklarieren?“
„Das weiß ich nicht. Aber ich weiß genau, dass er nicht den Entwurf Ihres Zeugen Brown kopiert hat, weil er das a) nicht nötig hatte; schließlich gibt es die Zeichnung meines Schwiegervaters. Und b) weil es überhaupt nicht möglich gewesen wäre, denn der Entwurf ist bisher nie an die Öffentlichkeit gedrungen.“
„Keine weiteren Fragen an den Zeugen“, beendete Lupus die Befragung.
Bernd Mönke nahm neben seiner Frau im Publikum Platz.
„Ich könnte diesen … Mistkerl in der Luft zerreißen“, brummte er Britta leise zu.
„Das geht dir nicht allein so, Schatz“, gab sie flüsternd zurück. „Jetzt weiß ich, wieso Jonas den überhaupt nicht ausstehen kann.“
Kapitel 6
Sachverstand
Richter Dr. Marquardt bat Professor Bluhm zum Vortrag seines Gutachtens. Wie alle anderen wurde der Sachverständige zu seinen Personalien befragt.
„Mein Name ist Roland Bluhm, geboren am 13. Januar 1977 in Hamburg. Ich bin Professor für Archäologie an der Universität Hamburg“, gab er an.
„Geben Sie bitte Ihr Gutachten ab, Herr Professor“, forderte der Richter ihn auf.
„Mein Gutachtenauftrag lautet wie folgt:
- a) Gibt es historische Vorbilder zu der vom Produktionsdesigner Marcus D. Brown entworfenen Glocke?
- b) Gibt es weitere solche real existierenden Glocken?
- c) Sind Übereinstimmungen der von Produktionsdesigner Brown entworfenen Glocke mit historischen Vorbildern vorhanden? Falls ja, welche?;
- d) Kann die von Produktionsdesigner Brown entworfene Glocke als dessen alleinige Erfindung gelten, wenn es möglicherweise keine weiteren Glocken dieser Art gibt?
- e) Ist die Glocke auf dem Bucheinband tatsächlich mit der als Requisit für den Film „Mykene“ entworfenen und tatsächlich hergestellten Glocke identisch?
- f) Passt sie zum kulturellen Raum, in dem der Film Mykene spielt oder – falls nicht – welchem kulturellen Raum, ggf. welcher Zeit ist sie tatsächlich zuzuordnen?
Zum besseren Verständnis beschreibe ich die Glocke zunächst. Es handelt sich um eine 180 Zentimeter hohe Bronzeglocke mit einem Durchmesser von 90 Zentimetern. Der Zylinder ist 120 cm hoch, die Kuppel 60 cm. Der Zylinder ist mit 9 Reihen von Quadraten verziert, in denen sich bildliche Darstellungen finden. Sechs unterschiedliche figürliche Darstellungen sind erkennbar: 1. Ein reiterloses Pferd, 2. ein achtspeichiges Rad, 3. ein nach oben gerichteter Pfeil, 4. ein Stierkopf, 5. zwei gekreuzte Speere, 6. ein Bogenschütze mit gespanntem Bogen. Diese Bilder wiederholen sich – auch in dieser Reihenfolge –augenscheinlich rund um den Zylinder. In der Reihe darunter ist die Folge um ein Feld nach rechts versetzt, so dass die Bilder aus der Perspektive des Betrachters ein nach schräg nach unten rechts verlaufendes Muster bilden. Am unteren Rand der Glocke finden sich etwa in der Mitte Keilschriftzeichen. Die Kuppel ist mit oberflächlichen dreieckigen Gravuren verziert, die Kegel darstellen, da sie nach rechts unten gewundene Spiralen bilden. Sie sind jedoch nicht als dreidimensional ausgeführt zu erkennen. Die Aufhängung ist ein Ring, der mit Gravuren verziert ist, die ihn wie einen geflochtenen Reifen erscheinen lassen. Durch die Kuppel hat die Glocke eine leicht konische Form. Einen Klöppel hat die Glocke augenscheinlich nicht und wird zur Tonerzeugung von außen angestoßen.
Zur Prüfung wurden eingereicht: Eine hochauflösende .bmp-Datei einer schwarz-weißen Computergrafik sowie eine Fotokopie einer schwarz-weißen Zeichnung, wahrscheinlich einer Tuschezeichnung, die mit Hinnerk Trojan signiert ist. Die Signatur fehlt auf der Computergrafik. Ferner wurde eine hochauflösende .bmp-Datei einer Fotografie einer in einem Glaskasten stehenden Bronzeglocke nach Anforderung durch mich von der Klägerin zur Verfügung gestellt. Dieses Foto weist an den Rändern relativ starke Randverzerrungen auf, die jeweils die äußersten Quadrate der Verzierung nur noch zu etwa einem Drittel erkennen lassen. Grund für die Verzerrung ist vermutlich das Sicherheitsglas, mit dem der Kasten verkleidet ist.
Zu a) Als historische Vorbilder könnten buddhistische Glocken des 15. Jahrhundert angesehen werden. Solche gibt es in verschiedenen Museen, die speziell Stücke asiatischer Provenienz ausstellen. Keine dieser Glocken gleicht jedoch bis ins Detail der Requisiten-Glocke.
Zu b) Die Glocke von Hiroshima wäre eine real existierende Glocke, die von Form und Größe vergleichbar wäre. Aber auch sie hat andere Verzierungen um den Glockenzylinder.
Zu c) Die real vorhandenen Glocken sind zwar von der Größe und der Form her vergleichbar, jedoch ist nur das achtspeichige Rad als Symbol des Buddhismus von den figürlichen Darstellungen passend zu den denkbaren Vorbildern.
Zu d) Da es nach derzeitigem Stand der Forschung keine wirklich übereinstimmenden real existierenden Glocken gibt, ist es jedenfalls nicht absolut auszuschließen, dass der Konzeptdesigner Marcus Brown diese Glocke nach seiner eigenen Fantasie gestaltet hat.
Zu e) Die Glocke auf dem Bucheinband ist mit der auf dem Ausstellungsfoto vom Filmrequisit nahezu identisch. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Randverzerrungen auf der Zeichnung und der Computergrafik nicht vorhanden sind. Wäre die ausgestellte Glocke das Vorbild für die Zeichnungen gewesen, wären auch die Verzerrungen übernommen worden.
Zu f) Die Glocke passt so, wie sie gestaltet wurde, nicht in den griechischen Kulturraum der Bronzezeit, in dem der Film Mykene spielt. Dafür ist sie viel zu groß. Bronzezeitliche Glocken aus dem antiken Griechenland oder dem kleinasiatischen Raum sind erheblich kleiner, etwa fünf bis zehn Zentimeter hoch. Größe und Form sprechen für den entfernteren asiatischen Raum und das 15. bis 17. Jahrhundert, die bildlichen Darstellungen sind jedoch eher im antiken kleinasiatischen Raum oder gar der minoischen Kultur zu suchen. Das Pferd ist eine Darstellung, die sich bei den Skythen findet, der Stierkopf korrespondiert mit den Minoern, der Bogenschütze hat eine eher ägyptische Prägung, die gekreuzten Speere und der nach oben gerichtete Pfeil legen assyrische, hethitische oder medische Provenienz nahe. Nach den bildlichen Darstellungen kommt der kleinasiatisch-mesopotamische Raum in Betracht. Dazu passt auch die Keilinschrift am unteren Rand der Glocke.
Die Keilschrift ist die einzige inhaltliche Abweichung zwischen den beiden Zeichnungen. Interessant ist dabei, dass eine der Inschriften sogar Sinn ergibt, während die andere in der vorgelegten Form bestenfalls als sinnfreie Verzierung durchgehen kann. Die sinnvolle Inschrift befindet sich auf der Tuschezeichnung, die mit Hinnerk Trojan signiert ist und der Computergrafik. Bei der Keilinschrift des Requisits fehlt jeweils die unterste Keilzeile, womit die Schriftzeichen nicht mehr als die … populär ausgedrückt … Buchstaben lesbar sind, die sich auf der Tuschezeichnung identifizieren lassen. Diese Inschrift lautet übersetzt: Dies ist ein Geschenk des Königs von Hattuša für den König von Taruiša. Taruiša ist eine hethitische Bezeichnung für Troja.
Der Umstand, dass die Keilschrift auf der Tuschezeichnung einen sinnvollen Satz ergibt, auf der Glocke selbst aber nicht, kann – unter der Voraussetzung, dass die Tuschezeichnung bzw. die Computergrafik von der fotografierten Glocke abzeichnet wurde – als Ursache haben, dass die Verzerrung der Perspektive durch den Glaskasten die unterste Zeile der Keile verschluckt hat und vom Hersteller der Tuschezeichnung nachbessernd ergänzt wurde, als er die Glocke näher betrachtete. Das würde auch erklären, dass die Verzerrungen an den Rändern, die auf dem Foto erkennbar sind, nicht in die Zeichnung übertragen wurden.
Zusammenfassung: Die als Filmrequisit hergestellte Glocke passt nicht in den griechischen Kulturkreis, sondern kann von Größe und Form dem weiteren asiatischen Raum und der buddhistischen Kultur zugeordnet werden. Die bildlichen Darstellungen auf der Glocke sind dem kleinasiatisch-mesopotamischen und ägyptischen Raum zuzuordnen und passen ebenfalls nicht in den bronzezeitlichen griechischen Kulturraum. Zeichnung und Computergrafik sind nahezu identisch, abgesehen davon, dass auf dem vorgelegten Foto Randverzerrungen deutlich erkennbar sind, die auf Zeichnung und Computergrafik nicht vorhanden sind.
Dieses Gutachten habe ich nach bestem Wissen und Gewissen unparteiisch erstellt“, trug der Professor vor.
„Danke, Herr Professor Bluhm. Herr Rechtsanwalt Schmidt, Sie haben das Gutachten beantragt. Haben Sie Fragen an den Zeugen?“
„Ja, danke, Herr Richter. Herr Professor Bluhm, Ihr Gutachten stützt sich bezüglich des Requisits ausschließlich auf das Foto, habe ich das so richtig verstanden?“
„Das ist korrekt. Seitens der Klägerin wurde dieses Foto als .bmp-Datei vorgelegt“, erwiderte Bluhm.
„Das heißt: Der eigentliche Entwurf für die Glocke von Marcus Brown ist Ihnen nicht bekannt?“
„Nein, den kenne ich nicht. Ich hatte ihn zwar erbeten, aber mir wurde mitgeteilt, dass solche Entwürfe nur an Firmen gesandt werden, die die Requisiten herstellen“, erwiderte der Archäologe. Ralf Schmidt nahm vom Richtertisch den Entwurf, der dem Gericht zur Verfügung gestellt worden war.
„Das hier … ist der Entwurf, den die Klägerin dem Gericht zur Verfügung gestellt hat. Wie verhält sich dieser Entwurf zu dem Foto, das Ihnen zur Verfügung gestellt wurde?“
Roland Bluhm nahm den Entwurf zur Hand und verglich ihn mit dem Foto.
„Kann ich bitte mal die Zeichnung des Beklagten haben?“, bat er. Ralf gab ihm die Zeichnung.
„Das ist ja interessant …“, murmelte Bluhm.
„Lassen Sie uns an Ihren Feststellungen teilhaben, Herr Professor?“, forderte Lupus ihn auf.
„Interessant ist, dass die Keilschriftzeichen auf diesem Entwurf mit denen auf der Glocke identisch sind. Auch auf dem Entwurf fehlt die untere Reihe der Keile, womit die Zeichen nicht mehr dieselbe Bedeutung haben wie auf der Tuschezeichnung. Das hier“, er wedelte mit dem Entwurf, „ist – Verzeihung – sinnloser Kram. Auf der Tuschezeichnung und der Computergrafik ergeben die Zeichen den Hinweis, dass diese Glocke ein Geschenk des Königs von Hattuša für den König von Taruiša ist“, erklärte Bluhm. Lupus wurde bleich.
„Das kann doch nicht sein!“, protestierte er.
„Nun ja, das könnte sein, wenn die Zeichnung meines Mandanten doch nicht von dem Foto Ihrer Mandantin abgepinselt wurde, sondern von der originalen Glocke, die Boris Trojan im Auftrag der Nazis untersuchte“, erwiderte Ralf spitz. „Die Frage ist dann nur: Wie können sich die Glocken des Entwurfs und der beiden Zeichnungen dennoch so sehr gleichen, wenn der Zeuge Brown steif und fest behauptet, er habe sie nach ein paar Anregungen aus diversen Museen außerhalb Griechenlands erfunden? Die Feststellung des Professors legt obendrein genau das nahe, was außer dem Zeugen Brown und Ihnen eigentlich jedem klar ist: Dass eine schlichte Abzeichnung vom Foto keineswegs das Ergebnis hätte, den nichtöffentlichen Entwurf des Zeugen fast exakt zu kopieren.“
„Sie vergessen dabei, dass es ja immer noch die Screenshots gibt, die Ihrem Mandanten zur Verfügung stehen!“, versetzte Lupus. Ralf seufzte.
„Verehrter Herr Kollege, die Glocke ist fraglos das Thema des Buches meines Mandanten. Aber dass er sich die Mühe machen würde, eine Glocke, die als recht gute Bilddatei auf der Webseite Ihrer Mandantin zu finden ist, derart zusammenzupuzzeln, ist ziemlich aus der Luft gegriffen – zumal das nicht funktionieren würde, wie der Zeuge Mönke recht überzeugend dargelegt hat.“
„Haben Sie noch Fragen an den Sachverständigen, Herr Rechtsanwalt Lupus?“, fragte der Richter.
„Ja, allerdings! Wie kommen Sie darauf, dass die Randverzerrungen, die das Sicherheitsglas hervorruft, bei einer Kopie direkt von diesem Foto auf jeden Fall übernommen würden?“, fragte Lupus.
„Ganz einfach: Ich habe das Foto meinen Studenten zum Abzeichnen vorgelegt. Vielleicht ist bekannt, dass Archäologen ihre Ausgrabungen in der Regel nicht nur fotografieren, sondern auch Zeichnungen der Lage ihrer Funde anfertigen. Ein gewisses Zeichentalent sollte ein Archäologe also mitbringen. Nachdem ich das Gutachten erstellt hatte, habe ich die Glocke vom Foto als Übung von meinen Studenten nachzeichnen lassen. Das hier sind die Ergebnisse“, sagte Roland Bluhm und entnahm seiner Aktentasche etwa zehn Bleistiftzeichnungen, die er dem Rechtsanwalt präsentierte.
„Alle meine Studenten haben die Glocke schlicht so abgezeichnet, wie sie da unter Glas steht. Keiner hat die Randverzerrungen ausgeglichen. Sehen Sie, Herr Rechtsanwalt.“
Lupus war wie vom Donner gerührt.
„Herr Professor, wie kommen Sie dazu, Ihren Gutachterauftrag zu überschreiten?“
„Wie bitte?“
„Ihr Auftrag lautete doch nicht, Ihre Studenten die Glocke testweise zeichnen zu lassen, sondern war klar umrissen zu ermitteln, ob die Zeichnungen mit der Gestalt der Glocke übereinstimmen. Wie kommen Sie dazu, diesen Auftrag zu überschreiten?“
„Ich sehe das eines keineswegs als Überschreitung des Auftrags an, denn die Glocke ist in der dargestellten Erscheinungsform zwar zu großen Teilen, aber eben nicht vollkommen identisch. Mir kam es seltsam vor, dass die Tuschezeichnung und die Computergrafik von dem Foto abgezeichnet worden sein sollten, aber die auf dem Foto klar erkennbaren Randverzerrungen nicht beinhalteten. Und weil meine Studenten das Zeichnen von Ausgrabungsfunden ohnehin üben müssen, habe ich ihnen dieses Foto als Übungsmaterial zur Verfügung gestellt. Solche Übungsarbeiten werden nicht veröffentlicht, also sehe ich darin keine Verletzung der Rechte Ihrer Mandantschaft – sofern sie überhaupt gegeben sind. Die genauere Untersuchung des mir jetzt erst bekannten Entwurfs lässt eher darauf schließen, dass Ihre Mandantschaft sich der Idee eines anderen bedient hat. Oder weshalb ist die Keilschrift am Fuß der Glocke nicht vollständig?“
„Lenken Sie nicht von Ihren Pflichtverletzungen ab!“, wetterte Lupus. „Sie haben ohne Genehmigung meiner Mandantschaft deren geistiges Eigentum Unbeteiligten zur Verfügung gestellt. Wie gedenken Sie, das auszugleichen?“
„Das gedenke ich nicht auszugleichen. Wenn ich mich recht entsinne, kann ich für Lehre und Forschung fremde Arbeiten in gewissen Grenzen als Lehrmaterial nutzen.“
„Ja, nach § 60a UrhG bis zu fünfzehn Prozent! Aber Sie übernehmen mal eben die ganze Glocke!“
„Das Urheberrecht umfasst doch den gesamten Film. Wie viel Prozent soll die Glocke denn im Film ausmachen?“, erkundigte sich Bluhm.
„Das reicht jetzt!“, fuhr der Vorsitzende Richter dazwischen. „Ob ein Anspruch gegen den Professor aus Urheberrechtsverletzung gegeben sein könnte, ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens! Das mag in einem anderen Verfahren geklärt werden. Aber ich gebe Ihrer Mandantschaft den Rat, Herr Rechtsanwalt, erst ein rechtskräftiges Urteil aus diesem Verfahren abzuwarten, bevor sie den nächsten mit Ansprüchen konfrontiert, die nach der aktuellen Entwicklung eher unwahrscheinlicher denn wahrscheinlicher werden. Haben noch Sie konkrete Fragen zum Gutachten, Herr Rechtsanwalt Lupus?“
„Nein.“
„Aber ich hätte noch eine Frage an den Herrn Rechtsanwalt“, meldete sich Bluhm zu Wort.
„Und was, bitte?“, erkundigte sich der Richter.
„Mir ist natürlich klar, dass ein Spielfilm keine historische Dokumentation ist. Aber mich wundert doch, dass sich der Konzeptzeichner für die Entwicklung einer Glocke, die im griechischen Mykene hängen soll, an allen möglichen Kulturen orientiert hat, nur nicht an der griechischen. Wieso nicht?“, fragte Roland Bluhm.
„Der Zeichner wollte etwas Einzigartiges entwerfen, das eben mit diesem Film in Verbindung gebracht werden sollte, aber nicht zwanghaft aus Griechenland stammt. Sie sagen ja selbst, dass ein Spielfilm keine historische Dokumentation ist“, erwiderte Lupus.
„Erlauben Sie mir die Frage, wo er sich die Anregungen geholt hat, die der Anwalt der Gegenseite erwähnte?“, erkundigte sich der Professor
„In diversen Museen. Paris, Louvre; London, British Museum; Berlin, Pergamon-Museum; Kairo, Ägyptisches Museum“, sagte Lupus.
„Er war nie in Griechenland? Hat sich kein griechisches Museum angesehen?“, hakte Bluhm nach.
„Nein, wieso sollte er?“
„Nun ja, wenn er eine griechische Glocke entwerfen soll, wäre das doch wohl die erste Wahl. Finden Sie nicht?“
„Herr Professor, Sie sind Archäologe. Der Zeuge Brown ist es nicht“, entgegnete Lupus.
„Nun, insbesondere, wenn jemand kein Spezialist für eine bestimmte Kultur und/oder Epoche ist, würde ich annehmen, dass er zunächst mal dort sucht, wo das herkommen könnte, was er entwerfen soll. Griechenland ist ja nicht Mittelerde, ist nicht fiktiv, sondern ein real existierendes Land mit real existierender Geschichte. Aber gut, Hollywood ist Hollywood“, sagte Bluhm. „Werde ich noch benötigt?“, wandte er sich dann an den Richter.
„Wenn keine weiteren Fragen an den Sachverständigen offen sind?“, fragte er, die Anwälte abwechselnd ansehend.
„Doch, ich hätte doch noch eine“, sagte Lupus.
„Bitte“, erwiderte der Richter.
„Herr Professor Bluhm, was sagt Ihnen der Name Professor Boris Trojan?“
„Nichts.“
„Wie, Sie kennen einen Berufskollegen nicht?“, hakte Lupus spöttisch nach.
„Ich unterstelle, dass auch Sie nicht alle Ihre Berufskollegen kennen, sondern nur die, mit denen Sie zu tun haben. Mit einem Professor Boris Trojan hatte ich bislang keinen Kontakt. An welcher Universität soll der in welchem Fach lehren?“
„In Berlin, Fach: Archäologie. Klingelt noch immer nichts?“
„Nein. Dort ist mir ein Professor Lieberknecht bekannt, aber kein Trojan.
„Danke. Interessant, dass Ihnen ein Professor, der eine wahrhaft bahnbrechende Entdeckung gemacht haben soll, nicht bekannt ist.“
„Was für eine bahnbrechende Entdeckung soll das gewesen sein und wann?“
„Tja, da sehen Sie es, Herr Kollege, Professor Trojan kennt nicht einmal ein Berufskollege. Was soll an dem wohl dran sein?“
„Ich verstehe Sie richtig, dass Sie die Existenz des Urgroßvaters meines Mandanten bezweifeln, Herr Kollege?“
„Genau das! Es gibt außer den Behauptungen von Zeugen, die dem Beklagten nahe stehen und ein grundsätzliches Interesse am Ausgang des Verfahrens haben, keinen Beleg für die Existenz dieses … Professors … der nicht einmal einem aktuellen Kollegen bekannt ist!“, versetzte Lupus.
„Sie übersehen dabei, Herr Kollege, dass Professor Trojan vor bald achtzig Jahren emeritiert wurde, weil seine Forschungsergebnisse missliebig waren. Sie sind nicht veröffentlicht worden. Wieso also sollte ein heute aktiver Professor der Archäologie den Verfasser einer Arbeit kennen, die nie veröffentlicht wurde, dessen andere Arbeiten wahrscheinlich vernichtet wurden, um ihn quasi zu löschen?“, hakte Schmidt nach. Lupus holte Luft, aber der Richter fuhr dazwischen.
„Moment, die Herren Rechtsanwälte! Wenn die Existenz einer Person in Zweifel gezogen wird, wäre ein Beweisantrag der einfachste und beste Weg. Aber mir erscheint dies eher als Nebenkriegsschauplatz, solange nicht geklärt ist, wieso ist die Keilschrift auf dem Entwurf des Zeugen Brown unvollständig, aber auf der Zeichnung des verstorbenen Zeugen Trojan sinnergebend vollständig, wenn diese nach Ansicht der Klägerin vom Foto der Glocke kopiert wurde. Ist der Zeuge Brown noch da?“
Der Gerichtsdiener verließ den Gerichtssaal und kehrte nur Sekunden später zurück.
„Draußen ist keiner mehr“, sagte er.
„Ärgerlich, dazu hätte ich ihn gerne nochmals befragt“, brummte der Richter. „Wissen Sie dazu etwas, Herr Rechtsanwalt Lupus?“
„Was meinen Sie? Wo der Zeuge ist?“
„Nein, ob Ihnen erklärt worden ist, weshalb die Keilschriftzeichen auch auf dem Entwurf unvollständig sind, während die von Ihrer Mandantschaft als Kopie bezeichnete Zeichnung einen sinnvollen Satz in hethitischer Sprache enthält?“
Simeon Lupus schluckte.
„Dass die Inschrift unvollständig sein soll, hat sich erst durch die weitere Besprechung zum Gutachten ergeben. Dazu habe ich derzeit keine Information meiner Mandantin. Insofern kann ich das nicht aus dem Stand erklären“, räumte der sonst so bissige Anwalt ein.
„Das Gutachten war Ihnen bekannt, denn es wurde vor dem Termin an die Parteien versandt“, entgegnete der Richter.
„Ja, aber im Gutachten ist ja die Möglichkeit offen, ob die Randverzerrung da nicht Zeichen verschluckt hat“, gab Lupus zu bedenken.
„Hätte ich den Entwurf von der Klägerin bekommen, hätte ich diese Frage nicht offen lassen müssen, Herr Rechtsanwalt“, schaltete sich Bluhm ein. „Den hat Ihre Mandantin aber nicht herausgerückt, so dass ich ihn erst im Termin einsehen konnte. Aber auch wenn wir annehmen wollen, dass hier ein Fehldruck des Entwurfs vorliegen sollte: Mir wäre dann immer noch schleierhaft, weshalb eine Inschrift auf ein Geschenk des Königs von Hattuša an den König von Taruiša erwähnt und nicht an den König von Mykene. Ich kenne den Film Ihrer Mandantin. Darin ist jedenfalls keine Rede davon, dass diese Glocke mal in Troja erbeutet worden wäre. Der Film Ihrer Mandantin kehrt die Ereignisse der Ilias und der Odyssee doch nur dahingehend um, dass ein mykenischer Prinz eine trojanische Prinzessin zur gemeinsamen Flucht überredet und der König von Troja deshalb mithilfe von Skythen und Hethitern Mykene angreift.“
Richter Dr. Marquardt nickte.
„Das Gericht fasst folgenden Beschluss: Der Klägerin wird nahegelegt, die Klage zurückzunehmen, da es nach der mündlichen Verhandlung nicht als bewiesen angesehen werden kann, dass der Beklagte tatsächlich das Requisit der Klägerin für die Titelillustration seines Buches Die Glocke des Todes verwendete und diese widerrechtlich nutzte, weil er sich kein Nutzungsrecht im Sinne von § 31 einräumen ließ. Für den Fall, dass die Klägerin auf der Fortsetzung des Verfahrens besteht, wird der Klägerin wird aufgegeben
- a) zu erklären, weshalb es zu der Keilschrift am unteren Ende gekommen ist, die auf einen gänzlich anderen Kulturraum als den griechischen hinweist.
- b) darzulegen und zu beweisen, woher der Konzeptzeichner Sprachkenntnisse des Hethitischen hat, wenn er selbst vorträgt, weder Historiker noch Archäologe zu sein.
Für die Rücknahme der Klage bzw. die Erfüllung der gerichtlichen Vorgaben wird der Klägerin eine Frist von einem Monat nach Zugang des Protokolls eingeräumt.
Die Sitzung ist geschlossen“, verkündete er.
Kapitel 7
Szenenwechsel
Jonas schloss die Augen und atmete erkennbar auf. Ralf klopfte ihm auf die Schulter, während Simeon Lupus beinahe schnaubend aus dem Raum stürmte.
„Sieht so aus, als gefiele dem Klägervertreter die Entscheidung nicht so recht“, mutmaßte Roland Bluhm mit sanftem Lächeln.
„Garantiert nicht. Zehntausend Euro plus x lässt man sich nicht so einfach aus der Nase gehen“, seufzte Jonas. „Ich kenne ihn beruflich und habe den leisen Verdacht, dass er irgendwas aus dem Hut zaubern wird, um den Anspruch seiner Mandantschaft doch noch durchzusetzen.“
„Herr Mönke, diese Glocke … wenn es sie wirklich gibt, wäre es eine wissenschaftliche Sensation“, bemerkte Bluhm.
„Ich denke, das hat mein Urgroßvater wahrscheinlich auch gedacht, als er ermittelt hat, dass diese Glocke von Troja über Sarmatien und die Weichsel irgendwann nach Vineta geraten ist“, erwiderte Mönke.
„Was ist mit dieser Glocke geschehen? Ihr Urgroßvater hat sie ja nach den Worten Ihres Anwaltes untersucht“, hakte Bluhm nach. Jonas zuckte mit den Schultern.
„Keine Ahnung. Sie soll im Museum für Hamburgische Geschichte gewesen sein. Dort soll mein Urgroßvater sie auch fotografiert haben. Aber wir haben keine Ahnung, wo seine Forschungsergebnisse abgeblieben sind.“
Er räumte seine Unterlagen zusammen und verließ mit Ralf, seinen Eltern und dem Archäologen den Gerichtssaal.
„Wenn ich mir die Umstände so überlege …“, setzte Bluhm an. „Die Glocke, die Sie nach der Tuschezeichnung digitalisiert haben, muss ein konkretes Vorbild gehabt haben. Verzeihen Sie die Frage: Was sind Sie von Beruf?“
„Ich bin Versicherungskaufmann und arbeite für eine Versicherung hier in Hamburg. Schreiben ist nur mein Hobby“, sagte Jonas. „Mein Großvater Hinnerk Trojan war Fischer und ein grandioser Geschichtenerzähler. Ich schwöre Ihnen, dass weder er noch ich eine blasse Ahnung hatten, was die Keilschriftzeichen am unteren Ende der Glocke bedeuten – ob sie überhaupt etwas bedeuten. Mein Urgroßvater war der Experte, der konnte damit offensichtlich etwas anfangen, denn sonst hätte er nicht die Spur der Glocke bis nach Troja verfolgen können.“
„Und Sie sind sicher, dass kein Foto dieser Glocke öffentlich bekannt ist?“, fragte Roland weiter.
„Langsam kommt mir der Verdacht, dass irgendwas davon bekannt sein muss“, meinte Jonas. „Mir ist es wirklich ein Rätsel, wie der Produktionsdesigner haarscharf diese Glocke treffen konnte. Bislang habe ich immer angenommen, dass es noch weitere Glocken wie jene geben müsste. Seit Ihrer Feststellung, dass es sie nicht gibt und wegen dieses haarsträubenden Kulturmixes eigentlich auch nicht geben kann, bin ich mir dessen nicht mehr sicher. Normalerweise kann es nicht so einen Zufall geben, dass jemand von diesen kleinen Abweichungen abgesehen dieselbe Glocke entwirft.“
„Was werden Sie tun?“, fragte Bluhm.
„Ich weiß es noch nicht. Zunächst hoffe ich, dass Agamemnon Productions die Klage zurücknimmt. Der Richter hat sich so angehört, dass er anderenfalls die Klage abweisen wird.“
„Sie sprachen von Vineta. Vineta ist kein sagenhafter Ort. Es hat ihn gegeben, auch wenn bis heute nicht ganz klar ist, wo genau an der Ostsee. Kap Arkona, Rügen und Koserow auf Usedom sind als Orte genannt worden. Ich weiß, dass die Marine 1937/38 vor Kap Arkona geforscht hat. Der Regisseur von Mykene, Peter Wolfson, ist Deutscher. Und wenn ich mich jetzt nicht völlig in der Person irre, ist er zwar in Aurich geboren, hat aber seine Kindheit in Mecklenburg verbracht, weil sein Vater als Marineoffizier in Mecklenburg stationiert war“, sagte der Professor. „Wäre es eventuell denkbar, dass Wolfsons Vater mit Ihrem Urgroßvater an der Forschung beteiligt war? Dass sein Sohn vielleicht etwas von dem zu sehen bekommen hat, was Wolfson senior und Ihr Urgroßvater gefunden haben? Dass er sich Notizen gemacht hat oder vielleicht selbst die Glocke fotografiert hat und sein Sohn dieses Foto seinem Produktionsdesigner gegeben hat. Wenn das Foto den unteren Rand nicht ganz abgebildet hat, könnte das die Erklärung für die fehlende Keilschriftzeile sein.“
„Danke für die Anregung. Ich werde mal forschen. Ein bisschen Zeit haben wir ja“, bedankte sich Jonas.
„Wenn Sie etwas zu der Glocke erfahren, wäre ich sehr daran interessiert, sie zu finden. Es wäre wirklich eine Sensation. Und wenn dabei auch noch ein ehemaliger Archäologie-Professor rehabilitiert werden kann, bin ich auf der Stelle dabei“, erklärte Bluhm. Jonas lächelte.
„Sie sehen nicht nur aus wie mein Lieblingsritter, Sie scheinen auch aus dem Holz des ehrenhaften Ritters geschnitzt zu sein“, sagte er. Bluhm zwinkerte schelmisch.
„Mit einer Arbeit zu Crusade habe ich meine Habilitation bekommen. Die Kreuzzüge sind mein Spezialgebiet.“
„Wissen Sie was? Sie machen mir gerade Lust auf ein Archäologiestudium“, sagte Jonas. „Aber ich muss noch ein bisschen dafür sparen, wenn ich meinen Eltern nicht wieder auf der Tasche rumliegen will.“
Das Protokoll der mündlichen Verhandlung hatte Jonas am 22. Mai in der Post. Mit der darin gesetzten Frist von vier Wochen konnte die Agamemnon-Filmgesellschaft bis zum 19. Juni 2013 entscheiden, ob sie die Klage zurücknahm oder die verlangten Belege beibrachte, um den Prozess fortzusetzen.
In dieser Zeit nahm seine normale Arbeit ihn wieder weitgehend in Anspruch. Die Urlaubszeit nahm Fahrt auf – und damit auch urlaubsbedingte Abwesenheit von Kollegen und deutlich mehr Unfallschäden auf den Straßen, was auch mehr Arbeit in der Schadenabteilung der Sperling-Assekuranz bedeutete.
Am 29. Mai sollte der Film Herero mit Jonathan Blanchard in einer der beiden Hauptrollen in Hamburg im Cinemaxx am Dammtor Premiere haben und ab dem 30. Mai regulär laufen. Zu dieser Premiere wollte Jonathan Blanchard nach Hamburg kommen. Für Jonas als erklärten Fan dieses Schauspielers war ein Besuch der Premiere schon so etwas wie heilige Pflicht – vor allem, wenn sie auch noch vor seiner Haustür stattfand. Das war vielleicht eine Gelegenheit, weitere Forschung in Sachen Mykene zu betreiben, aber dafür musste er mit Blanchard mehr reden können, als bei der Autogrammstunde für die Fans vor oder nach der eigentlichen Premiere.
Jonas ging zu seinem Chef und fragte, ob er trotz der Urlaubszeit am 29. Mai einen Tag freihaben könnte oder wenigstens einen halben Tag, damit er zur Premiere gehen konnte, die am frühen Nachmittag sein sollte. Gunnar Mahnke, der schon anhand der Filmplakate, die Jonas in seinem Büro hängen hatte, ahnen konnte, was dieser Schauspieler seinem Mitarbeiter bedeutete, gab sein Okay, auch, damit Jonas sich nach der Aufregung um den Prozess wieder etwas entspannte.
Als nächstes rief Mönke beim Felder-Verlag an, der auch Zeitschriften, Magazine und Begleitbücher zu Filmthemen herstellte. Chef der Magazinabteilung des Felder-Verlags war Stefan Diener, der schon zu Mykene über den Verlag ein Begleitbuch herausgegeben hatte, für das er auch Interviews mit den Produktionsbeteiligten geführt hatte und eine Internetplattform betrieben hatte. Über diese Plattform hatte Jonas zu ihm Kontakt bekommen, was der Veröffentlichung seines Buches ordentlichen Schub verpasst hatte. Jonas hatte für Felder Artikel zu Alexander von Arsuf geschrieben, dem historischen Vorbild des Barons Balduin von Caymont im Film Crusade, den ebenfalls Blanchard gespielt hatte und wollte gern ein Interview zu dessen neuer Rolle in Herero mit Jonathan Blanchard machen.
„Klar, ich besorg‘ dir den Termin“, sagte Diener am Telefon und rief zwei Stunden später zurück.
„Termin gebucht für Mittwoch, den 29. Mai 2013 um 14.30 Uhr vor dem Cinemaxx. Komm nach der Arbeit zu mir und hol dir den Presseausweis ab“, sagte Diener.
„Bin um vier bei dir“, erwiderte Jonas und hüpfte fast vor Freude. Mit seinem erklärten Lieblingsschauspieler sprechen zu können, war wie die Eintrittskarte ins Paradies.
Am 29. Mai stand er mit vor Aufregung hämmerndem Herzen vor der Lobby des Cinemaxx-Kinos am Dammtor-Bahnhof in Hamburg in einer hauptsächlich von Frauen und Mädchen dominierten Menschenmenge. Jonathan Blanchard galt als einer der bestaussehendsten aktiven Schauspieler der Welt. Seine Fangemeinde bestand schon deshalb hauptsächlich aus weiblichen Wesen, weil Männer ihn eher um sein Aussehen und seinen Erfolg beneideten und deshalb nach Dingen bei ihm suchten, die sie selbst besser machten. Jonas gehörte zu den wenigen Männern, die in Blanchard und seinen Rollen passable Vorbilder sahen, denen nachzueifern sich lohnte. Jonas beobachtete, wie Blanchard auf einem Motorrad vom Dammtordamm den Fußweg zum Kino hinauffuhr und sich mit dem ihm eigenen freundlichen und unwiderstehlichen Lächeln seinen Fans präsentierte, während die Rufe und das Gekreische der Frauen und Mädchen zu einem unglaublichen Crescendo anschwoll, dass man schier seine eigenen Gedanken nicht mehr verstehen konnte. Fotohandys, Poster und Autogrammkarten reckten sich dem Briten entgegen, der mit wahrhaft buddhistischer Geduld Autogramme gab, kleine Geschenke von seinen Fans entgegennahm, mit ihnen Selfies machte, bis der Beauftragte der Produktion ihn auf den nahen Premierentermin hinwies.
„I’ll be back!“, versprach er seinen Fans und ging winkend die Freitreppe hinauf. Auf dem Weg erklärte der Produktionsmanager, dass er nach der Premierenvorstellung noch Interviews geben und dann den Flieger nehmen müsse, so dass für weitere Autogramme keine Zeit sein würde.
„It’s Jackie’s plane. I may fly on my own schedule, sir. These people are my fans. Without them there will be no box office!“, erwiderte Blanchard als Hinweis darauf, dass das Flugzeug, das ihn im Geschäftsfliegerzentrum Hamburg erwartete, seinem Freund und Kollegen Jack Pearl gehörte, mit dem zusammen er in der Black-Dutchman-Trilogie gespielt hatte und dass es die Fans waren, deren Geld das Ergebnis im Box-Office ausmachte – oder auch nicht, wenn man sie verprellte. Er war auch bekannt für sein gut verständliches Englisch. Theaterschauspieler – das hatte er an der Schauspielschule in London gelernt – sprachen deutlich und nur mit dem Akzent, den sie sprechen wollten. Jonathan Blanchard beherrschte diverse Akzente und galt als einer der wenigen britischen Schauspieler, die auch verschiedene amerikanische Akzente beherrschten. Im aktuellen Film Herero sprach er im englischen Original mit südafrikanischem Akzent.
Jonas Mönke, der nicht weit entfernt bei den Pressevertretern stand, hätte in diesem Moment Stein und Bein geschworen, dass dieser Mann als Archäologieprofessor im Gerichtssaal gewesen war, hätte er deutsch gesprochen. Der Film, der an diesem Tag Deutschland-Premiere hatte, war ein Krimi der groben Sorte, der erst ab 18 Jahren freigegeben war. Jonas hatte sich deshalb auch ausweisen müssen.
Bei den auf Englisch geführten Interviews nach der Premiere erfuhr er im Grunde nur das, was er auch schon aus den Netzwerken wusste, die sich mit Jonathan Blanchard befassten. Als er Gelegenheit hatte, selbst Fragen zu stellen, sagte er:
„Vielen Dank, Sir. Mr. Blanchard, erlauben Sie auch Fragen zu früheren Filmen?“, fragte Jonas auf Englisch.
„Es ist selten, dass ich auf Promo-Tour zu einem Film zu früheren Filmen befragt werde, aber fragen Sie gerne“, erwiderte Blanchard. Jonas stellte Fragen zu Crusade, der auch in Deutschland unter dem Originaltitel gelaufen war, dann zu Mykene.
„Als einer der Hauptdarsteller von Mykene gefragt: Woher hatten die Produktionsverantwortlichen eigentlich die Glocke? Die sah ja eher nach Kleinasien oder gar nach dem weiteren Asien aus“, erkundigte sich Jonas mit vor Aufregung erneut hämmerndem Herzen.
„Ganz ehrlich: keine Ahnung. Die Bauten, die Kostüme und die Requisiten sind toll, aber bei Dreharbeiten beschäftige ich mich dem Drehbuch und der Entwicklung meiner jeweiligen Rolle. Klar, das Kostüm unterstützt die Rolle ebenso wie die Kulissen. Das versetzt einen als Schauspieler in die passende Zeit. Aber woher die Designer die Ideen haben, das weiß ich nicht“, erwiderte Blanchard lächelnd.
„Bildhauerei gilt als eines Ihrer Hobbys. Haben Sie schon mal selbst etwas zur Ausstattung beigetragen?“, hakte Jonas nach.
„Nein, das überlasse ich den Profis“, entgegnete der Schauspieler.
„Schade. Ich hätte so gern den Ring, den Sie als Balduin von Caymont getragen haben. Da hat man uns Fans mit Repliken leider sehr kurz gehalten“, erwiderte Jonas. Blanchard lächelte auf seine ihm eigene Art.
„Da lässt sich bestimmt was machen. Soviel ich weiß, ist hier in Hamburg ja mal eins von meinen Kostümen unter die Leute gebracht worden“, sagte er. „Geben Sie mir Ihre Adresse und ich rede mal mit Richard, damit er eine Replik von dem Ring macht.“
„Oh, das wäre genial. Was wird das kosten?“
„Sie sind wirklich ein Fan, das erkenne ich aus Ihren Fragen zu anderen Filmen als dem aktuellen. Es wird Sie nichts kosten, das verspreche ich Ihnen. Ich regle das mit Richard“, sagte Blanchard.
„Richard? Etwa Richard Taylor? Der von Weta?“, hakte Jonas nach.
„Ja, der. Weta hat auch für Crusade und Mykene gearbeitet.
„Ob Mr. Taylor vielleicht was über den Ursprung der Glocke weiß?“
„Ich werde ihn fragen. Und wenn er etwas weiß, bekommen Sie die Antwort mit dem Ring“, versprach Blanchard „Auch wenn ich diesen Ritter nur gespielt habe, ist von seinem ehrenhaften Charakter hoffentlich ein wenig an mir hängengeblieben.“
„Dann trifft es zu, dass Sie aus Ihren Rollen immer etwas für sich mitnehmen, aber auch etwas von sich hineingeben?“, hakte Jonas nach.
„Ich versuche es. Meist gelingt es auch. Nur die spitzen Ohren aus der Mittelwelt-Serie, die muss ich mir immer noch ankleben“, lachte Blanchard.
„Dafür haben Sie ja richtig Bogenschießen gelernt. Können Sie es immer noch?“
„Das konnte ich bei den Dreharbeiten zur zweiten Trilogie feststellen. Es brauchte nur einen kurzen Anlauf, dann habe ich wieder getroffen.
„Wie sehr hat Ihnen dieses Training für Mykene genutzt?“
„Ja, keine Frage. Prinz Alexaris ist ja auch so ein Ausnahmebogenschütze, auch wenn er das nur kurz zeigen darf“, bestätigte Blanchard.
„Wie schwierig ist es, wenn man fechten kann und dann so zu tun, als ob man es nicht kann?“, fragte Jonas. „Für Ihre Piratenrolle in Black Dutchman habe Sie ja fechten gelernt.“
Blanchard lachte herzlich.
„Sagen wir, es ist einfacher, so zu tun, als könne man etwas nicht, als vorzugeben, dass man etwas kann.“
„Dann haben Sie auch richtig schmieden gelernt?“, fragte Jonas. „In Ihrer Filmografie gibt es gleich zwei Schmiede.“
„Bei Black Dutchman war es noch rudimentär. Ich hatte auch noch nicht die Muskulatur, die ich mir für Crusade antrainiert habe. In Crusade musste ich den Hammer anders – auch mehr – schwingen als in Black Dutchman. Dafür habe ich es richtig gelernt, stimmt“, bestätigte Blanchard.
„Würden Sie die Rolle des Alexaris eigentlich nochmal spielen wollen?“
„Ja, wenn die Story und das Drehbuch gut sind, bin ich zu fast allen Schandtaten bereit.“
„Auch eine Fortsetzung von Crusade?“
„Wenn man mich lässt – und das Drehbuch gut ist – natürlich.“
Jonas kramte in seiner Tasche und zog zwei Bücher heraus: Die Glocke des Todes und Das Erbe Caymonts.
„Vielleicht kann Ihnen das jemand ins Englische übersetzen. So gut bin ich darin leider noch nicht, dass ich das könnte“, sagte Jonas entschuldigend.
„Wow!“, entfuhr es Blanchard. „Und die gibt’s nicht auf Englisch? Ich gebe das – wenn Sie erlauben – an meinen Agenten. Bei Disney gibt es ja auch eine Lizenzabteilung, in der deutsche Muttersprachler sitzen. Die können mir das gewiss übersetzen. Schreiben Sie viel?“
„Na ja, das ist mein Hobby, auch wenn ich einen ganz anderen Beruf habe“
„Sie hätten auch was zu Black Dutchman?“, hakte Blanchard nach.
„Das kann ich leider nicht veröffentlichen. Ich will da keinen Ärger haben“, erwiderte Jonas. „Das Erbe Caymonts habe ich vom Text bis zum Bucheinband selbst hergestellt. Es ist kein veröffentlichtes Buch.“
„Aber Sie hätten etwas“, stellte Blanchard fest. Jonas nickte.
„Schicken Sie mir das an diese Adresse“, sagte Blanchard und gab Jonas eine Karte mit der Anschrift seines Agenten. „Berufen Sie sich auf das heutige Gespräch. Fans denken meist viel weiter als die Ursprungsautoren. Elliott und Ross wären über neue Anregungen bestimmt erfreut.
„Auch wenn James Dolphin nur eine kleine Rolle hat, Will Sparks aber die wesentlich größere?“, fragte Jonas eingedenk der Tatsache, dass James Dolphin als der Pirat schlechthin galt, seit Black Dutchman diesen völlig unerwarteten Erfolg gehabt hatte. Über Blanchards Gesicht huschte ein Schatten.
„Sie haben sicher mitbekommen, dass Jack Pearl als James Dolphin eigentlich die zweite Geige spielen sollte, aber mit seiner unglaublichen Darstellung den Film schlicht gekapert hat. Ich weiß, dass es ohne diese geniale Darstellung niemals der Erfolg geworden wäre, der es ist, gerade weil er so ungewöhnlich ist. Deshalb war es mir auch so wichtig, Will im dritten Teil von seinem Heldensockel zu holen. Helden sind langweilig“, sagte er.
„Nein, sind sie nicht!“, widersprach Jonas heftiger, als er eigentlich wollte. „Sie engagieren sich für UNICEF, für Kinder. Wenn Kinder lernen sollen, das Richtige zu tun, für Hilflose einzutreten, dann braucht es im Kino Helden. Richtige Helden. Helden dürfen Fehler machen – wie der Baron von Caymont, der eine Intrige nicht mitmachen will, weil sie gegen dem Rittereid verstößt, der aber feststellen muss, dass seine Ehrenhaftigkeit einige hundert oder tausend Menschen mehr das Leben kostet als die Intrige, die dem wahren Intriganten galt.“
Blanchard fand sein Lächeln wieder und nickte.
„Bravo, Sie haben sich wirklich mit meinen Filmen befasst. Das macht mich jetzt richtig neugierig, was sich zwischen diesen Buchdeckeln befindet. Und wenn Sie wirklich was zu Will Sparks haben: her damit! Vielleicht verstehen Sie es besser, eine richtige Heldenrolle zu schreiben. Dann wäre es mir eine Ehre, auch wieder einen Helden zu spielen.“
„Mr. Blanchard, auch wenn Sie einen Privatflieger haben: Er muss in L.A. noch runter. Draußen warten immer noch die Fans auf Autogramme“, erinnerte der Produktionsmanager.
„Ja, danke. Sorry, ich muss jetzt leider los. Es war mir ein Vergnügen, Mr. Monke“, sagte er zu Jonas. Die eigentlichen Journalisten waren längst fort, interessierte sie doch nur der aktuelle Film.
„Kommen Sie irgendwann mal in die Staaten?“, fragte Blanchard, als er mit Jonas zusammen zum Foyer ging. „Falls es Sie nach Los Angeles verschlagen sollte, melden Sie sich einfach mal hier“, sagte er und tippte auf die Adresse auf der Visitenkarte. „Das ist meine Agentur. Ich werde hinterlassen, dass man einen Termin mit mir macht. Ich würde mich gern länger mit Ihnen unterhalten.“
„Danke“, sagte Jonas. Er hatte das Gefühl, auf Wolken zu schweben. Er hatte nicht nur mit seinem Lieblingsschauspieler sehr ausführlich reden können, er hatte auch dessen Interesse an seiner Arbeit geweckt. Mehr ging für einen erklärten Fan nicht. In seinem Anliegen, etwas über den Ursprung der Glocke zu erfahren, war er zwar noch nicht weitergekommen, aber er vertraute darauf, dass Jonathan Blanchard Wort halten würde und Richard Taylor Auskünfte geben würde.
Das Interview zum aktuellen Film würde noch ein paar Euro einbringen, von denen aber kaum etwas bleiben würde, wenn das Finanzamt die Steuern dafür berechnete.
Kapitel 8
Forschung
Roland Bluhm hatte inzwischen Kontakt mit den Museen aufgenommen, die Marcus Brown als Inspirationsquellen genannt hatte. Am 15. Juni hatte er von allen die Antworten. In keinem der Museen hatte jemand für eine Filmproduktion nach Glocken gefragt. Es waren auch keine Glocken dieser Größenordnung im fraglichen Zeitraum ausgestellt gewesen.
Der Professor sah sich den Film selbst auf DVD an, diesmal allerdings mit den Augen des Wissenschaftlers. Er suchte auch nach Kritiken dazu und fand eine, die er seinerzeit schlicht ignoriert hatte, weil dieser Kritiker den Film wegen seiner wenig griechischen Ausstattung regelrecht zerfetzt hatte – die eines Julius Wehmeyer von der Hamburger Abendpost. Bluhm suchte die Telefonnummer der Redaktion heraus und rief dort an.
„Bluhm ist mein Name. Für Sie arbeitet Herr Julius Wehmeyer. Wie kann ich den erreichen?“, fragte er.
„Wieso wollen Sie ihn kontaktieren?“, erkundigte sich die Mitarbeiterin der Redaktion.
„Ich bin Archäologe. Es geht um eine Filmkritik zu dem Film Mykene von 2004, deren Ausstattung er damals bemängelt hat. Wenn ich es recht verstehe, hatte er seinerzeit Kontakt zum Produktionsdesigner. Die Glocke, die der damals entworfen hat, könnte zu meinem Forschungsgebiet Kleinasien passen und ähnelt einer angeblich real existierenden, aktuell verschollenen Glocke. Deshalb würde ich gern mit Herrn Wehmeyer sprechen“, erklärte der Professor.
„Moment, bitte“
Es knackte.
„Wehmeyer!“, knurrte der Redakteur in einem Tonfall ins Telefon, der deutlich machte, dass er sich gestört fühlte.
„Guten Tag, Herr Wehmeyer. Ich bin Professor Bluhm von der Universität Hamburg. Vielleicht erinnern Sie sich an eine harsche Filmkritik, die sie zu Peter Wolfsons Film Mykene verfasst haben?“, meldete sich Roland.
„Ist ‘ne Ewigkeit her. Was ist damit?“, brummte Wehmeyer eher unfreundlich.
„Sie hatten damals Kontakt mit dem Produktionsdesigner. Was hat er Ihnen gesagt, woher er das Muster hatte?“
„Oh, hol’s der Geier! Mann! Das ist ‘ne Ewigkeit her!“, grollte der Journalist.
„Ja, neun Jahre. Aber es wäre eine Sensation, wenn er es von einer Glocke hatte, die Gerüchten zufolge in Kleinasien gefunden wurde, aber seit einer Ausstellung in einem Hamburger Museum während des Krieges verschollen ist. Ich gehe diesen Gerüchten nach. Vielleicht hat er Ihnen etwas dazu gesagt“, warb Bluhm um die Aufmerksamkeit des Zeitungsmannes.
„Muss ich im Archiv suchen. Wie kann ich Sie erreichen?“, fragte Wehmeyer. Bluhm gab ihm seine Mobiltelefonnummer und bat um Rückruf.
Britta Mönke sichtete derweil die Dokumente, die ihr Vater hinterlassen hatte, während Bernd Mönke im Internet nach Eintragungen zu Professor Boris Trojan suchte, so unwahrscheinlich es auch erschien, dass ein fast achtzig Jahre zuvor von den Nazis aus dem universitären Gedächtnis gelöschter Mann in diesem neuen Medium Spuren hinterlassen haben konnte.
„Wat dat nich‘ all’ns gifft. Ich glaub‘, mein Hamster bohnert! Britta-Schatz, seh dir das mal an!“, rief er nach seiner Frau.
„Ja, was denn?“, grummelte sie unwirsch und tauchte aus den Papieren ihres Vaters auf.
„Erbe gesucht! Stadtbibliothek Aurich sucht Erben von Boris Trojan!“, las er glucksend vor. „Öffentliche Bekanntmachung. Die Stadtbibliothek Aurich hat im Archiv ein 1968 gestiftetes, unveröffentlichtes Manuskript entdeckt, das den Erben des Autors übergeben werden soll. Das ist ein Eintrag von 2004. Einfach mal so rausgeschossen! Wieso haben die das so gemacht?“
„Die haben uns nicht finden können“, mutmaßte Britta. „Gib mir mal die Telefonnummer.“
Bernd nannte ihr die Nummer, Britta schrieb sie sich auf und wählte sie dann auf ihrem Mobiltelefon.
„Stadtbibliothek Aurich, guten Tag“, meldete sich die dortige Mitarbeiterin in der Telefonzentrale.
„Moin, Mönke hier, geborene Trojan. Ich sehe hier im Internet, dass Sie Erben von Boris Trojan bitten, sich bei Ihnen zu melden, weil Sie ein Manuskript von ihm haben, das sie weitergeben wollen“, sagte Britta.
„Moment, ich verbinde Sie mit dem Archiv“, sagte die Telefonistin und stellte sie weiter.
„Thamsen, Archiv“, meldete sich Sekunden später eine männliche Stimme.
„Tag, Herr Thamsen. Mönke mein Name, geborene Trojan. Sie haben in Ihrem Archiv ein Manuskript meines Großvaters Boris Trojan, für das sie seit Jahren den rechtmäßigen Eigentümer suchen. Gefunden.“
Einen Moment war Pause. Archivar Thamsen schien überrumpelt zu sein.
„Ich … unterstelle, dass … dass Sie das entsprechend belegen können, Frau … wie war doch Ihr Name?“
„Mönke.“
„Ja, Frau Mönke. Am Telefon ist das nicht zu klären. Ich muss Sie bitten, herzukommen und das hier persönlich nachzuweisen“, erwiderte Thamsen.
„Kein Problem, Herr Thamsen. Bis wann ist heute jemand da?“
„Kommen Sie morgen vor zwölf Uhr und bringen Sie Ihre Unterlagen mit.“
„Okay, danke, bis morgen. Tschüß.“
„Was is‘ los?“, hakte Bernd nach. „Ich hab‘ morgen einen Termin im Arboretum Ellerhoop“, erinnerte er.
„Kannst du auch wahrnehmen. Ich fahre allein nach Aurich“, erwiderte Britta.
„Jonas wollte mit und ich wäre auch gern mitgekommen“, maulte er.
„Jonas muss seine Schäden bearbeiten. Der kann nicht mal eben mitten in der Urlaubszeit nach Aurich ausbüxen“, erinnerte sie. „Fahr‘ du nach Ellerhoop. Du hast deine Termine, ich meine, mein Schatz.“
„Und was ist mit der Ferienwohnung?“
„Die ist bis September komplett ausgebucht, diese Woche ist kein Wechsel. Ich schalte den Anrufbeantworter ein. Falls sich doch jemand meldet, rufe ich zurück, wenn ich wieder hier bin.“
Am folgenden Morgen fuhr Britta Mönke morgens um sechs nach Aurich, das sie infolge des Berufsverkehrs um Hamburg und Bremen gegen halb zehn erreichte. Bei sich hatte sie die Geburts- und Sterbeurkunde ihre Vaters, ihre eigene Geburtsurkunde und den Bericht des Roten Kreuzes, nach dem Hannes Trojan Ende Januar 1945 in der Schlacht um Breslau gefallen war. Sie hatte auch die Verfügung der DDR-Regierung dabei, dass die beiden Grundstücke, die im Grundbuch von Koserow ursprünglich als Eigentum von Boris Trojan eingetragen gewesen waren und seinem Sohn Hinnerk als einzigem Erben übertragen worden waren, als Volkseigentum eingezogen wurden.
Sie ließ sich beim Archivar Thamsen mit Hinweis auf das Telefonat vom Vortag melden und legte ihm die Urkunden vor.
„Bitte“, sagte sie, „das Stammbuch meiner Eltern, in dem ich als einziges Kind eingetragen bin, Geburts- und Sterbeurkunde meines Vaters, die seines Bruders und die Enteignungsverfügung der DDR-Regierung bezüglich der Grundstücke, die mein Vater geerbt hatte. Damit dürfte bewiesen sein, dass ich die rechtmäßige Erbin des Manuskriptes bin, das der Bibliothek gestiftet wurde. Bitte, übergeben Sie es mir.“
Thamsen prüfte die Dokumente.
„Jau, dat is‘ in Or’nung“, sagte er. „Bidde“, fügte er hinzu und händigte Britta Mönke die Archivkassette mit dem Manuskript aus.
„Eine Frage noch: Wer hat Ihnen das gestiftet?“, erkundigte sie sich.
„Das is‘n Brief mit drin von einem Kapteenleutnant Wolfson. Können Sie sich vorne kopieren. Der muss als Nachweis hierbleiben, dass wir das Manuskript an den Erben herausgeben sollen. Bringen Sie mir das nachher bidde wieder mit. Kopierer is‘ in’er Präsenzbibliothek. Bidde auch ’ne Kopie vom Deckblatt des Manuskripts machen und draufschreiben, dass Sie es erhalten haben. Und da bitte mit Datum unterschreiben“, sagte der Archivar und wies auf eine Entleiherliste im inneren Deckel der Kassette.
„Mach‘ ich“, erwiderte Britta und ging mit der Archivkassette in die Präsenzbibliothek, um sich die Dinge genauer anzusehen und das Stiftungsschreiben zu lesen. Sie fand einen Tisch, um den herum nichts los war und öffnete die Kassette. Darin befand sich ein praktisch druckfertiges Manuskript, einseitig beschrieben, damit es gegebenenfalls für abweichende Umbrüche zerschnitten werden konnte. Überschrieben war es mit den Worten
Die Vineter und ihre Kultgegenstände
Professor Boris Trojan, Berlin
Hinter dem gehefteten Manuskript war ein einzelnes Blatt Papier, in der Mitte geknickt, womit es die gleiche Größe hatte wie das Manuskript. Britta faltete es auseinander und hatte den Stiftungsbrief in der Hand. Er lautete:
Hamburg, den 15. Juni 1968
Sehr geehrte Herren!
Als Anlage erhalten Sie ein Manuskript des zwangsemeritierten Professors Boris Trojan bezüglich der Vineter und ihrer Kultgegenstände. Herr Professor em. Trojan übergab mir dieses Manuskript zur Verwahrung, als er wegen seiner unerwünschten Forschungsergebnisse während des Dritten Reiches verfolgt wurde. Der Verfasser wurde im KZ Trassenheide Opfer eines alliierten Luftangriffs und konnte sich deshalb auch nach dem Krieg nicht rehabilitieren.
Gemäß dem mir erteilten Verwahrungsauftrag habe ich dieses Manuskript nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland diversen wissenschaftlichen Verlagen zur Veröffentlichung in Trojans Namen angeboten. Keiner hatte Interesse, weil Trojan der Professorentitel entzogen worden war. Seine Forschungsergebnisse hätten überprüft werden müssen. Dazu bin ich als Seemann ohne wissenschaftliche Ausbildung leider nicht in der Lage. Ich habe auch keine Verbindungen zu anderen Archäologen, die dies leisten könnten. Ferner möchte ich nicht, dass die wissenschaftliche Arbeit eines Professors hier in Hamburg durch die hier wütenden Studentenunruhen Schaden nimmt.
Deshalb stifte ich es der Bibliothek meiner Heimatstadt Aurich mit der Auflage, im Falle der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten den oder die Erben ausfindig zu machen und auszuhändigen. Bis dahin ist es der Wissenschaft, aber auch sonstigen interessierten Personen zugänglich zu machen. Wissenschaftlern ist dabei Vorrang zu gewähren. Ferner weise ich darauf hin, daß Professor Trojan einen Sohn hat, der vermutlich auf Usedom geblieben ist und wahrscheinlich als Fischer tätig ist. Ich habe hierzu keine intensiven Nachforschungen angestellt. Es erschien mir zu gefährlich für ihn als DDR-Bürger, mit einem Bundesbürger, einem ehemaligen Offizier der Kriegsmarine des Dritten Reiches und Nichtkommunisten in Verbindung gebracht zu werden.
Sollte das Buch veröffentlicht werden und es eines Tages zur Wiedervereinigung kommen, so hat Trojans Sohn natürlich Anspruch auf die Tantiemen.
Hochachtungsvoll
Gustav Wolfson, Kapitänleutnant a. D.
Britta kopierte den Brief, um das Original wieder in die Kassette zu legen, machte eine Kopie des Manuskript-Deckblattes und wollte sich mit Namen und Datum in die Entleiherliste einzutragen, als sie bemerkte, dass in der Liste vor ihr schon jemand eingetragen war. Sie schnappte heftig nach Luft, als sie dort Marcus D. Brown, 3. September 2002 las.
‚Das gibt’s doch nicht! Der Lump hat die Glocke aus dem Manuskript! Von wegen durch die halbe Welt gereist! Dir werd‘ ich helfen, du Armleuchter!‘, dachte sie.
Sie sah sich um, nahm die Liste, kopierte sie ebenfalls, schrieb sich ein und brachte dann die Kassette mit dem Originalbrief und der Kopie des Deckblattes zum Archiv zurück.
„Eine Frage noch: Wieso haben Sie erst 2004 nach Erben gesucht? Das Manuskript ist ja schon über vierzig Jahre hier“, erkundigte sie sich.
„Verzeihen Sie die Gegenfrage: Wieso suchen Sie erst jetzt nach dem Manuskript?“, fragte der Archivar.
„Man kann nur nach etwas suchen, von dem man weiß, dass es noch existiert. Mein Vater, Boris Trojans Sohn, wusste zwar, dass sein Vater etwas zur Glocke von Vineta verfasst hatte, aber wo das Manuskript war, das wusste er nicht. Deshalb wusste ich auch nicht, ob es überhaupt noch existierte. Mein Mann war ziemlich überrascht, als er Ihre Suchanzeige im Netz fand.“
„Sehen Sie, uns is‘ es ähnlich gegangen. Ich arbeite seit 1980 hier, aber diese Kassette ist mir erstmals in die Finger geraten, als hier ein amerikanischer Filmfuzzi auftauchte und danach fragte. Wir konnten es nur finden, weil er den Namen des Stifters erwähnte und sagte, dessen Sohn Peter Wolfson, Sie wissen schon, der Hollywood-Regisseur, drehe einen Film und hätte ihm gesagt, hier läge ein Manuskript, in dem ‘ne interessante Glocke beschrieben sei. Über die Stifterkartei haben wir es dann gefunden. Da war dann auch der Brief. Ich hab‘ gleich angefangen, nachzuforschen, aber in Berlin wussten sie nix von einem Boris Trojan. Vom Amt Usedom-Süd bekam ich die Auskunft, die Familie Trojan sei Anfang der Sechziger nach Magdeburg umgesiedelt worden und die Magdeburger wussten nur, dass ein Trojan und seine Familie in den Siebzigern als politische Häftlinge freigekauft worden waren und unbekannt verzogen seien. Danach verlor sich die Spur. Die DDR-Bonzen sollten ja sicher nicht wissen, wo ihre ehemaligen Untertanen untergekommen waren. Ich hab‘ dann noch an das Ministerium für innerdeutsche Beziehungen geschrieben, aber der Laden ist seit 1991 aufgelöst und das Bundesinnenministerium, das deren Akten übernommen hat, hat bis heute nicht geantwortet. Vielleicht haben die die alten Akten verbummelt. Wir hätten nicht mehr weitergewusst, wär‘ nich‘ ‘n Azubi auf die Idee gekommen, ‘ne Suchanzeige ins Netz zu stellen. Is‘ aber wie ’ne Flaschenpost – keine Ahnung, wo sie angeschwemmt wird. Zum Glück ha’m S’e ‘s ja doch noch gefunden. Ende gut, alles gut“, erklärte Thamsen. Britta Mönke überlegte, ob sie den Archivar ansprechen sollte, ob er als Zeuge aussagen wollte, falls es zu einer Weiterführung des Prozesses kam, entschied sich dann aber dagegen. Sie hatte seinen Namen, sie hatte die Kopie des Kassettendeckels. Vielleicht war allein damit etwas zu gewinnen. Und nötigenfalls konnte man den Archivar noch als Zeugen benennen.
Mit dem Originalmanuskript und den Kopien der Entleiherliste und des Stiftungsbriefs machte sie sich auf dem Heimweg.
„So ein Lump!“, kommentierte Bernd Mönke den Fund seiner Frau. „Bedient sich der Aufzeichnungen deines Großvaters, gibt das als seine Erfindung aus und sein Laden verklagt unseren Sohn wegen angeblichen Plagiats! Umgekehrt wird wohl eher ’n Schuh draus! Schweinebacken!“
Das Telefon klingelte. Britta nahm ab und meldete sich.
„Bluhm hier. Tag, Frau Mönke. Ich habe ein paar interessante Neuigkeiten“, meldete sich der Professor.
Zur selben Zeit holte Jonas eine Nachricht der Post aus dem Briefkasten seiner Wohnung in der Ebeersreye, dass beim Hauptzollamt Hamburg-Stadt in der Koreastraße 4 eine Sendung für ihn liege. Er drehte um, lief in die Garage, setzte sich ins Auto und hatte dann die Idee, dass es besser sei, erst einmal nachzusehen, wo das genau war und wann das Zollamt geöffnet war. Im Internet erfuhr er, dass die Koreastraße im neuen Stadtteil HafenCity war und das Zollamt montags bis donnerstags von 08.30 Uhr bis 14.30 Uhr geöffnet war. Es war jetzt Dienstagnachmittag, etwa halb fünf. Er musste also am nächsten Tag vom Büro aus hinfahren.
Fast im selben Moment klingelte das Telefon.
„Oh, hallo, Mutz!“, meldete er sich, als er seine Mutter hörte.
„Professor Bluhm hat eben angerufen. Er hat Neuigkeiten für uns und will bei deinem Anwalt vorbeikommen. Und ich habe auch Nachrichten für dich. Ich habe Uropas Manuskript!“
„Boah! Das gibt’s wirklich? Krass!“, entfuhr es Jonas. „Und wann treffen wir uns mit dem Prof?“
„Übermorgen um halb fünf. Kannst du dann dort sein?“
„Werd‘ ich hinkriegen, Mutz!“
Am folgenden Tag verlängerte er seine Mittagspause und lief um kurz nach zwölf Uhr zum U-Bahnhof Alsterdorf, um mit der U-Bahn in die Hamburger Innenstadt zu fahren. Vom U-Bahnhof Meßberg waren es nur ein paar Minuten Fußweg zum Hauptzollamt in der Koreastraße 4. Er legte das Benachrichtigungsschreiben der Post vor. Der Zollbeamte sah darauf, verschwand und kam mit einem dicken Briefumschlag zurück.
„Sie sollen eine Sendung von einer US-Firma bekommen. Direct Management Group Inc. 8332 Melrose Avenue, Top Floor, Los Angeles, CA 90069 USA. Es soll eine Geschenksendung sein. Vorstellung, was das sein soll?“, fragte der Beamte.
„Das könnte ein Requisitenreplikat sein, über das ich vor einiger Zeit im Rahmen eines Interviews mit dem Schauspieler Jonathan Blanchard gesprochen habe. Muss das verzollt werden?“
„Was für eine Replik sollte es sein?“
„Ein Ring, den er mal in einem Film getragen hat und der von Weta in Neuseeland hergestellt worden war. Ich nehme nicht an, dass der wirklich aus Gold ist, tippe eher auf Messing“, erwiderte Jonas.
„Das muss ich prüfen. Dazu werde ich das Päckchen nun öffnen“, sagte der Beamte und schlitzte den Umschlag auf. Ein schwarzes Kästchen fiel heraus, das der Zollbeamte öffnete. Ein goldfarbener Ring mit einem ovalen roten Stein, in den ein Tatzenkreuz eingeschnitten war, kam zum Vorschein.
„Nach Mittelwelt sieht der nicht aus“, brummte der Zöllner. „Herbert! Komm mal!“, rief er nach einem Kollegen.
„Geschenksendung aus den USA. Ist es das, was ich denke?“
Der Kollege nahm den Ring und suchte im Inneren.
„Jau, is‘ es. Da is‘ die Marke“, erwiderte er. „Junger Mann, das ist achtzehnkarätiges Gold. In der Größe dieses Rings hat es einen Wert von mehr als 45 Euro und muss auch als Geschenk verzollt werden.“
„Okay, was kostet es?“, fragte Jonas.
Der Zöllner legte den Ring auf eine Waage.
„15 Gramm. Das ist ‘ne halbe Unze. Unze Feingold kostet … 1.200 US-Dollar. 600 Dollar, davon zwei Drittel, sind 400 Dollar. Ein Dollar ist aktuell 75 Euro-Cent, macht 300 Euro, davon 17,5 Prozent sind 52 Euro und 50 Cent“, rechnete der Zöllner, der Jonas in Empfang genommen hatte. Mönke bezahlte den Zoll ohne zu zögern. Ein achtzehnkarätiger Goldring samt Stein für etwas über fünfzig Euro – das war wirklich geschenkt, schließlich war es nur die Einfuhrsteuer für Deutschland und kein Kaufpreis. Der junge Mann packte den Ring wieder in das Kästchen, steckte es in den Umschlag und verabschiedete sich. Er hatte die originalgetreue Replik des Siegelrings seines Lieblingsritters Balduin von Caymont! Jonas strahlte über alle Backen. Das hatte er sich wirklich nicht träumen lassen!
Auf dem Weg zurück las er Blanchards Brief, in dem er ihm mitteilte, dass Richard Taylor den Ring auf seine Bestellung hin mit dem historischen Originalmaterial hergestellt hatte. Im Film sei es nur Messing gewesen, aber Richard sei doch sehr beeindruckt gewesen, wie sehr Jonas sich mit den Filmen beschäftigt habe, für die Weta die Ausstattung gemacht habe. Deshalb sei es Ehrensache gewesen, das Originalmaterial zu verwenden. Zur Glocke habe Richard ihm gesagt, Setdesigner Marcus Brown habe ihm seinerzeit ein ziemlich alt aussehendes Foto gegeben, auf dem die Glocke abgebildet gewesen sei. Auf der Rückseite habe Brown notiert: altes Bild des deutschen Archäologen B. Trojan.
Für Jonas war dies der handfeste Beweis, dass Brown vor Gericht gelogen hatte.
Noch einen Tag später saß Familie Mönke mit Professor Bluhm im Büro von Rechtsanwalt Ralf Schmidt. Britta und Jonas berichteten, was sie bekommen hatten; dann erklärte Roland Bluhm, dass er erfahren hatte, dass Brown in keinem der von ihm angegebenen Museen gewesen sei.
„Aber das Schärfste ist, dass er nach einem massiven Verriss der Filmausstattung in der Hamburger Abendpost gemeinsam mit Agamemnon-Deutschland-Chef Schiemann bei dem dortigen Redakteur Wehmeyer in dessen Redaktion war und auf dessen Nachfrage, woher er denn ausgerechnet dieses Muster der Glocke gehabt habe, sagte, er sei im Herbst 2002 auf Anregung seines Chefs Wolfson in Aurich gewesen, der ihm gesagt habe, dass dort ein Manuskript von einem Professor Trojan lagere, in dem eine interessante Glocke beschrieben sei. Weil das Produktionsbudget wegen der relativ teuren bekannten Schauspieler schon ziemlich ausgeschöpft war, sollte er sich an der dort beschriebenen Glocke orientieren. Also habe er die Beschreibung aus dem Manuskript für seinen Entwurf verwendet“, vollendete der Professor den Bericht.
„Unglaublich!“, entfuhr es Schmidt. „Ich kenne den Lupus ja schon lange, Herr Mönke hat mit ihm als Schadensachbearbeiter bei Sperling auch schon seine üblen Erfahrungen. Aber so ein Ding habe ich noch nicht gesehen. So ein dreister Lügner, dieser Zeuge!“
„Aber es scheint mir nicht das Ende der Fahnenstange zu sein“, warf Jonas ein. „Offen ist immer noch die Frage, weshalb Brown dann nicht auch die Keilschrift vollständig übernommen hat. Dem Taylor von Weta hat er ein Foto gegeben, das aus Uropas Buch sein muss.“
Britta nahm das Manuskript aus der Tasche, von dem sie bislang nur gesprochen hatte.
„Wow!“, entfuhr es Professor Bluhm, als er es sah. „Darf ich mal?“, bat er. Britta gab ihm das Manuskript, das der Professor vorsichtig durchblätterte.
„Was für ein Schatz!“, kommentierte er. „Hier sind Plätze für Fotos freigehalten, aber dort hat nie ein Foto geklebt. Wenn Weta ein Foto bekommen hat, muss das aus einer anderen Quelle sein. Ah, hier ist das Inhaltsverzeichnis … Wo ist denn die Beschreibung?“, brummte er und suchte nach der entsprechenden Seite, die er durchlas.
„Nein. Hier ist zwar eine detaillierte Beschreibung der Glocke, aber bezüglich der Keilschrift verweist Professor Trojan auf ein Detailfoto, das daneben eingesetzt werden sollte. Er hat es hier als Abbildung Nummer 31 bezeichnet. Wenn Weta ein Foto bekommen hat, dann wahrscheinlich von der ganzen Glocke, möglicherweise das, was hier als Abbildung Nummer 30 bezeichnet ist. Nein, allein aus der Beschreibung konnte Brown die Keilschrift nicht übernehmen. Er dürfte daraus nur erkannt haben, dass es eine Inschrift in Keilschrift gab und was sie grundsätzlich bedeuten sollte. Und das Foto, das an Weta weitergegeben wurde, hatte vermutlich den kleinen Fehler, dass die untere Keilzeile fehlte, womit der Sinn des Textes verändert wurde, genauer: nicht mehr gegeben war.“
„Was meinen Sie, Herr Professor? Kann man das als wissenschaftliche Arbeit veröffentlichen?“, fragte Britta interessiert.
„Verzeihen Sie, wenn ich dazu nicht sofort ja sage, Frau Mönke. So, wie es hier vorliegt, ist es zunächst nur beschriebenes Papier. Wichtig wären die Fotos, für die hier Plätze freigehalten sind. Es soll auch eine Kartenskizze geben, die den Weg der Vineter und damit der Glocke beschreibt. Ohne diese als Belege für seine Theorie angegebenen Nachweise, ist es eine Hypothese, die auch nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung ziemlich wild klingt. Es gilt inzwischen zwar als gesichert, dass es in Vineta mindestens Griechen gab. Bischof Adam von Bremen erwähnt sie um 1000 nach Christus in einem Brief. Wir sind inzwischen recht sicher, dass die Seevölker, die im Alten Testament als Kreti und Pleti erwähnt werden, etwas mit Auseinandersetzungen zwischen Völkern auf dem griechischen Festland und dem, was gemeinhin als Troja bekannt ist, zu tun haben. Homer hat vielleicht etwas zu viel Hellenentum in die Trojaner gesteckt; sie waren wohl eher hethitisch geprägt, möglicherweise auch eine Mischung aus Ägyptern und Hethitern. Kleinasien und Palästina waren Durchgangswege, seit sich Menschen aus Afrika auf den Weg in die Welt gemacht haben. Aber genau genommen, müssten diese Thesen überprüft werden“, erklärte Bluhm.
„Also … hilft das Manuskript nicht weiter?“, fragte Britta, hörbar enttäuscht.
„Doch – jedenfalls in diesem Rechtsstreit“, entgegnete der Professor mit sanftem Lächeln. „Der Archivar der Bibliothek kann bezeugen, dass das Manuskript dort war, es gibt den Stiftungsbrief von 1968, der einen entsprechenden Eingangsstempel der Stadtbibliothek Aurich trägt. Die Umstände, die Kapitänleutnant a. D. Wolfson vorträgt, passen in die Zeit der 68er Studentenproteste. Die Sprache passt zu einem, der im Krieg Offizier der Kriegsmarine war. Der Aufruf der Bibliothek von 2004 ist auch beweisbar in der Welt. Die Unterschrift von Brown im Kassettendeckel gleicht der, die unter dem Entwurf von Brown in den Unterlagen des Gerichtes ist. Nach allem ist es klar, dass die Beschreibung der Glocke durch Ihren Großvater und das Foto, das Jonathan Blanchard in seinem Brief an Ihren Sohn erwähnt, die Quellen für den Entwurf waren – und nicht eigene Fantasie oder auch nur grobe Anregungen aus gewissen Museen.“
Kapitel 9
Aufgeben ist keine Option
Die Siegessicherheit, die die neuen Informationen Jonas vermittelten, bekam einen Dämpfer, als er Anfang Juli ein Schreiben des Landgerichtes erhielt. Die Klägerseite hatte die Klage nicht nur nicht zurückgenommen, sie erhob neue Vorwürfe.
Sie bestritt, dass die Keilschrift überhaupt eine Bedeutung hatte, bezichtigte den Sachverständigen Bluhm der Parteinahme, warf ihm vor, unwahre Aussagen gemacht zu haben. Begründet wurde dies damit, dass der Beklagte mit dem Sachverständigen vor dem Prozess Kontakt aufgenommen habe und auch nach dem Termin im Gespräch mit der Familie des Beklagten gesehen worden sei. Außerdem sei durch den Bericht eines Detektivbüros nachweisbar, dass der Sachverständige sich mit dem Beklagten und dessen Familie beim Rechtsanwalt des Beklagten getroffen habe. Der Sachverständige und sein Gutachten seien daher weder unparteiisch noch neutral. Eine erneute Beauftragung dieses Sachverständigen lehne die Klägerin ab, weil sie sich dadurch in der Verfolgung ihrer Ansprüche eingeschränkt sehe. Für den Fall, dass dieses Ansinnen abgelehnt werde, werde man das Gericht als befangen ablehnen. Ferner bestritt die Klägerin gemäß § 138 ZPO (Zivilprozessordnung) in Verbindung mit § 439 ZPO mit Nichtwissen, dass die Tuschezeichnung vom verstorbenen Zeugen Hinnerk Trojan angefertigt worden sei. Die Signatur stelle keinen Beweis dafür dar, dass sie nicht vom Beklagten oder einem seiner Elternteile nach 2004 angefertigt worden sei.
Das Landgericht erklärte, der Prozess werde fortgesetzt. Dem Beklagten werde aufgegeben, zu begründen, weshalb er mit dem Sachverständigen Kontakt aufgenommen habe und weshalb der Sachverständige nach dem Termin mit ihm gesprochen habe. Weiter solle der Beklagte gemäß § 440 ZPO darlegen und beweisen, dass Tuschezeichnung und Unterschrift vom verstorbenen Zeugen Hinnerk Trojan stammten. Geeignete Vergleichsurkunden seien durch den Beklagten vorzulegen. Der Klägerin wurde auferlegt, geeignete Umstände darzulegen und zu beweisen, dass der Vortrag des Sachverständigen bezüglich der Keilschrift unzutreffend sei. Eine Frist zur Erwiderung wurde mit vier Wochen nach Zustellung angesetzt.
Jonas war zunächst wie vor den Kopf geschlagen. Dann griff er zum Telefon und rief Ralf Schmidt an.
„Hören Sie sich das an!“, schnaufte er, als Ralf sich gemeldet hatte und trug ihm die Auflagen des Gerichtes vor.
„Haben Sie ihr noch einen Personalausweis von Ihrem Großvater?“, fragte Ralf.
„Weiß ich nicht. Wir haben ihn vom Bestatter zurückbekommen. Ich hoffe, dass meine Eltern ihn noch nicht vernichtet haben. Aber bei meinen Eltern müssten auch noch irgendwelche anderen offiziösen Unterlagen sein, auf denen Opas Unterschrift ist. Was sagen Sie zu den Zweifeln an dem Sachverständigen?“
„Na ja, war nicht schlau, ihn auf dem Gerichtsflur anzusprechen. Und dass er von sich aus aktiv geworden ist, um Nachforschungen anzustellen, kann ihm sicher auch nachteilig ausgelegt werden. Allerdings müsste Ihnen oder Ihren Eltern oder dem Sachverständigen bewiesen werden, dass es eine vorherige Bekanntschaft gab. Wäre das was dran?
„Nein. Ich habe ihn im Gericht ja auch nur angesprochen, weil ich erst den Eindruck hatte, Agamemnon Pictures hätte gleich Jonathan Blanchard als Zeugen aufgeboten. Wenn sich Lupus und sein so genannter Zeuge nicht der handfesten Lüge strafbar machen wollen, müssen sie einräumen, dass ich mit ihm nicht über den Sachverhalt gesprochen habe, sondern ihn gefragt habe, ob er tatsächlich Jonathan Blanchard sei, weil ich ihn für den Schauspieler gehalten habe. Spätestens der Dolmetscher müsste das bezeugen können, wenn weder mir noch meinen Eltern oder dem Bluhm dieser Gesprächsinhalt geglaubt wird“, erwiderte Jonas.
„Okay. Und wie die Gegenseite beweisen will, dass Bluhm zu den Keilschriftzeichen falsche Angaben gemacht hat, erschließt sich mir nicht. Das ist eine Behauptung ins Blaue. Damit werden sie nichts. Im Grunde gilt das auch für die Signatur Ihres Großvaters. Nach § 10, Absatz 1 UrhG gilt derjenige als Urheber eines Werkes, dessen Signatur auf dem Werk ist. Wer etwas anderes behauptet, muss den Gegenbeweis antreten. Da kehrt sich die Beweislast um.“
„Stimmt schon, aber sie bestreiten ja die Echtheit der Unterschrift“, gab Jonas zu bedenken. „Aber mit Opas Personalausweis müsste sich das erledigen.“
Noch am selben Nachmittag war er bei seinen Eltern, die ihm den Personalausweis auch mitgaben. Zusätzlich konnte er noch Kopien von offiziellen Anträgen finden, die sein Großvater unterschrieben hatte. Er fand auch einen handgeschriebenen Brief, den sein Großvater vor Jahren an ihn selbst geschrieben hatte. Er scannte die Antragskopien und den Personalausweis, der zwar 2007 schon abgelaufen war, aber es ging ja um die Unterschrift und nicht um die Gültigkeit des Ausweises.
Die Scans schickte er Ralf Schmidt per E-Mail, der dem Gericht die Scans ausdruckte und seinem Schriftsatz beifügte, in dem er eine vorherige Bekanntschaft seines Mandanten mit dem Sachverständigen ausdrücklich bestritt, und die Ansprache auf dem Flur mit einer Verwechslung der Person begründete und darauf hinwies, dass mit dem Sachverständigen vor dessen Aussage im Prozess keinerlei Austausch zum Sachverhalt getätigt worden war. Bezüglich der Unterschriften beantragte er einen Unterschriftenvergleich gemäß § 441, Absatz 1 ZPO. Ferner wies er darauf hin, dass sein Mandant inzwischen das Manuskript des Professors Boris Trojan aufgefunden habe. In diesem Manuskript sei eine detaillierte Beschreibung der Glocke, nach der eine Zeichnung derselben ohne weiteres möglich sei. Der Beklagte könne zudem beweisen, dass dem Zeugen Brown dieses Manuskript bekannt sei. Zeuge hierfür sei der Archivar Tamme Thamsen, zu laden über die Stadtbibliothek Aurich. Es könne auch bewiesen werden, dass der Zeuge Brown die angegebenen Museen nicht in der behaupteten Zeit besucht habe. Zeuge hierfür sei Professor Roland Bluhm, zu laden über die Universität Hamburg, der nach den fragwürdigen Aussagen des Zeugen Brown eigeninitiativ Kontakt mit den Museen aufgenommen habe. Zudem habe der Zeuge Bluhm Kontakt zu dem Feuilletonredakteur der Hamburger Abendpost, Julius Wehmeyer, bekommen, dem der Zeuge Brown in einem Interview mitgeteilt habe, er sei auf den Hinweis des Hauptgesellschafters von Agamemnon Pictures, Peter Wolfson, aus Gründen der Kostenersparnis in Aurich gewesen, wo er das Manuskript gelesen habe.
Das Gericht teilte zwei Wochen darauf mit, dass der Termin auf den 19. November 2013 um 09.30 Uhr im Landgericht Hamburg festgesetzt sei. Das Gericht ordnete das persönliche Erscheinen sowohl des Geschäftsführers der Klägerin als auch des Beklagten an. Jonas brachte das Schreiben seinem Chef, um seine gerichtlich angeordnete Abwesenheit am 19. November mitzuteilen.
„Was meinst du? Wird die Sache damit beendet sein?“, fragte Gunnar seinen Mitarbeiter. Jonas zuckte mit den Schultern.
„Ich weiß es nicht. Hoffen tue ich es, aber ich kann es nicht versprechen. Liegt nicht in meiner Hand, Chef“, erwiderte er.
„Dann viel Glück. Wir wissen ja alle, was von Simeon Lupus zu halten ist“, sagte Mahnke.
Zu dem Termin waren außer Jonas als Beklagtem und Geschäftsführer Hauke Schiemann als Vertreter der Klägerin und deren jeweiligen Anwälten auch Professor Bluhm, Marcus Brown samt Dolmetscher Berger sowie ein Manfred Wendt als Schriftsachverständiger, ein Julius Wehmeyer und Tamme Thamsen, der Archivar der Stadtbibliothek Aurich als Zeugen geladen. Drei der Geladenen waren neu im Prozess. Jonas hatte sie noch nie gesehen, konnte sich aber ausrechnen, dass es die drei waren, die er auf dem Gerichtsflur gesehen hatte, aber nicht zuordnen konnte.
Der Prozess wurde aufgerufen. Alle, die auf dem Flur waren, betraten den Gerichtssaal. Der Vorsitzende Richter Dr. Marquardt eröffnete den Verhandlungstermin und schickte die Zeugen bis zum Aufruf wieder hinaus. Die Anwälte verlasen ihre jeweiligen Schriftsätze.
„Zunächst ist festzustellen, dass die Klägerseite der Aufforderung des Gerichtes nicht nachgekommen ist, darzulegen und zu beweisen, dass die Ausführungen des Sachverständigen bezüglich der Keilschriftinschrift fehlerhaft seien. Das Gutachten ist damit anerkannt“, erklärte Dr. Marquardt. „Die Klägerseite bestreitet die Echtheit der Signatur auf dem Bild der Glocke. Wenn keine Einwendungen der Parteien vorliegen, möchte das Gericht den Sachverständigen Manfred Wendt hören, der hierzu ein Schriftgutachten erteilen soll“, sagte der Richter. Weder Lupus noch Schmidt hatten Einwände. Der Richter rief den Sachverständigen auf. Es war einer der drei Männer, die Jonas bislang nicht kannte. Der Richter stellte die Personalien fest und vereidigte den Sachverständigen.
„Bitte, Herr Wendt, erteilen Sie Ihr Gutachten“, forderte der Richter ihn auf.
„Ich hatte den Auftrag, die Signatur auf dieser mir vorgelegten Zeichnung mit Unterschriften anderer Dokumente zu vergleichen, die mir der Beklagte auf meine Anforderung zur Verfügung gestellt hat. Es handelt sich um einen Personalausweis, der vom Ortsamt Hamburg-Wandsbek für Heinrich Boris Trojan, geboren 29. März 1920, ausgestellt und von besagtem Heinrich Trojan unterschrieben wurde. Der Personalausweis hat mir im Original vorgelegen. Ferner wurden mir Scans von Antragskopien zu verschiedenen Versicherungsverträgen sowie im Original ein handgeschriebener Brief, der an den Beklagten gerichtet ist und mit „Dein Opa Hinnerk“ unterschrieben ist. Hinnerk ist die niederdeutsche Form von Heinrich.
Die vorhandenen Unterschriften sind klar ein und derselben Person zuzuordnen. Nach dem vorhandenen Personalausweis ist die Signatur eindeutig dem Inhaber des Personalausweises zuzuordnen. Die Handschrift im Brief korrespondiert auch mit dem im Personalausweis angegebenen Geburtsdatum. Sie ist typisch für jemanden, der als Schüler sowohl mit der bis 1940 in den deutschen Schulen gelehrten Sütterlin-Schreibschrift als auch der lateinischen Schreibschrift konfrontiert wurde. Menschen, die bis 1938 mit der Schule begonnen haben, weisen grundsätzlich eine Mischform beider Schreibschriften in der Handschrift auf – zum Beispiel der Unterscheidungsstrich über dem kleinen u, der diesen Buchstaben vom sonst gleichartig geschriebenen Kleinbuchstaben n unterscheidet oder der nach unten verlängernde z-Kringel, den es in dieser Form definitiv nur in Deutschland gibt. In der vorliegenden Handschrift sind mit dem auch nach unten verlängerten Kleinbuchstaben h und dem abweichend von der lateinischen Schreibschrift langen Kleinbuchstaben s zwei weitere Besonderheiten, die auf eine längere Übung in Sütterlin-Schrift hinweisen. Das passt ohne weiteres zu einem Mann, der 1920 geboren und 1926/27 eingeschult wurde. Heinrich Trojan hat – auch wenn er Abiturient gewesen sein sollte – während seiner gesamten Schulzeit Sütterlin geschrieben. Die lateinische Schrift zeigt gewisse Mühen, die ebenso typisch für jemanden sind, der erst nach der Schule mit einer anderen Schreibschrift konfrontiert wurde und diese neu erlernen musste.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Signatur unter der Tuschezeichnung von derselben Person geschrieben wurde, die auch den Personalausweis und weitere vorgelegte Anträge unterschrieben hat. Sie passt überdies zu einem Menschen, der über lange Zeit die Sütterlin-Schreibschrift geschrieben hat, bevor im Jahr 1940 die lateinische Schreibschrift eingeführt wurde, die er dann neu erlernen musste. Dieses Gutachten habe ich unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.“
„Danke, Herr Wendt. Haben Sie Fragen an den Sachverständigen? Herr Rechtsanwalt Schmidt?“
„Nein, keine Fragen. Das Gutachten spricht in diesem Fall für sich“, erwiderte Jonas‘ Anwalt.
„Herr Rechtsanwalt Lupus?“
„Ja, Herr Richter. Woher hatten Sie die zu prüfenden Materialien?“
„Wie ich bereits im Gutachten gesagt habe, habe ich sie von Herrn Mönke erhalten“, erwiderte Wendt.
„Wie haben Sie sie angefordert?“, fragte Lupus weiter.
„Die Zeichnung habe ich als Kopie mit dem Auftrag vom Gericht erhalten. Darauf habe ich den Beklagten aufgefordert, mir weitere Dokumente zur Verfügung zu stellen, die die Provenienz der Signatur belegen können. Darauf habe ich die Dokumente von ihm erhalten, die ich als Vergleichsmaterial verwenden konnte.“
„Wann haben Sie die Dokumente angefordert und wann haben Sie sie bekommen?“, bohrte Lupus weiter.
„Ich habe Ende Juli den Auftrag des Gerichtes erhalten und noch in derselben Woche die Unterlagen angefordert. Ich habe die Dokumente auch nur wenige Tage danach erhalten“, erwiderte Wendt.
„Geht das genauer?“, beharrte Lupus. Der Sachverständige schnaufte gereizt und nahm seine Aktentasche zur Hand.
„Meine Güte!“, knurrte er. Er nahm die komplette Akte zur Hand.
„Also: Anforderung vom Gericht kam am 31. Juli 2013 an, mein Schreiben an den Beklagten datiert vom Freitag, dem 2. August 2013. Am Montag, dem 5. August, rief Herr Mönke mich kurz nach Bürobeginn an und wollte wissen, wann er die Dokumente vorbeibringen könnte. Am Nachmittag um 16.30 Uhr war dann bei mir und hat mir die Unterlagen übergeben“, trug er aus der Akte vor. „Genau genug?“
„Ja, danke. Sagen Sie, wie lange braucht man, um einen solchen Brief zu schreiben?“, fragte der Beklagten-Anwalt.
„Das hängt ganz sicher von der Stimmung und den Ideen ab, die jemand hat, der einen Brief schreibt. Insofern kann ich nicht sagen, wie lange der Schreiber dieses Briefes dafür benötigt hat. Wieso?“
„Sehen Sie sich den Brief bitte noch einmal an. Wie ist er geschrieben?“
„Was meinen Sie?“
„Nun, ist er flüssig geschrieben oder mit Pausen?“
„Es gibt wahrscheinlich keinen Menschen auf dieser Welt, der einen Brief ohne abzusetzen schreibt. Aber es ist klar erkennbar, dass die Wörter jeweils ausgeschrieben wurden, bevor eine Pause einsetzt. Das können Sie an den Ansätzen erkennen. Hier wurde ein Kugelschreiber benutzt. Kugelschreiber haben die Eigenschaft, etwas einzutrocknen, wenn der Schreibfluss für … sagen wir … Denkpausen unterbrochen wird. Hier, an dem Absatz ist das ganz gut zu sehen. Der Kugelschreiber musste erst wieder flüssig geschrieben werden, Deshalb ist hier mehrfach angesetzt worden.“
„Und es ist absolut auszuschließen, dass dieser Brief von jemand Jüngerem geschrieben wurde, um die Handschrift eines Älteren vorzutäuschen?“, hakte Lupus nach.
„Ja, da ist es“, versetzte Wendt.
„Und was macht Sie da so sicher?“
„Weil dies eine Mischhandschrift ist, die kein Mensch hat, der nach 1940 in die Schule gekommen ist. Würde jemand die Handschrift eines anderen kopieren, wären die Wörter nicht durchgehend geschrieben, jedenfalls nicht alle. Und dass jemand einfach so eine Handschrift … sagen wir … nachahmen könnte, um eine nicht existente Handschrift eines älteren Menschen zu kreieren – das wäre hohe Kunst, die sowohl historische Detailkenntnisse als auch ein wirklich hohes künstlerische Niveau erfordern. Aber auch dann wären mit einiger Sicherheit Absätze innerhalb von Wörtern erkennbar. Das ist hier nicht der Fall.“
„Nun, Herr Mönke ist historisch interessiert und er ist künstlerisch so versiert, dass er diese Zeichnung bereits nahezu eins zu eins kopieren konnte. Warum also nicht einen ganzen Brief? Zeit genug hätte er gehabt, um einen Brief einzuüben.“
Jonas schnappte nach Luft, aber Ralf Schmidt legte ihm beruhigend eine Hand auf den Arm.
„Innerhalb von achtundvierzig Stunden? Völlig unmöglich!“, erwiderte der Sachverständige bestimmt.
„Nun, dass wir die Echtheit der Signatur anzweifeln, war Herrn Mönke ja spätestens mit dem Zugang des Schriftsatzes klar. Und der war ihm fast einen Monat bekannt, bevor er Ihnen die Dokumente übergab“, erklärte Lupus.
„Wann Herr Mönke darüber Bescheid wusste, dass die Echtheit der Signatur bezweifelt wurde, entzieht sich naturgemäß meiner Kenntnis. Dennoch ordne ich die Signatur und die Handschrift einem Menschen zu, der vor – deutlich vor – 1940 die Schule besucht hat.“
„Wann haben Sie Herrn Mönkes eigene Handschrift gesehen?“
„Überhaupt nicht. Dass Sie beziehungsweise Ihre Mandantschaft annehmen, er könnte Signatur und Brief selbst geschrieben haben, höre ich jetzt zum ersten Mal. Mein Auftrag bestand darin, die Signatur mit Dokumenten zu vergleichen, die mir nur von Beklagtenseite zur Verfügung gestellt werden konnten. Im Übrigen übersehen Sie bei dieser Fantasie, dass Herr Mönke allein aus der Unterschrift auf dem Personalausweis die gesamte mögliche Handschrift hätte rekonstruieren müssen. Und das ist schlichtweg unmöglich!“, entgegnete Wendt scharf.
„Nicht so aufgeregt, Herr Sachverständiger!“, versetzte Lupus.
„Herr Rechtsanwalt, Sie bezweifeln meine Kompetenz. Da darf ich mich wohl aufregen, oder?“
„Nein, ich bezweifle, dass Sie Ihrem Auftrag ordnungsgemäß nachgekommen sind!“, fuhr ihn Lupus an.
„Herr Rechtsanwalt Lupus!“, fuhr der Vorsitzende Richter dazwischen.
„Ja?“
„Der Sachverständige hatte den Auftrag, die Signatur auf der Tuschezeichnung mit geeigneten Dokumenten zu vergleichen, die die Unterschrift des angegebenen Urhebers der Zeichnung tragen. Das ist durch den Personalausweis des verstorbenen Zeugen Trojan hinreichend belegt. Dass Sie die Echtheit des Briefes bezweifeln ist eine Sache, die der Beklagte wohl auch kaum belegen kann, da Sie grundsätzlich alles bezweifeln, was er vorlegt. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie auch die Echtheit des Personalausweises bezweifeln, der dem Sachverständigen nach dessen Ausführungen im Original vorgelegen hat?“, halte der Richter ein.
„Nein, aber die Unterschrift könnte vom Beklagten vom Personalausweis abgeschrieben worden sein.“
„Herr Wendt?“, forderte der Richter den Sachverständigen zur Stellungnahme auf.
„Nein, gewiss nicht. Kopierte Unterschriften sind nie fließend geschrieben. Diese ist es. Es ist auszuschließen, dass es sich auf der Zeichnung um eine nachgemachte Unterschrift handelt“, erklärte der Sachverständige.
„Noch Fragen, Herr Rechtsanwalt?“, fragte der Richter mit einem Blick über die Brille.
„Nein, keine weiteren Fragen“, erwiderte Lupus.
„Die Echtheit der Signatur unter der Tuschezeichnung steht damit fest“, konstatierte der Richter. „Der Zeuge ist entlassen und kann, wenn er es wünscht, im Publikum Platz nehmen. Dann bitte den Zeugen Bluhm“, forderte der Richter den Professor auf.
Kapitel 10
Es knallt
Roland Bluhm betrat den Gerichtssaal. Richter Dr. Marquardt fragte beide Anwälte, ob eine erneute Vereidigung des Zeugen beantragt werde. Während Ralf Schmidt eine erneute Vereidigung nicht für notwendig hielt, bestand Simeon Lupus darauf. Bluhm leistete also erneut den Eid als Zeuge.
„Herr Rechtsanwalt Schmidt, der Beklagte hat den Zeugen benannt. Bitte“, sagte der Richter.
„Herr Professor Bluhm, Sie haben sich bei meinem Mandanten gemeldet und mitgeteilt, dass Sie Neuigkeiten hatten. Bitte berichten Sie“, forderte Ralf den Zeugen auf.
„Nach dem letzten Prozesstermin bin ich neugierig geworden, was an den Aussagen des Zeugen Brown dran sein konnte. Ich habe die seinerzeit angegebenen Museen angeschrieben und angefragt, ob a) eine etwa mannshohe Glocke aus Bronze oder einem ähnlichen Material mit klein- oder ostasiatischem Erscheinungsbild im Jahr 2002, speziell um den Herbst dort ausgestellt gewesen ist und b) ob sich bei dem jeweiligen Kurator jemand gemeldet hatte, der eine Glocke der Bronzezeit, eventuell griechischer Provenienz, dort zu finden hoffte. Alle Museen, die der Zeuge Brown angegeben hatte, verneinten – sowohl bezüglich einer solchen ausgestellten Glocke als auch bezüglich einer Anfrage an den Kurator. Ich übergebe dem Gericht mein Anschreiben, das ich jeweils in die Amtssprache der entsprechenden Staaten habe übersetzen lassen, sowie die Antwortschreiben der Museen nebst den entsprechenden Übersetzungen ins Deutsche“, erklärte der Professor und überreichte dem Anwalt die schreiben, die dieser an den Richter weitergab.
„Und weiter erinnerte ich mich einer harschen Kritik, die zur Veröffentlichung des Films erschienen war. Nach einiger Recherche konnte ich ermitteln, dass Herr Julius Wehmeyer von der Hamburger Abendpost für diesen wirklichen Verriss verantwortlich war. Ich habe mich mit ihm in Verbindung gesetzt und erfahren, dass ihn nach Veröffentlichung des Verrisses der Geschäftsführer der Agamemnon-Filmgesellschaft Deutschland angerufen habe und ein Gespräch mit dem Produktionsdesigner angeboten habe. Das würde sicher einige Missverständnisse klären.“
Hauke Schiemann, der neben Anwalt Lupus saß, bekam einen roten Kopf.
„Was für eine dreiste Lüge!“, entfuhr es ihm. Bluhm sah ihn an.
„Oh, das Gespräch mit Herrn Wehmeyer kann ich belegen. Mit seinem Einverständnis habe ich es aufgezeichnet, für den Fall, dass er nicht als Zeuge vernommen werden könnte. Möchten Sie die Aufzeichnung hören?“, bot er an.
„Das … das ist ein abgekartetes Spiel!“, fauchte Schiemann. „Das … das ist getürkt!“
„Herr Richter, ich erhebe Einspruch! Es scheint offensichtlich, dass die Beklagtenseite hier Absprachen zu Lasten meiner Mandantschaft getroffen hat! Wir können durch einen Detektivbericht belegen, dass sich der Beklagte mit dem so genannten Zeugen Bluhm bei seinem Anwalt getroffen hat!“, fuhr Lupus dazwischen.
„Natürlich haben wir uns getroffen“, erwiderte Bluhm, bevor der Vorsitzende Richter etwas sagen konnte. „Ich wollte Herrn Mönke und seinem Anwalt mitteilen, was ich herausgefunden hatte. Und weil ich dann doch nicht so viel Zeit habe, weil ich so ganz nebenbei auch Professor der Archäologie bin und zu lehren habe, haben wir einen Termin bei seinem Anwalt gemacht. Seit wann ist das verboten, bitte?“
„Sie überschreiten Ihre Kompetenzen als Sachverständiger! Sie hatten ein Gutachten zu erstellen, sonst nichts!“, fuhr Lupus ihn an.
„Herr Rechtanwalt, ich bin neben meinem Beruf auch deutscher Staatsbürger. Wenn mir Dinge auffallen, die für einen Rechtsstreit interessant sein können, bin ich diesbezüglich Zeuge und sehe mich auch veranlasst, selbstständig Nachforschungen zu betreiben, wenn ich die entsprechenden Kontakte habe. Ihr Zeuge Brown hat schlichtweg gelogen, als er behauptete, er sei für Inspirationen für die Glocke, die er entwerfen sollte, durch die halbe Welt gereist. Es hat mich wirklich sehr stutzig gemacht, dass jemand, der eine griechische Glocke der Bronzezeit entwerfen soll, x Länder dafür bereist haben will – bloß nicht Griechenland – und als Grund dafür angibt, er kenne sich mit den historischen Glockenformen nicht so aus. Das ist wirklich Schwachsinn in Tüten.“
„Das können Sie im Prozess nicht selbst gehört haben! Sie sind erst nach dem Zeugen Brown vernommen worden!“, hielt Lupus ihm vor.
„Doch, habe ich. Ich habe Sie im Termin sogar danach gefragt und Sie nannten mir die Museen, in denen er sich Inspirationen geholt haben wollte“, erwiderte der Professor kühl. „Sie hätten sich die Mühe mit dem Detektiv auch nicht machen müssen. Ich habe nie die Absicht gehabt, dem Gericht zu verschweigen, dass ich nach dem Termin von mir aus Kontakt zum Beklagten aufgenommen habe. Der Geschäftsführer Ihrer Mandantschaft – ich nehme an, das ist der Herr neben Ihnen – wird Ihnen hoffentlich sagen, dass er mit dem Zeugen Brown bei Herrn Wehmeyer gewesen ist und ihm frank und frei erklärt hat, dass er nicht lange durch die Weltgeschichte gegondelt ist, sondern aus Gründen der Kostenersparnis auf den Tipp von Herrn Wolfson gleich nach Aurich gefahren ist, wo in der Stadtbibliothek das Manuskript von Boris Trojan war – gestiftet von Kapitänleutnant a.D. Gustav Wolfson, der es in von Trojan in Verwahrung genommen hatte, es aber nicht zurückgeben konnte, weil Trojan tot war und seine Familie in der DDR geblieben war, während Wolfson in der Bundesrepublik lebte. Marcus Brown hat sich ausschließlich am Manuskript meines früheren Kollegen Trojan orientiert, als er die Glocke entworfen hat!“
„Das ist eine Ungeheuerlichkeit!“, schnaufte Lupus.
„Ja, das ist es!“, bestätigte Bluhm giftig. „Es ist eine Ungeheuerlichkeit, dass sich der Zeuge der detaillierten Beschreibung einer Glocke in einem unveröffentlichten Manuskript eines Wissenschaftlers bedient, sein Arbeitgeber wider besseres Wissen dies als eigene Idee des angestellten Produktionsdesigners ausgibt und den rechtmäßigen Erben des Forschers obendrein noch mit einem Prozess überzieht, in dem der Produktionsdesigner auch noch schamlos lügt, wenn er dazu befragt wird, was ihm der Name Boris Trojan sagt!“, wetterte er. „Selbstverständlich wusste Brown etwas dazu! Herrn Wehmeyer hat er das jedenfalls ohne zu zögern erzählt – auf Deutsch übrigens, denn Marcus Dwight Brown ist zwar amerikanischer Herkunft, hat aber seine Kindheit in Deutschland verbracht, weil sein Vater als Besatzungssoldat in Deutschland stationiert war. Nachzulesen übrigens auf der Webseite Ihrer Mandantschaft! Deshalb hatte er auch keine Schwierigkeiten, den auf Deutsch geschriebenen Text des Manuskripts ohne weiteres zu verstehen und die passende Stelle zu finden. Was er darin nicht finden konnte, war die Inschrift am unteren Ende der Glocke, denn dazu verweist mein Ex-Kollege Trojan auf eine Abbildung, die allerdings nicht im Manuskript ist.“
Schiemann wurde leichenblass.
„Wo… woher wissen Sie das?“, fragte er.
„Ich will dem Urkundenbeweis nicht vorgreifen“, erwiderte der Professor. „Wenn Sie mir einen persönlichen Rat erlauben: Lassen Sie es jetzt besser bleiben mit diesem Prozess. Der Schuss wird nach hinten losgehen.“
„Herr Professor, die Würdigung von Beweisen ist Sache des Gerichtes, nicht der Zeugen“, wies der Richter ihn zurecht.
„Natürlich“, räumte Bluhm ein.
„Noch weitere sachdienliche Fragen an den Zeugen?“, fragte Dr. Marquardt.
„Nein, keine weiteren Fragen“, erwiderte Lupus hochrot.
„Gut. Ich hätte noch was …“, sagte der Richter. „Ich bitte Herrn Professor Bluhm nochmal aus dem Raum. Warten Sie bitte draußen, bis ich Sie wieder aufrufe.“
„Ja, gewiss“, sagte Bluhm, stand auf und verließ den Gerichtssaal. Als die Tür geschlossen war, fragte Dr. Marquardt:
„Herr Mönke, Sie haben mit dem seinerzeitigen Sachverständigen vor dem Termin gesprochen. Weshalb haben Sie mit ihm Kontakt aufgenommen und was war der Inhalt des Gesprächs?“
„Nun, ich bin ein großer Fan des Schauspielers Jonathan Blanchard, der auch in dem Film Mykene mitgespielt hat. Herr Professor Bluhm hat eine solche Ähnlichkeit mit dem Mann, dass ich im ersten Moment geglaubt habe, die Klägerin hätte ihn als Zeugen aufgeboten. Ich habe ihn angesprochen, weil ich gern ein Autogramm gehabt hätte. Als er mir dann auf Deutsch antwortete, dass er das nicht sei, bin ich vor Scham fast im Boden versunken. Er sagte mir aber auch, dass ich nicht der Erste sei, der ihn mit Blanchard verwechseln würde. Und er sagte mir, wenn es diese Glocke tatsächlich gäbe, wäre es eine wissenschaftliche Sensation. Dass ich ihn auf Englisch um ein Autogramm gebeten habe, müssten im Übrigen auch der Zeuge Brown und der Dolmetscher bestätigen können. Die saßen ebenfalls im Flur in der Nähe von Herrn Rechtsanwalt Lupus, der – wenn er ehrlich ist – das auch gehört haben muss, denn Herr Professor Bluhm und ich haben nicht geflüstert“, erwiderte Jonas.
„Dass es ein unglückliches Licht wirft, wenn sich ein Beklagter und ein Sachverständiger vor dem Gerichtssaal unterhalten, ist Ihnen aber schon klar?“, hakte der Richter nach.
„Ich habe täglich mit Prozessen zu tun, Herr Richter. Auch in Schadenersatzprozessen habe ich mich schon vor Terminen mit geladenen Sachverständigen unterhalten. Das war bisher auch kein Problem. Aber wenn Herr Rechtsanwalt Lupus auf der anderen Seite ist, ist sicher Vorsicht geboten. Das wird mir jetzt so richtig klar“, erwiderte Jonas einigermaßen gefasst.
„Aha“, bemerkte der Richter mit einem Blick auf Rechtsanwalt Lupus. „Dann bitte nochmal den Zeugen Bluhm!“
Roland Bluhm kam zurück und nahm auf Aufforderung des Richters wieder am Zeugentisch Platz.
„Der Beklagte hat Sie vor dem ersten Termin angesprochen. Was wollte er von Ihnen?“, fragte Dr. Marquardt. Bluhm grinste.
„Ein Autogramm, weil er mich mit dem Schauspieler Jonathan Blanchard verwechselt hatte. Das passiert mir häufiger. Ich habe sogar schon spaßeshalber Autogramme gegeben. Er sprach mich auf Englisch an, und ich habe ihm auf Deutsch geantwortet, dass er leider im Irrtum ist. Als ihm dann klar war, wer ich tatsächlich bin, meinte er, mein Gutachten würde wohl ziemlich teuer für ihn werden. Ich meinte dann, das bliebe abzuwarten und bat ihn, auf die Veröffentlichung des Gutachtens zu warten; es gäbe da ein kleines Detail, auf das ich aber außerhalb des Gerichtssales nicht eingehen würde.“
„Gut. Danke Herr Professor. Herr Rechtsanwalt Lupus, dazu noch Fragen an den Zeugen?“
„Nein, keine Fragen.“
„Sie sind dann als Zeuge entlassen. Es steht Ihnen frei, im Publikumsraum Platz zu nehmen“, entließ Dr. Marquardt den Zeugen. Bluhm stand vom Zeugentisch auf und setzte sich in die erste Reihe der bis auf den von Manfred Wendt belegten Platz leeren Publikumssitze.
„Dann bitte den Zeugen Julius Wehmeyer.“
Wehmeyer betrat den Gerichtssaal, wurde zu Personalien und Beruf befragt, dann überließ der Richter den Zeugen dem Anwalt des Beklagten.
„Herr Wehmeyer, Sie haben den Film Mykene von Peter Wolfson im Jahr 2004 wegen der Ausstattung heftig kritisiert und dabei besonders auf die Ihrer Ansicht nach fehlerhafte Glocke hingewiesen. Hat die Agamemnon-Filmgesellschaft darauf reagiert und – falls ja – wie?“, begann Ralf Schmidt.
„Ja, die haben reagiert. ‘N paar Tage später rief mich Herr Schiemann an, der da drüben sitzt, und sagte mir, er sei der Deutschland-Chef von Agamemnon Pictures. Er bot mir ein direktes Treffen mit dem Produktionsdesigner Marcus Brown an“, erklärte der Zeuge.
„Wie haben Sie reagiert?“, fragte Ralf weiter.
„So ’n Angebot bekommt auch ein Journalist nicht jeden Tag. Bin natürlich darauf eingegangen. Ich habe mich mit Herrn Schiemann und Herrn Brown im Studio Hamburg getroffen und war ziemlich verblüfft, als Herr Schiemann mir sagte, dass ich den Produktionsdesigner Brown auch auf Deutsch befragen könne. Er sei zwar Amerikaner, aber als Sohn eines Besatzungssoldaten in Deutschland aufgewachsen. Wir ha’m uns also auf Deutsch unterhalten. Ich hab‘ ihn gefragt, wie er zu dem unpassenden Glockendesign gekommen sei. Er sagte mir – und Herr Schiemann hat das auch bestätigt – dass er eigentlich einige Museen besuchen wollte. Aber die Zeit sei ‘n bisschen knapp geworden, außerdem waren die Schauspieler schon ziemlich teuer gewesen – man hatte große Garde engagiert. Da habe der Produzent und Regisseur Peter Wolfson wohl etwas sparen wollen und habe ihm gesagt: Wenn du ’ne Glocke suchst: In der Bibliothek in Aurich ist ein Manuskript eines Berliner Professors Trojan, den die Nazis von der Uni geschmissen haben, weil er was Falsches rausgefunden hatte. Da ist eine Glocke detailliert beschrieben. Nimm doch die, die müsste etwa passen. Er sagte, er sei im Herbst 2002 dort gewesen, habe sich die Beschreibung abgeschrieben, danach eine Zeichnung angefertigt, die dann Weta Digitals geschickt worden sei. Weta habe danach die Glocke gefertigt – aus dem Originalmaterial Bronze und sogar mit einer Gießtechnik, die den Methoden der Bronzezeit entspräche.
Ich hab‘ dann angemerkt, dass doch mindestens den geschichtlich versierten Zuschauern auffallen müsste, dass die Glocke nicht griechisch, sondern eher trojanisch oder hethitisch aussähe. Da sagte er mir, es ginge ja nicht um eine historisch absolut getreue Dokumentation, sondern um einen Unterhaltungsfilm. Da könne man sich schon gewisse Ungenauigkeiten leisten. Außerdem, das fügte er noch hinzu, sei die Glocke ja nur in drei oder vier Einstellungen zu sehen. Da verstehe er die ganze Aufregung nicht.
Ich sagte ihm es sei mir nicht nur um die Glocke gegangen, sondern auch um die Statuen, die eher nach Ägypten passten. Er sagte mir, auch deren Beschreibungen habe er aus dem Trojan-Manuskript. Er habe mal was anderes als Ausstattung nehmen wollen, Die griechische Bildhauerei der Antike sei sicher schön, aber auch ein bisschen langweilig“, erklärte der Zeuge.
„Danke für die Ausführungen. Wie sind Sie selbst darauf gekommen, dass die Ausstattung nicht so recht passte?“, fragte Schmidt.
„Ich bin Feuilletonjournalist. Kultur interessiert mich. Ich berichte auch über entsprechende Ausstellungen. Glauben Sie, dass ich ’n bisschen Ahnung habe, worüber ich schreibe? Sonst wär‘ ich in dem Job fehl am Platz“, erwiderte Wehmeyer.
„Das ist getürkt!“, entfuhr es Lupus, der mit offenem Mund dasaß. „Was bezahlt Ihnen der Beklagte für diese Aussage?“
Julius Wehmeyer zuckte herum.
„Wenn das jetzt kein Scherz ist, dann rate ich Ihnen, diese Frage gar nicht erst ins Protokoll aufzunehmen! Ansonsten sehe ich mich veranlasst, Sie wegen übler Nachrede anzuzeigen!“, versetzte er kalt. „Ich habe im Übrigen deutlich gemacht, dass ich den neben Ihnen sitzenden Herrn Schiemann wiedererkenne. Der war mit dem Brown im Studio Hamburg!“
„Sie wollen also kein Geld für Ihre Aussage bekommen haben?“
„Nein!“
„Herr Rechtsanwalt, welche Belege haben Sie, dass der Zeuge Wehmeyer bezüglich seiner Aussage Gelder vom Beklagten bekommen hat?“, fragte der Richter. Lupus wurde rot.
„Keine“, gestand er kleinlaut.
„Die Frage wird aus dem Protokoll gestrichen. Herr Rechtsanwalt Lupus, Sie werden hier und jetzt den Zeugen wegen dieser Ungebührlichkeit um Entschuldigung bitten!“, wies Dr. Marquardt ihn an.
„Ich bitte um Entschuldigung“, sagte Lupus. Wehmeyer nickte milde.
„Gewährt“, erwiderte er.
„Weitere Fragen an den Zeugen?“
Beide Rechtsanwälte verneinten.
„Dann kommen wir zum Urkundenbeweis“, sagte der Richter. „Herr Rechtsanwalt Schmidt, bitte.“
„Nach dem ersten Termin sah sich die Familie meines Mandanten veranlasst, Nachforschungen darüber zu betreiben, wo das Manuskript des Professors Trojan verblieben sein konnte. Die Ähnlichkeit der vom Zeugen Brown entworfenen Glocke mit der, die erwiesenermaßen vom verstorbenen Zeugen Hinnerk Trojan gefertigt wurde, war zu verblüffend, um wirklich nur Zufall zu sein. Bei den Recherchen im Internet fand der Vater meines Mandanten eine öffentliche Bekanntmachung der Stadtbibliothek Aurich, dass mögliche Erben von Professor Boris Trojan gesucht würden. Die Mutter meines Mandanten hat sich mit der Bibliothek in Verbindung gesetzt, ist am folgenden Tag nach Aurich gefahren und bekam als beweisbare Nacherbin von Boris Trojan dieses Manuskript ausgehändigt“, sagte Schmidt und präsentierte dem Richter das druckfertige Manuskript, der es an die Klägerseite weitergab. Weder Schiemann noch Lupus wirkten überrascht oder gar ertappt.
„Es enthält die genaue Beschreibung der Glocke, die der Zeuge Brown nur noch abschreiben musste, um sie nachzuzeichnen“, fuhr Schmidt fort.
„Toll!“, warf Lupus ein. „Als ob ein maschinengeschriebenes Manuskript nicht nachgefertigt werden könnte! Wo ist denn der Beweis, dass es sich bei diesen beschriebenen Seiten tatsächlich um das angebliche Manuskript von dem sagenhaften Professor Trojan handelt?“
„Nun, es gibt auch einen Stiftungsbrief, den Kapitänleutnant a. D. Wolfson 1968 an die Stadtbibliothek Aurich schrieb“, sagte Ralf Schmidt und präsentierte die Kopie des Stiftungsbriefes. Der Richter sah darauf und gab auch die Briefkopie an den Klägervertreter weiter. Lupus und Schiemann sahen sich die Kopie an.
„Nett zusammengeschustert. Wo ist das Original?“, fragte Simeon Lupus.
„Dass Sie alles bezweifeln, was der Beklagte vorlegt, ist bekannt. Deshalb ist der Archivar der Stadtbibliothek Aurich auch als Zeuge hier, Herr Kollege“, grinste Schmidt. „In Anbetracht der wieder erheblichen Zweifel, die der Klägervertreter zu einem Beweis der Gegenseite äußert, bitte ich um die Einvernahme des Zeugen Thamsen.“
Richter Dr. Marquardt nickte und betätigte die Taste der Rufanlage auf dem Richtertisch.
„Der Zeuge Tamme Thamsen, bitte“, sagte er.
Der ältere Archivar betrat den Gerichtssaal und nahm auf das Handzeichen des Richters am Zeugentisch Platz.
„Bitte nennen Sie uns Ihren vollen Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihren Beruf“, forderte der Richter ihn auf.
„Mein Name ist Tamme Thamsen, geboren am 15. April 1960 in Aurich. Von Beruf bin ich Archivar in der Stadtbibliothek Aurich“, erklärte der Zeuge.
„Danke, Herr Thamsen. Herr Rechtsanwalt Schmidt, bitte“, gab der Richter dem Anwalt des Beklagten das Wort.
„Danke, Herr Richter. Herr Thamsen, was ist das hier?“, fragte Schmidt und gab dem Zeugen das Manuskript, das inzwischen wieder auf dem Richtertisch war. Thamsen nahm es in die Hand und sah es sich an.
„Das ist ein unveröffentlichtes Manuskript, das der Stadtbibliothek Aurich gestiftet wurde. Im Stiftungsbrief war auch die Auflage, nach eventuellen Erben zu suchen und ihnen das Manuskript zu übergeben. Gestiftet wurde es von einem ehemaligen Marineoffizier, der es während des Krieges vom Verfasser in Verwahrung genommen hatte“, sagte der Zeuge.
„Wann hat die Stadtbibliothek die Suche nach den Erben begonnen?“, fragte Schmidt.
„Ich bin seit 1980 in der Bibliothek tätig. Ob davor schon Versuche unternommen wurden, den oder die Erben ausfindig zu machen, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe das Manuskript erstmals in der Hand gehabt, als Anfang der 2000er danach gefragt wurde.“
„Wer hat danach gefragt und wann war das genau?“, fragte Ralf Schmidt weiter.
„Verzeihen Sie, das muss ich auf der Archivkassette nachsehen“, sagte Thamsen und holte aus der mitgebrachten Aktentasche. Er zog eine Verwahrkassette heraus, die aus starker Pappe bestand, etwas größer war als ein DIN A 4-Blatt und gute zehn Zentimeter hoch war. STADTBIBLIOTHEK AURICH war in schwarzen Lettern in den Deckel eingeprägt, darunter waren zwei Linien, auf denen handschriftliche Eintragungen erkennbar waren. Er klappte den Deckel auf, der mit einem Magneten versehen war, um die Kassette geschlossen zu halten.
„Solche Bücher oder Manuskripte werden bei uns in diesen Kassetten gelagert, wenn sie nicht in der Bibliothek zum Ausleihen oder in der Präsenzbibliothek zum Lesen stehen“, erklärte er. „Hier auf der Innenseite ist eine Liste, in die sich die Entleiher mit Namen und Datum eintragen. Diese hier ist die Kassette, in der das Manuskript dort bei uns gelagert wurde. Nach der Eintragung hier oben war ein Marcus D. Brown am 3. September 2002 der erste Entleiher, der dieses Manuskript eingesehen hat.“
„Marcus D. Brown … das klingt englisch. In welcher Sprache ist das Manuskript geschrieben?“, fragte Ralf Schmidt.
„Auf Deutsch – jedenfalls dem Titel nach. Ich gestehe, ich selber habe es nie gelesen. Aber nach dem Stiftungsbrief war der Verfasser ein Professor, der an der Uni Berlin gelehrt haben soll. Deshalb unterstelle ich, dass es auf Deutsch geschrieben ist“, sagte Thamsen schulterzuckend.
„Und dieser Herr Brown … Hat der das Manuskript in der Bibliothek gelesen oder hat er es mitgenommen?“, fragte der Anwalt weiter.
„Das Teil ist … war … ja nicht unser Eigentum. Aus dem Stiftungsbrief ergibt sich, dass es an mögliche Erben weitergegeben werden wollte. Solche eingeschränkten Stiftungen geben wir nicht aus dem Haus. Dafür gibt es die Präsenzbibliothek, in der Manuskripte wie dieses gelesen werden können.“
„Wie kann man Informationen mitnehmen, die in derartigen Präsenzwerken enthalten sind?“
„Kann man sich abschreiben oder – geht schneller – fotokopieren.“
„Wurden Fotokopien gemacht oder hat der Entleiher nur gelesen?“
„Er hat sich Fotokopien gemacht. Das erkenne ich an dem „F“, das hinter dem Namen steht.“
„War der Entleiher alleine oder in Begleitung?“
„Das weiß ich nicht mehr. Ob Begleitpersonen dabei sind, wird nicht festgehalten. Nach so langer Zeit kann ich mich nur noch auf die schriftlichen Notizen hier stützen.“
„Wie viele Kopien wurden gemacht?
Der Zeuge zuckte mit den Schultern.
„Keine Ahnung. Kopien müssen zwar bezahlt werden, aber die Belege dafür existieren nicht mehr, da die Einsichtnahme länger als zehn Jahre her ist. Länger werden Belege nicht aufbewahrt.“
„Danke, Herr Thamsen. Wann wurde nach Ihrem Kenntnisstand aktiv nach Erben gesucht?“, fragte Schmidt.
„Na ja, praktisch direkt im Anschluss an die Einsicht von Herrn Brown. Als ich das Manuskript weggepackt habe, habe ich den Stiftungsbrief gesehen und daraus den Nachforschungsauftrag entnommen. Noch im September 2002 habe ich an die Freie Universität Berlin geschrieben und die Auskunft bekommen, dass ein Professor Boris Trojan dort nicht bekannt sei. Das Einwohnermeldeamt Berlin teilte mir mit, dass ein Professor Boris Trojan dort nicht verzeichnet sei. Mögliche Zweitwohnsitze – was bei einem Professor denkbar wäre – seien vor 1945 nicht erfasst worden. Aus dem Stiftungsbrief ergab sich, dass der Professor wohl einen Sohn hatte, der möglicherweise auf Usedom geblieben war. Ich habe dann also an den Landkreis Ostvorpommern in Anklam geschrieben und erhielt vom dazugehörigen Amt Usedom-Süd die Nachricht, dass es auf der Insel Usedom nur in Koserow eine Familie Trojan gegeben habe, die 1962 wegen Beihilfe zur Republikflucht aus dem damaligen Bezirk Rostock nach dem Bezirk Magdeburg umgesiedelt worden sei. Weitere Auskünfte müsste ich dort einholen. Von Magdeburg erfuhr ich, dass eine Familie Trojan, bestehend aus Heinrich, Eva und Britta Trojan nach Haftentlassung Heinrich Trojans gegen Devisenzahlung in die Bundesrepublik ausgereist sei und unbekannt verzogen sei. Das Ministerium für innerdeutsche Beziehungen war längst aufgelöst und das Bundesinnenministerium hat meine Anfrage bis heute nicht beantwortet. 2004 hatte dann ein Azubi die Idee mit der öffentlichen Bekanntmachung im Internet. Aber erst jetzt im Juli hat sich Frau Britta Mönke, geborene Trojan gemeldet. Sie konnte mit Geburts- und Sterbeurkunden nachweisen, dass sie die gesuchte Erbin ist. Daraufhin habe ich ihr das Manuskript ausgehändigt.“
„Danke, Herr Thamsen. Ich habe keine weiteren Fragen an den Zeugen“, erklärte Rechtsanwalt Schmidt.
„Herr Rechtsanwalt Lupus?“, fragte der Richter.
„Ich würde gern mal die Verwahrkassette sehen“, bat Lupus. Der Zeuge gab ihm die Kassette. Lupus öffnete sie und zeigte Hauke Schiemann die Unterschrift von Marcus Brown. Schiemann schluckt sichtbar, Lupus schüttelte kaum sichtbar den Kopf.
„Nun ja, der Brief sieht ziemlich alt aus“, räumte er ein. „Aber wer sagt, dass das hier wirklich die Unterschrift des Zeugen Brown ist?“, fragte er.
Der Richter nahm die Gerichtsakte, in der auch die Empfangsbekenntnisse der geladenen Parteien und Zeugen waren.
„Hm, das hat der Brown in beiden Fällen nicht selbst unterschrieben“, sagte er. „Der Zeuge Brown und Dolmetscher Berger, bitte“, rief er Marcus Brown über die Sprechanlage herein.
Zeuge und Dolmetscher betraten den Gerichtssaal.
„Ich brauche aktuell nur eine Unterschrift, Herr Brown. Bitte schreiben Sie hier Ihren Namen, als würden Sie unterschreiben“, sagte der Richter und reichte dem Zeugen ein Blatt Papier und einen Stift. Der Dolmetscher übersetzte und Brown unterschrieb wie erbeten auf dem Papier.
„Danke sehr. Herr Wendt, würden Sie diese beiden Unterschriften bitte in Augenschein nehmen?“, wandte sich der Richter an den weiterhin anwesenden Schriftsachverständigen. Wendt stand auf und kam zum Richtertisch. Er sah sich die Unterschriften auf der Verwahrkassette und dem Blatt Papier an.
„Die Unterschriften sind identisch und von derselben Person geschrieben“, sagte er.
„Danke, Herr Wendt“, sagte der Richter. „Ich ordne jetzt eine Sitzungspause von einer halben Stunde an. Der Klägerseite gebe ich in diese Pause die Empfehlung mit, darüber nachzudenken, ob die Klage aufrechterhalten wird oder ob sie zurückgenommen wird. Die Sitzung wird um 14.00 Uhr fortgesetzt“, verkündete der Vorsitzende Richter, räumte seine Unterlagen zusammen und verließ mit den anderen Richtern den Gerichtssaal.
Kapitel 11
Entscheidung
Die Prozessbeteiligten verließen den Gerichtssaal.
„Herr Kollege, ich würde mich gern mit meiner Mandantschaft und dem Zeugen Brown besprechen – ohne weitere Ohren“, sprach Simeon Lupus Ralf Schmidt an. Der zuckte mit den Schultern.
„Von mir aus“, sagte er. „Lassen wir die Klägerin und ihren unglaublichen Zeugen allein“, sagte er zu Jonas. Sie beide gingen mit Tamme Thamsen und Roland Bluhm hinaus. Der Tag war trüb und kalt, aber immerhin trocken.
„Halbe Stunde ist nicht viel. Aber mir knurrt gehörig der Magen“, bemerkte Jonas.
„Gehen wir ’rüber ins Restaurant September“, schlug Ralf Schmidt vor. „Da gibt’s auch was Schnelles.“
Er wies von der Freitreppe des Gerichtsgebäudes nach links zur Ecke Feldstraße/Holstenglacis, an der das Restaurant lag. Es waren nur knappe hundertfünfzig Meter Fußweg bis dort. Sie gingen hinüber, suchten sich dort einen Stehtisch, Ralf Schmidt holte vier Burger, die sie an dem Stehtisch verspeisten.
„Was meinen Sie, Herr Schmidt: Machen die jetzt einen Rückzieher?“, fragte Jonas. Der Anwalt zuckte mit den Schultern.
„Es wäre klüger, denn nach allem, was wir heute gehört haben, kann der Richter nur die Klage abweisen. Dann allerdings ist die Sache fix, daran gibt’s dann nix mehr zu rütteln. Bei einer Klagabweisung durch den Richter wäre Berufung möglich, auch wenn man ziemlich besoffen sein muss, um bei dieser Beweislage Berufung einzulegen. Wir werden sehen, was passiert“, erwiderte er.
„Es ist jetzt ja klar, dass die Quelle für die Glocke in Mykene Uropas Beschreibung war. Könnte man da den Spieß nicht umdrehen?“, fragte Jonas. Schmidt schüttelte den Kopf.
„Nein. Ihr Urgroßvater hat eine historische Glocke beschrieben, die fast dreieinhalbtausend Jahre alt ist. Der Künstler, der sie geschaffen hat, ist also deutlich mehr als siebzig Jahre tot, womit die Glocke künstlerisch gemeinfrei ist. Die kann jeder abpinseln und verwenden, wie er lustig ist“, wehrte er ab.
„Mit dem Manuskript müsste das Museum doch eigentlich die Spur der Glocke wieder aufnehmen können“, mutmaßte Jonas. „Dann könnten Sie das gut überprüfen, was Uropa da zusammengetragen hat“, wandte er sich an den Archäologen.
„Wenn in dem Manuskript irgendwo die Nummer genannt ist, unter der das Museum sie seinerzeit registriert hat, dann schon“, meinte Bluhm. „Haben Sie es darauf schon geprüft?“
„Nein, bisher noch nicht. Aber wenn der Prozess vorbei ist, werde ich wohl endlich Gelegenheit dazu haben“, erwiderte Jonas. „Mal angenommen, der Richter weist die Klage jetzt ab und begründet das auch mit der offensichtlichen Unwahrheit, die dieser … Zeuge … Brown gesagt hat. Wird der eigentlich von Amts wegen belangt? Ich meine, das ist doch eine uneidliche Falschaussage, was der da von sich gegeben hat“, wandte er sich an den Anwalt.
„Ja, denn eine bewusste Falschaussage ist Prozessbetrug. Und Betrug wird von Amts wegen verfolgt“, erwiderte Schmidt.
„Sie haben den Brief von Jonathan Blanchard nicht erwähnt, der ja darauf hingewiesen hat, dass Brown außer dem Entwurf Weta ein Foto von der Glocke geschickt hat, das mein Urgroßvater gemacht haben soll. Wieso nicht?“, fragte Jonas den Anwalt.
„Gemacht haben soll ist der richtige Ausdruck, Herr Mönke. Auch Mr. Blanchard weiß das nur um drei Ecken“, erwiderte Schmidt. „Der andere Grund ist: Sie sind ein großer Fan von ihm und würden ihn gewiss gern in weiteren Filmen sehen. Als Schauspieler ist er auf Rollenangebote angewiesen. Wenn er in einem Prozess gegen einen potenziellen Arbeitgeber aussagt – und er hat ja in Mykene schon für Agamemnon Pictures gearbeitet – dann besteht die Gefahr, dass er auf so ’ne Schwarze Liste gerät. Das könnte das Ende seiner Schauspielkarriere sein. Ich denke nicht, dass es in Ihrem Sinne als sein Fan wäre, ihm so ein Bein zu stellen. Also, dessen Aussage würde im Moment nicht wirklich etwas bringen, und es würde seine Karriere möglicherweise gefährden. Das sollten wir nicht machen.“
„Okay, das verstehe ich“, erwiderte Jonas nickend.
Kurz vor zwei Uhr waren Jonas und seine Begleiter wieder zurück im Gerichtssaal. Auch Lupus und Schiemann waren samt dem Zeugen Brown wieder anwesend. Das Richterkollegium kam mit seinen Unterlagen, der Vorsitzende bat die Prozessbeteiligten, Platz zu nehmen, nachdem er den Zeugen Brown und den Dolmetscher wieder hinausgeschickt hatte.
„Die Sitzung wird um 14.00 Uhr fortgesetzt“, sprach er ins Diktiergerät, das er dann beiseite legte. „Herr Lupus, ich hatte Ihnen eine Denksportaufgabe für die Pause mitgegeben. Will Ihre Mandantin die Klage zurücknehmen?“
„Herr Schiemann ist zwar Geschäftsführer der Agamemnon-Filmgesellschaft Deutschland, die formal auch die Klägerin ist, aber er kann über die Prozessführung nicht allein entscheiden. Um die Klage zurückzunehmen, benötigt er das Einverständnis von Herrn Wolfson. Angesichts des Zeitunterschieds können wir die Zentrale in Los Angeles aktuell auch nicht von der Anregung des Gerichtes in Kenntnis setzen“, erklärte Lupus. „Ich beantrage daher das Ruhen des Verfahrens, bis Herr Schiemann das Einverständnis von Herrn Wolfson eingeholt hat.“
„Ist der Beklagte mit dem Ruhen des Verfahrens einverstanden?“, wandte sich der Richter an Jonas und seinen Anwalt.
„Mir scheint das eine Hinhaltetaktik zu sein, um dem Zeugen Brown die Möglichkeit zu geben, sich rechtzeitig abzusetzen, bevor er wegen uneidlicher Falschaussage belangt wird“, erwiderte Jonas, bevor Rechtsanwalt Schmidt etwas sagen konnte. „Es ist offensichtlich, dass der … Zeuge … Brown gelogen hat, als er behauptete, er habe die Glocke nach eigener Fantasie gestaltet und als er sagte, der Name Boris Trojan sage ihm nichts. Die Anwaltsvollmacht war von Herrn Schiemann unterschrieben. Dann dürfte er wohl auch die Vollmacht haben, Prozessentscheidungen zu treffen!“
„Über Unterschriften unter Vollmachten streiten wir uns ja häufiger, Herr Mönke …“, setzte Lupus an, aber Jonas unterbrach ihn:
„In der Regel darüber, ob mein Arbeitgeber Anspruch auf das Original einer Vollmacht Ihrer Mandanten hat oder sich mit Fotokopien begnügen muss. Vollmachten, die Sie aus dem Hause meines Arbeitgebers bekommen, unterschreibe nicht ich, sondern mein Abteilungsleiter und sein Stellvertreter schön mit ppa., auch wenn ich gelegentlich bei Gericht erscheinen darf. Ihr Auftraggeber ist Herr Schiemann, also soll er auch eine Entscheidung darüber treffen, ob er die Klage zurücknimmt oder nicht. Und zwar jetzt!“
„Sie reagieren etwas angefressen, Herr Mönke“, spottete Lupus.
„Da wundern Sie sich noch? Ihre Mandantschaft verlangt von mir ohne jeden Rechtsgrund mal eben zehntausend Euro, strengt einen Prozess an, der unnötig ist wie ein Kropf, das gerichtliche Verfahren ergibt unter dem Strich, dass ein solcher Anspruch tatsächlich nicht gegeben sein kann, weil der Designer sich der Beschreibung einer Glocke bedient, die mein Urgroßvater haarklein ausgeführt hat; die Tatsache, dass es dieses Manuskript, was Sie immer wieder bezweifelt haben, tatsächlich gibt, wird mir beziehungsweise meiner Mutter auf ausdrückliche Nachfrage geflissentlich verschwiegen – und ich soll mich nicht aufregen? Geht’s noch? Nein, ich verlange, dass Ihre Mandantschaft jetzt eine Entscheidung trifft. Ich wüsste auch nicht, was Herr Wolfson dagegen haben könnte, die Klage zurückzunehmen, wenn er selbst dem Designer den Tipp gegeben hat, sich diese Glockenbeschreibung doch mal anzusehen. Ich frage mich ernsthaft, ob Herr Wolfson überhaupt über diesen Prozess unterrichtet ist. Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, wenn er den Designer schon nach Deutschland schickt, um sich der geistigen Ergüsse eines anderen zu bedienen.“
Lupus sah Schiemann an, der den Kopf schüttelte. Lupus nickte, er hatte verstanden.
„Die Klage wird nicht zurückgenommen“, erklärte er. Richter Dr. Marquardt peilte über den Brillenrand zum Klägeranwalt.
„Ich weiß zwar nicht, was Sie damit bezwecken, aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Es bleibt noch die nochmalige Zeugenvernahme des Zeugen Brown. Besteht der Klägervertreter auf einer nochmaligen Aussage des Zeugen?“
Lupus und Schiemann sahen sich erneut an, erneut schüttelte Schiemann den Kopf. „Nein, es wird nicht auf einer erneuten Aussage bestanden“, erklärte Lupus.
„Will der Beklagte den Zeugen erneut vernommen wissen?“, fragte der Richter in Jonas‘ Richtung. Diesmal verständigten sich Ralf Schmidt und Jonas Mönke mit Blicken.
„Der Beklagte besteht nicht auf einer erneuten Befragung des Zeugen und stellt es in das Ermessen des Gerichtes, den Zeugen zu vernehmen oder ohne dessen weitere Aussage eine Entscheidung zu treffen“, erklärte Schmidt für Jonas.
„Dann ist die Beweisaufnahme hiermit abgeschlossen“, sagte Dr. Marquardt. Er drückte die Taste der Sprechanlage und bat den Zeugen und den Dolmetscher herein, wies ihnen Plätze in den weitgehend leeren Publikumsreihen an.
„Bitte erheben Sie sich für die Urteilsverkündung“, forderte er Prozessbeteiligte und Publikum auf. Gehorsam erhoben sich die Richter und die Leute im Gerichtssaal, dass die Stühle quietschten. Dr. Marquardt nahm ein Blatt Papier zur Hand und trug vor:
„In der Sache Agamemnon Pictures, vertreten durch Agamemnon Filmgesellschaft Deutschland in Hamburg, vertreten durch Rechtsanwalt Simeon Lupus gegen Jonas Mönke, vertreten durch Rechtsanwalt Ralf Schmidt ergeht im Namen des Volkes das Urteil: Das Landgericht Hamburg hat auf mündliche Verhandlung vom 19. November 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Marquardt und die Richter Heinemann und Schuster für Recht erkannt: Die Klage wird abgewiesen. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.“
Er sah von dem Blatt auf.
„Bitte nehmen Sie Platz“, bat er. Erneut quietschten die Stühle, als Beteiligte und Publikum sich wieder setzten.
„Tatbestand: Die Klägerin trägt vor, der bei ihr angestellte Produktionsdesigner Marcus Dwight Brown habe für den von ihr produzierten Film Mykene, veröffentlicht im Mai 2004, eine Bronzeglocke entworfen, die von Weta Digitals aufgrund dieses Entwurfes hergestellt wurde. Die Rechte am Bild der von Marcus Dwight Brown entworfenen Glocke und deren Verwertung beansprucht die Klägerin gemäß § 43 Urheberrechtsgesetz für sich.
Eine nahezu gleiche Glocke verwendet der Beklagte als digitalisierte Tuschezeichnung auf dem Einband seines Romans Die Glocke des Todes, veröffentlicht im Felder-Verlag Hamburg im März 2012.
Die Klägerin hat nach Feststellung dieser Nutzung den Beklagten mit Schreiben vom 22. Februar 2013 gemäß § 97a Urheberrechtsgesetz abgemahnt und vom Beklagten die Unterzeichnung einer strafbewehrten Unterlassungserklärung verlangt. Er sollte danach die weitere Nutzung des Bildes unterlassen und die bereits verkauften Exemplare seines Romans auf eigene Kosten aus dem Verkehr ziehen lassen. Die Klägerin bot dem Beklagten gleichzeitig an, falls er sich zu solcher Leistung nicht in der Lage sähe, für die Nutzung des Bildes eine erste Pauschale von 10.000 € zu bezahlen sowie für jedes weitere verkaufte Exemplar eine Lizenzgebühr von 1 €.
Der Beklagte lehnte die Forderung der Klägerin mit Schreiben vom 26. Februar ab und verwies darauf, dass er gar nicht die Glocke des Filmes auf dem Einband verwende, sondern eine bereits vor 1998 von seinem Großvater Heinrich, genannt Hinnerk, Trojan gezeichnete Tuschezeichnung, die er digitalisiert habe. Hilfsweise wies der Beklagte darauf hin, dass er für jedes verkaufte Exemplar seines Buches lediglich 0,50 € erhalte, und dass die Forderung, die er ausdrücklich bestritt, schon deshalb unverhältnismäßig sei.
Die Klägerin hat mit Klage vom 1. März 2013 Klage erhoben und verlangt eine pauschale Lizenzgebühr von 10.000 € zuzüglich je 1 € je weiterem verkauften Exemplar und beantragt, dem Beklagten die Kosten des Rechtsstreites aufzuerlegen. Als Zeuge für den Anspruch wird der Produktionsdesigner Marcus Dwight Brown benannt.
Der Beklagte bestreitet den Anspruch der Klägerin und trägt vor, er habe eine Zeichnung seines Großvaters Hinnerk Trojan für die Titelillustration seines Buches Die Glocke des Todes verwendet. Als Zeugen für seinen Vortrag benennt er seinen Großvater Hinnerk Trojan sowie seine Eltern, Britta Mönke, geborene Trojan, und seinen Vater Bernd Mönke. Ergänzend beantragt er ein Sachverständigengutachten mit der Fragestellung, ob es weitere solche Glocken gebe, ob die Glocken tatsächlich identisch sind und welchem Kulturkreis sie zuzuordnen sind. Er beantragt, die Klage abzuweisen und der Klägerin die ihm durch die Klage entstandenen Kosten aufzuerlegen.
Das Landgericht hat zu den unterschiedlichen Tatsachenbehauptungen Beweis erhoben.
Der signierte und mit dem Jahr datierte Entwurf der Glocke des Produktionsdesigners Brown sowie eine Fotografie derselben wurden dem Landgericht als Beweismittel übergeben. Der Beklagte reichte eine ebenfalls signierte, aber undatierte Tuschezeichnung als Beweismittel ein, sowie das Attest des Hausarztes des Zeugen Trojan, dass dieser seit dem Jahr 1998 erblindet war.
Der als Zeuge des Beklagten benannte Heinrich Trojan verstarb am 2. Mai 2013, so dass er bereits im ersten Termin vom 7. Mai 2013 nicht mehr als Zeuge zur Verfügung stand.
Der als Zeuge der Klägerin benannte Produktionsdesigner Marcus Dwight Brown hat – in Übersetzung durch den vereidigten Dolmetscher Carsten Berger – ausgesagt, dass er die im Film Mykene verwendete Glocke in der Planungsphase des Films im Herbst 2002 entworfen habe. Die Glocke sei in zwei Requisitenausstellungen in einem Glaskasten öffentlich zu sehen gewesen. Ein guter Zeichner hätte die Glocke auch ohne weiteres von einem Foto abzeichnen können, das die Klägerin auf ihrer Webseite öffentlich zeigt. Der einzige Unterschied zur Glocke, die der Beklagte verwendet hatte, sei die Inschrift am unteren Ende der Glocke, die der Beklagte um eine Reihe Keile ergänzt habe. Der Zeuge erklärte, er habe in der Planungsphase diverse Museen besucht – er nennt ausdrücklich das Ägyptische Museum in Kairo, die Ausgrabungen in Hissarlik in der Türkei, den Louvre in Paris, das British Museum in London sowie das Pergamon-Museum in Berlin – um sich für den Entwurf inspirieren zu lassen. Den Umstand, dass er für den Entwurf eine antiken griechischen Glocke Reisen nach Ägypten, ins antike Troja, nach Paris, London und Berlin unternahm, aber gerade kein griechisches Museum aufgesucht haben will, begründet der Zeuge mit seinem mangelhaften Wissen um die Unterscheidungsmerkmale zwischen griechischem und trojanischem Stil. Er trägt weiter vor, er habe etwas Einzigartiges entwerfen wollen, das stets mit diesem Film in Verbindung gebracht werden solle, auch wenn die Glocke nur in wenigen Einstellungen im Film überhaupt zu sehen sei. Die Entwürfe veröffentliche er im Gegensatz zu Berufskollegen nicht, da er seit Jahren bei Agamemnon-Film fest angestellt sei und deshalb keine Reklame für sich machen müsse. Die Frage, ob ihm der Name Boris Trojan etwas sage, hat der Zeuge ausdrücklich verneint.
Die als Zeugen des Beklagten benannten Eltern des Beklagten haben die Tuschezeichnung als Werk des verstorbenen Zeugen Trojan erkannt und erklärt, dass diese Zeichnung in dem Zeitraum zwischen 1991 und 1995 entstanden sein muss, da die Zeichnung bereits in dessen eigener Wohnung gehangen habe, die er 1995 aufgegeben habe. Die von ihm gezeichnete Glocke habe der verstorbene Zeuge Trojan gegenständlich vor 1930 im Museum für Hamburgische Geschichte gesehen, er habe auch eine detaillierte Beschreibung der Glocke gehabt, die sein Vater Boris Trojan – der Urgroßvater des Beklagten – in seiner Eigenschaft als Professor der Archäologie bereits vor 1930 im Auftrag des Museums erforschen sollte, was wegen Streichung von Mitteln im Zuge der Weltwirtschaftskrise unterblieb. Erst im Auftrag der Regierung des so genannten Dritten Reiches habe er die Herkunft der Glocke erforschen können und festgestellt, dass sie aus dem antiken Troja stammte und mit den im Zuge der Auseinandersetzungen der mediterranen Küstenvölker mit den Seevölkern von Flüchtlingen über die heutige Ukraine in die versunkene Ostseestadt Vineta gebracht worden war. Weil dieses Ergebnis – es schloss eine nordische Herkunft der Vineter aus – den zuständigen Behörden ideologisch missfiel, sei er in Ungnade gefallen und im KZ Trassenheide während des Krieges ums Leben gekommen. Diese Glocke habe eine so einschneidende Veränderung im Leben des verstorbenen Zeugen Trojan bewirkt, dass sie ihn sein Leben lang beschäftigt habe. Der Beklagte habe ausschließlich die Zeichnung seines verstorbenen Großvaters verwendet und nicht die Glocke aus dem 2004 veröffentlichten Film. Es gebe ein Manuskript, das Boris Trojan noch verfasst habe, es gebe vermutlich auch Fotos, doch seien diese Dokumente verschollen.
Eine große Ähnlichkeit der von Heinrich Trojan gezeichneten Glocke mit der im Film Mykene sei der Familie gleich nach Veröffentlichung des Films aufgefallen, doch sei man davon ausgegangen, dass die Glocke im Film vermutlich ähnlichen historischen Exemplaren nachgestaltet sei.
Der Vater des Beklagten hat ausgesagt, dass er eine Auseinandersetzung wegen der Ähnlichkeit der Glocken zwar befürchtet habe, er hat aber deutlich gemacht, dass sein Sohn keinesfalls die Glocke aus dem Film abgezeichnet hat, sondern sich ausschließlich an der Zeichnung seines Großvaters orientiert habe. Eine Abzeichnung aus dem Film sei auch gar nicht möglich gewesen, weil die Glocke darin nie vollständig zu sehen sei und selbst bei Kombination der möglichen Bilder Lücken verblieben. Auch sei eine Abzeichnung von dem auf der Webseite der Klägerin veröffentlichten Ausstellungsfoto nicht möglich, weil das Foto am Rand starke Randverzerrungen aufweise, die ein normaler Zeichner beim abzeichnen in seine Zeichnung übernehmen würde.
Der Sachverständige, Professor für Archäologie an der Universität Hamburg, Roland Bluhm, erklärt in seinem Gutachten, dass weder die Glocke im Film der Klägerin noch die des Beklagten bekannte antike griechische Vorbilder haben, sondern sowohl von der Größe als auch den Schmuckelementen eher im klein- oder ostasiatischen Raum vorkämen, allerdings deutlich nach der Antike. Der Sachverständige, dem von der Klägerin lediglich das Foto und nicht der Entwurf nicht zur Verfügung gestellt wurde, weist ebenfalls darauf hin, dass eine direkte Abzeichnung vom Foto Randverzerrungen ergeben würde. Er hat dies auch belegt, indem er seine Studenten die Glocke testweise im Rahmen einer Lehrveranstaltung abzeichnen ließ. Alle Testzeichnungen hatten die erwähnten Randverzerrungen. Der Sachverständige stellt ergänzend fest, dass die Inschrift am unteren Rand der Glocke auf der signierten Tuschezeichnung und auf dem Bucheinband einen sinnvollen Satz ergeben, nämlich, dass die Glocke ein Geschenk des hethitischen Königs an den König von Troja sei. Bei der Keilschrift auf dem Foto fehle die unterste Reihe der Keile, womit der Sinn nicht mehr gegeben sei. Im Gutachten führte er dies – unter der Voraussetzung, dass die Glocke vom Foto abgezeichnet sei – zunächst auf die Randverzerrungen am unteren Rand der Glocke zurück. Auf dem ihm erst im Termin zugänglichen Entwurf fand der Sachverständige dieselben Schriftzeichen wie auf der Glocke im Film, die im Gegensatz zu den Schriftzeichen auf der vom Beklagten gezeichneten Glocke eben keinen Sinn ergeben.
Die Klägerin hat daraufhin bestritten, dass die Kombination der Keilschriftzeichen überhaupt einen Sinn ergibt und bestritt zudem die Echtheit der Signatur unter der Tuschezeichnung.
Bezüglich des bestrittenen Sinnes der Inschrift ist die Klägerin den Beweis schuldig geblieben.
Bezüglich der Echtheit der Signatur wurde ergänzend Beweis durch Sachverständigengutachten erhoben. Der Schriftsachverständige Wendt führt überzeugend aus, dass die Signatur unter der Tuschezeichnung von derselben Person stammt wie die Unterschrift auf dem vom Beklagten vorgelegten Personalausweis des verstorbenen Zeugen Trojan. Er führt ergänzend aus, dass die Handschrift zu einem Menschen passt, der deutlich von 1940 eingeschult wurde, was zum verstorbenen Zeugen Trojan passt. Den Vortrag der Klägerin, der Beklagte könne die Handschrift kopiert haben, weist der Sachverständige dahingehend zurück, dass eine kopierte Handschrift von Unterbrechungen innerhalb der kopierten Wörter geprägt ist. Das sei bei der Signatur aber definitiv nicht der Fall. Zur Überzeugung des Gerichtes ist die Signatur unter der Tuschezeichnung als echt anzusehen und diese Zeichnung mithin dem seit 1998 definitiv blinden, verstorbenen Zeugen Heinrich Trojan zuzuordnen.
Der Zeuge Professor Bluhm hat eigeninitiativ die Museumsbesuche des Zeugen Brown überprüft und überzeugende Beweise dafür vorgelegt, dass der Zeuge Brown in dem von ihm selbst genannten Zeitraum die von ihm angegebenen Museen überhaupt nicht besucht hat und auch keinen Kontakt zu den jeweiligen Kuratoren gesucht hat. Er konnte auch den Zeugen Wehmeyer ausfindig machen, der mit dem Produktionsdesigner Brown und dem Geschäftsführer der formalen Klägerin, der Agamemnon-Filmgesellschaft Deutschland im Jahr 2004 ein Interview geführt hat. Im Zuge dieses vom Zeugen Wehmeyer wiedergegebenen Interviews hat der Zeuge Brown eingeräumt, Form und Aussehen der Glocke nach einem in der Stadtbibliothek Aurich befindlichen Manuskriptes des emeritierten Professors Trojan gestaltet zu haben.
Der Beklagte konnte nach Recherchen im Internet das Manuskript seines Urgroßvaters ausfindig machen und den Zeugen Thamsen benennen, der mittels Unterschrift des Zeugen Brown dargelegt und bewiesen hat, dass dem Zeugen Brown nicht nur der Name Professor Boris Trojan etwas sagen musste, sondern dass er darüber hinaus das Manuskript des Professors Trojan entgegen seiner Aussage sehr wohl kannte.
Es ist daher festzustellen, dass der Zeuge Brown bezüglich seiner Recherchen vor dem Entwurf schlicht gelogen hat. Die Glocke ist als Entwurf und Zeichnung zwar sein eigenes Werk, die er nach der detaillierten Beschreibung in Trojans Manuskript gezeichnet hat. Die von Trojan beschriebene Glocke ist ein gemeinfreies Werk, so dass er mit der Nutzung der Beschreibung selbst keine Urheberrechtsverletzung begangen hat. Ansprüche aus der Verletzung des Urheberrechtes erwachsen der Klägerin jedoch nicht, denn der Beklagte hatte sich eben nicht des Werkes des Zeugen Brown bedient, sondern das erwiesenermaßen früher existente Werk seines Großvaters verwendet. Ob dieser sein Einverständnis zur Nutzung gegeben hat, kann dahingestellt bleiben, da es sich nicht auf das Verhältnis zwischen der Klägerin und dem Beklagten auswirkt. Ebenso kann dahingestellt bleiben, ob die Forderung der Klägerin unverhältnismäßig war, da ein Anspruch aus der Verletzung des Urheberrechtes der Klägerin mangels Nutzung des Entwurfs des Zeugen Brown überhaupt nicht in Betracht kommt. Daher war die Klage abzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.
Gegen den Zeugen Brown ergeht Anzeige wegen des Vergehens des Prozessbetruges infolge uneidlicher Falschaussage.
Gegen dieses Urteil ist gemäß § 511 ZPO Berufung vor dem Oberlandesgericht Hamburg zulässig. Sie beträgt gemäß § 571 ZPO einen Monat, beginnend mit der Zustellung des schriftlichen Urteils an die Prozessparteien.
Die Sitzung ist geschlossen.“
Kapitel 12
Planung
Jonas erwischte sich beim Aufatmen, aber der Blick zu dem völlig entsetzten Hauke Schiemann ließ das Gefühl entstehen, dass dieser Richterspruch nicht das letzte Wort in dieser Angelegenheit war. Zehntausend Euro plus x zu verlieren und obendrein die Prozesskosten für diesen Gegenstandswert am Hals zu haben, die zwei wohl nicht gerade billige Gutachten beinhalteten, würde der nach Jonas‘ erster Einschätzung wohl nicht auf sich sitzen lassen. Der junge Mann nahm sich vor, die Einkünfte aus den Buchverkäufen, die ihm nach Abzug der Steuer geblieben waren, solange nicht für den nächsten Urlaub zu verplanen, bis das Urteil rechtskräftig war.
Dennoch ging er an diesem Abend mit seinen Eltern essen, um den Erfolg des erstinstanzlichen Urteils zu feiern.
„Sag mal – was anderes: Was hast du mit deinem Buch eigentlich bislang verdient?“, fragte Bernd, um seinen Sohn auf andere Gedanken zu bringen und Interesse an dessen literarischer Arbeit zu signalisieren.
„Geld“, grinste Jonas. „Steine akzeptiere ich nicht und Sand kann ich nicht zählen.“
Bernd nickte seufzend. Der Ansatz war wohl unpassend gewesen.
„Jonas, es tut mir Leid, dass ich an deinem Talent gezweifelt habe. Mach es mir jetzt bitte nicht schwerer als nötig, wenn ich Interesse für das zeige, was du tust.“
„Sieh du mir bitte nach, dass ich zurückhaltend bin mit dem, was ich dir zu meinem Hobby sage. Du hast mich vielleicht einmal zu oft vor den Kopf gestoßen. Jetzt fragst du mich nach dem, was mein Tun einbringt, nicht wirklich nach meinem Tun außerhalb meines eigentlichen Berufes. Was soll ich davon halten?“, entgegnete Jonas.
„Hört bitte auf!“, fuhr Britta dazwischen. „Statt dass wir uns freuen, gemeinsam die Bedrohung durch diesen Prozess abgewendet zu haben, stellst du, Bernd, die falsche Frage und du, Jonas, schaltest gleich wieder auf stur! Könnt ihr nicht wenigstens mal von guten Absichten ausgehen?“
„Ich habe es versucht und mir böse Sticheleien dafür eingehandelt, Mama. Da ziehe ich mich lieber gleich ins Schneckenhaus zurück“, erwiderte Jonas mit nicht zu überhörender Bitterkeit. Britta nickte, während Bernd schuldbewusst in seinem Salat pickte.
„Na schön, dann versuche ich mal, den Gordischen Knoten zu zerkloppen: Die beiden ersten Auflagen sind ausverkauft. Die erste Auflage hatte fünftausend Exemplare, die zweite dreißigtausend. Ratzeputz ausverkauft!“, erklärte sie. „Was die Steuer davon übrig lassen wird, wird sich noch zeigen, aber ein paar tausend Euro werden hoffentlich bleiben. Was hast du mit dem Geld eigentlich vor, Jonas?“
Der junge Mann war versucht, zu sagen, dass es niemanden etwas angehe, was er mit seinem Geld tun würde, aber andererseits saß er hier mit seinen Eltern zusammen.
„Na ja … Auf der Bank kriegt es nicht mal Junge in Form von Zinsen, solange die EZB bei ihrer Null-Zins-Politik bleibt. Und wenn’s ganz übel kommt, darf ich sogar noch dafür bezahlen, dass ich Geld auf der Bank habe. Spekulative Anlagen sind nicht mein Ding. Bleibt also Betongold. Für eine weitere Wohnung oder ein Haus reicht es noch nicht, aber Opas altes Haus auf Usedom, das du als Ferienhaus vermietest, Mutz, könnte damit gründlich saniert werden. Ich traue mich nur nicht, es anzutasten, solange das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.“
„Die einstweilige Verfügung des Gerichtes ist doch aufgehoben“, wunderte sich Bernd. „Du kannst über das Geld verfügen.“
„Ja, aber die können noch Berufung einlegen, Paps. Ich kenne den Lupus zu gut, um ihm von hier bis aus der Tür zu trauen.“
„Junge, die müssen nach dem Urteil doch mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn sie sich dagegen sträuben!“, erwiderte Bernd lachend.
„Die Meinung teile ich – was die Tatsachen betrifft. Aber der Schiemann hat so entsetzt aus der Wäsche geguckt, dass der Schuss wirklich nach hinten losgegangen ist, dass ich befürchte, er wird Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um den Prozess fortzusetzen. Und bei dem Glück, das ich im Moment habe, male ich mir ein zweitinstanzliches Urteil lieber nicht aus.“
„Du glaubst doch nicht etwa wirklich an diesen Fluch? Junge, komm mal im 21. Jahrhundert an!“, versetzte sein Vater.
„Nun, nach allem, was ich in Urgroßvaters Manuskript gelesen habe, bin ich nahe daran. Wer immer sich auch nur mit der Glocke beschäftigt, scheint vom Unglück verfolgt zu sein“, gab Jonas zu bedenken. Der Kellner kam und servierte die bestellten Speisen.
„Guten Appetit, die Herrschaften“, wünschte er, als er die Teller abgestellt hatte. Die Mönkes dankten und machten sich über die leckeren Steaks her. Jonas und Bernd würzten noch mit Steakpfeffer nach.
„Hmm, lecker!“, schwärmte Britta und ließ sich das butterzart gegrillte Fleisch auf der Zunge zergehen. „So sicher wie das Amen in der Kirche: In diesem Leben werde ich nicht mehr Vegetarier oder Veganer!“
Ihre Männer grinsten mit vollen Backen. Auf sie traf diese These ebenso zu.
„Das Steak spricht jedenfalls nicht dafür, dass wir vom Pech verfolgt sind!“, grinste Bernd kauend. Er wischte sich den Mund ab und hob sein Bierglas.
„Auf das Urteil. Möge es Bestand haben!“
Jonas und Britta taten es ihm gleich.
„Bis wann können die Berufung einlegen?“, hakte Britta nach.
„Bis einen Monat nach Zustellung der schriftlichen Urteilsausfertigung. Das kann – je nachdem, wann das Gericht sie versendet – bis ins neue Jahr dauern“, erwiderte Jonas.
„Nicht gerade glücklich für eine Planungssicherheit …“, brummte Britta. „Aber bevor wir das Geld für die Renovierung einplanen, müssen wir ohnehin erst einmal sehen, was alles gemacht werden muss. Ich rufe morgen gleich mal bei der Verwaltung an.“
Am nächsten Morgen konnte Britta ihrem Sohn mitteilen, dass das Ferienhaus auf Usedom ab dem 1. Dezember frei, aber über die Feiertage wieder belegt sein würde. Jonas erkundigte sich in der Personalabteilung, wie viele Urlaubstage er noch hatte und erfuhr, dass es noch acht Tage waren. Er ging umgehend zu seinem Chef und fragte, ob er seinen eigentlich für Weihnachten und Neujahr geplanten Urlaub auf Anfang Dezember vorziehen könne.
„Ich hab‘ dir schon diverse Extrawürste gebraten, Jonas“, seufzte Gunnar Mahnke. „Bis zum 13. Dezember geht die Reserve. Wir haben dafür Samstagarbeit beantragt, da kann ich dir nicht Urlaub geben. Du kennst die Regularien.“
Die bei Sperling-Assekuranz Reserve genannten Jahresabschlussarbeiten bedeuteten, dass die Sachbearbeiter gesonderte Listen mit zu prüfenden Akten angezeigt bekamen, die sie zwischen Anfang November und Mitte Dezember neben dem normalen Tagesgeschäft vollständig abzuarbeiten hatten. Sie bedeuteten auch erhebliche Mehrarbeit. Dafür wurden dann auch schon mal Überstunden am Samstag gemacht, die entsprechend bezahlt wurden. In der Zeit Urlaub nehmen zu wollen, galt nicht nur bei der Geschäftsleitung als unfreundlicher Akt …
„Nicht mal den halben Freitag?“, bettelte Jonas. „Das ist eine Woche vor Reserveende. Wenn ich entsprechend vorarbeite …“
Mahnke peilte über den Rand der Lesebrille.
„Wie weit bist du jetzt? Da war ja noch der Prozesstermin dazwischen …“
„Ruf‘ dir mal meine Liste auf“, sagte Jonas. Die Sachbearbeiter bekamen im firmeneigenen Intranet eine Liste, die über die Sachbearbeiternummer vom Mitarbeiter selbst und von dessen entsprechend legitimierten Vorgesetzten aufgerufen werden konnte. Trotz des Prozesses hatte Jonas rein zahlenmäßig das abgearbeitet, was er zu diesem Zeitpunkt hätte erledigt haben sollen.
„Sieht ordentlich aus“, räumte sein Chef ein.
„Ich hab‘ sonst nichts weiter vor. Ich kann die sechs Stunden, die für den 7. Dezember vorgesehen sind, davor dranhängen, wenn du mir erlaubst, mich dann aus dem Telefon wegzuschalten. Mit laufendem Telefon krieg‘ ich’s nicht gebacken.“
„Nein, den halben Tag kann ich dir nicht geben. Das wäre unfair gegenüber den anderen Kollegen, die mich auch schon nach Urlaub gefragt haben und denen ich es verweigern musste. Aber Freitag kannst du regulär ab 14.00 Uhr gehen. So weit, wie du mit der Reserve bist, ist das vertretbar.“
Als Jonas nach Hause kam, fand er auf seinem PC eine E-Mail des Felder-Verlags vor:
Hi, Jonas,
danke für das Bild von heute. Wird in der neuen Auflage berücksichtigt.
BTW: Verrätst du mir, weshalb du praktisch dasselbe Bild neu schickst?
LG
Stefan
Jonas sah eine Weile verwirrt auf die Mail, nochmals auf das Datum. Da stand tatsächlich 20. November 2013! Er hatte aber weder an diesem noch an einem der vorangegangenen Tage ein Bild an den Verlag geschickt. Er sah auf die Uhr. Nein, Stefan würde bestimmt nicht mehr im Büro sein. Er schrieb eine Antwort an Stefan:
Finger weg von dem Bild, bevor wir nicht dazu gesprochen haben! Da stimmt was nicht! Ruf mich auf dem Handy an, sofern du kannst.
LG
Jonas
Am folgenden Tag klingelte sein Mobiltelefon schon morgens um halb sieben, als er sich gerade bei Sperling am Kartenterminal einbuchte.
„Moin!“, gähnte er ins Telefon, während er die Tür zur Abteilung öffnete.
„Moin, Stefan hier. Sag mal, was ist das für ein Alarm, den du da machst? Wieso soll ich das Bild nicht verwenden, wenn du es mir gerade erst geschickt hast?“
„Weil ich dir keins geschickt habe, mein Freund. Kannst du mir das auf meine Firmenmail schicken? Ich muss nur noch den Konservenknilch hochfahren, weil ich eben gerade erst in der Tür stehe“, erwiderte Jonas und schaltete das Licht im Raum und den Computer an.
„Ich leg‘ dich mal eben hin“, sagte er, legte das Telefon auf den Schreibtisch und entledigte sich der Winterjacke, bevor er sich an den Schreibtisch setzte. Der Computer lief inzwischen hoch. Jonas gab seine Personalnummer und sein Kennwort ein, das System loggte ihn ein. Das E-Mail-Programm startete er als Erstes. Die Mail von Stefan war bereits da. Jonas klickte darauf.
„Also, das ist das, was ich gestern von dir bekommen habe“, sagte Stefan, als Jonas das Telefon wieder aufnahm und dem Gesprächspartner signalisierte, dass er wieder ganz Ohr war. An der Mail war ein Bildanhang im hochauflösenden .bmp-Format. Jonas klickte sie an und glaubte, seinen Augen nicht zu trauen, als er eine Signatur am unteren rechten Rand erkannte: M.D.B. 2002.
„Bei Davy Jones‘ Tentakelbart!“, entfuhr es Jonas. „Stefan, ich weiß nicht, wer dir diese Mail geschickt hat, aber die ist so wenig von mir wie ich Will Sparks persönlich bin! Da ist ‘ne Signatur drunter, die ich da bestimmt nicht ‘reingesetzt hätte!“
„Wie jetzt? Die Mail ist nicht von dir? Von wem dann?“
„Das wissen die Valar oder die Olympier, aber nicht ich. Die Signatur dürfte Marcus Dwight Brown bedeuten. Und das Jahr weist auf das Datum hin, in dem Brown seinen abgezeichneten Entwurf gefertigt hat, den er für den Film Mykene gemacht hat. Ich habe gerade einen Prozess gegen die Agamemnon-Filmgesellschaft wegen angeblicher Urheberrechtsverletzung an diesem Entwurf in erster Instanz gewonnen. Die Berufungsfrist hat noch nicht mal begonnen, weil das Urteil noch nicht ausgefertigt ist. Die wollen mich ’reinlegen, indem sie dir eine neue Version des Titelbildes unterjubeln! Kannst du das noch stoppen?“
„Ach, du ahnst es nicht!“, platzte Diener heraus „Haben die dein E-Mail-Konto gehackt?“
„Sieht so aus. Verwende bitte das alte Bild. Bitte, achte genau darauf, dass dieses hier auf keinen Fall auf das Buch kommt!“
„Nee, ich lösche das sofort, damit da keiner in Versuchung gerät. Mit dem Druck der dritten Auflage dauert es noch ein paar Tage. Wir haben noch den Bildband zum vierten Teil der Black-Dutchman-Reihe in der Pipeline“, sagte Stefan. „Mitte nächster Woche solltest du das Belegexemplar haben. Ich mache nichts ohne deine Unterschrift. Wenn du das Belegexemplar hast und alles klar ist, schick‘ die Einverständniserklärung per Post, nicht per Mail.“
„Alles klar, machen wir so“, bestätigte Jonas und beendete die Verbindung.
Am 27. November holte er das Belegexemplar für die dritte Auflage nach Dienstschluss von der Post ab, öffnete noch im Auto das Päckchen und sah sich die Zeichnung auf dem Schutzumschlag sehr genau an. Es war tatsächlich seine eigene Zeichnung mit der vollständigen Keilschriftzeile am unteren Rand der Glocke und ohne die verdächtigen Signaturbuchstaben. Aufatmend lehnte er sich in den Fahrersitz zurück.
„Puuhh! Das ist gerade nochmal gutgegangen!“, schnaufte er, warf das Buch auf den Beifahrersitz, startete den Motor und fuhr nach Hause.
Dort angekommen, griff er gleich wieder zum Telefon und rief in der Anwaltskanzlei an. Leon meldete sich, obwohl es bereits deutlich nach fünf Uhr am Abend war.
„Hi, Leon! Jonas hier. Hast du Nachtdienst?“
„So was in der Art. Wenn du den Chef haben willst: Der hat grad‘ ‘ne Beurkundung. Ich kann dich nicht durchstellen. Kann ich dir helfen?“
„Ich will euch bloß was mitteilen. Das kannst du deinem Chef gern weitergeben: Die Schweinebacken von der Agamemnon wollten mich übertölpeln und haben dem Verlag in meinem Namen und mit meiner E-Mail-Adresse den Entwurf von Brown geschickt, damit das als Titelbild auf die dritte Auflage kommt. Irgendwer muss in deren Auftrag mein E-Mail-Konto gehackt haben“, erklärte Jonas.
„Oh, das erklärt, was wir heute vorgefunden haben. Wir haben nämlich eine E-Mail von dir bekommen, mit der du angeblich für den Fall einer Berufung das sofortige Anerkenntnis der Forderung verlangst. Chef hat dich deshalb schon angemorst, weil ihm das mehr als nur seltsam vorkam“, erwiderte Leon.
„Ich bin eben gerade zur Tür rein, weil ich noch bei der Post war, um mir ein Päckchen abzuholen. Ich konnte die Verwendung des Bildes gerade noch verhindern. Da hab‘ ich den PC noch nicht am Laufen“, sagte Jonas und fuhr nebenbei den PC hoch. Als das System bereit war. Öffnete er das Mailprogramm und fand die E-Mail vom Anwaltsbüro vor.
„Teufel noch eins, was ist das denn?“, hörte er Leons erschrocken klingende Stimme aus dem Telefon. „Jonas, hier ist eben eine E-Mail von dir gelandet, mit der du ausdrücklich bestätigst, dass die Berufung nicht durchgeführt werden soll.“
„Klare Sache, das hat einer gehackt. Bloß gut, dass meine Telefonnummer nirgends eingetragen ist. Das mit dem Buch konnte ich auch gerade noch stoppen, weil die zum Glück noch ein anderes Projekt hatten und mit dem Druck noch nicht beginnen konnten. Bis mein E-Mail-Konto wieder sauber ist, werde ich erst mal das von Opa verwenden.“
„Dein Opa hatte ein E-Mail-Konto?“, wunderte sich Leon. „Der war doch blind!“
„Nee, das hat mein Dad ihm noch eingerichtet, als er noch sehen konnte“, erwiderte Jonas. „Natürlich liegt das seit ewigen Zeiten brach, hat aber den Charme, dass das keine Sau kennt. Bis dahin machen wir alles handschriftlich.“
„Alles klar, machen wir so!“, bestätigte Leon.
„Bis dann!“, verabschiedete sich Jonas und beendete die Verbindung.
Als nächstes aktivierte er einen gründlichen Virenscan und änderte seine Passwörter. Um zu verhindern, dass sie gleich aus seiner Spezialdatei wieder vom PC abgegriffen wurden, schrieb er sie auf einen Zettel, den er in die Lücke zwischen Rücken und Buchblock seines gerade erhaltenen Belegexemplars schob, nachdem alles erledigt war. Ebenso handschriftlich sandte er die Einverständniserklärung an den Verlag. Zwar würde das Buch zum eigentlichen Weihnachtsgeschäft vielleicht nicht mehr rechtzeitig kommen, aber es gab ja immer die Spätentschlossenen, die erst am Heiligen Abend die Geschenke kauften …
Kapitel 13
Der Kreis schließt sich
Jonas‘ Eltern fuhren wie geplant am 2. Dezember nach Koserow, wenn auch ohne ihren Sohn, der arbeiten musste. Das Ferienhaus, das die Familie Mönke dort besaß, war das Haus, in dem die Familie Trojan Generationen lang ansässig gewesen war, bis Hinnerk Trojan verhaftet und die Familie nach Magdeburg zwangsumgesiedelt worden war. Haus, Grundstück und das Bootshaus am Strand waren als Teil des Strafurteils gegen Hinnerk Trojan enteignet worden. Danach hatte das Haus als Ferienunterkunft für die staatliche Jugendorganisation der DDR gedient und war zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung völlig verfallen gewesen. Hinnerk Trojan hatte es sich mit seiner Tochter und seinem Schwiegersohn angesehen und beschlossen, dass er nicht aufräumen wollte, was die DDR an Schaden hinterlassen hatte. Er hatte sich nicht einmal bei der zuständigen Behörde gemeldet, die deshalb keine Ahnung hatte, wo der Alteigentümer war und das Grundstück deshalb auch nicht verkaufen konnte.
Als Jonas im Jahr 2000 auf Klassenfahrt auf Usedom gewesen war, war er erstmals in Koserow gewesen. Weil er von seinem Großvater die Adresse gehabt hatte, hatte er sich das Haus – besser dessen Ruine – ansehen können. Es hatte noch einige Jahre gedauert, bis er seine Mutter davon überzeugt hatte, das Haus wieder zu übernehmen, instandsetzen zu lassen und es als Ferienhaus zu vermieten. Erst 2005 hatte er auch seinen Großvater so weit gehabt, dass er seine Besitzansprüche geltend machen wollte. Da dies nach der Suchaktion der Auricher Stadtbibliothek geschehen war, hatte das Amt Usedom-Süd 2004 deshalb nur die Auskunft geben können, die die Bibliothek erreicht hatte. Zwei Jahre lang hatten örtliche Handwerker das Haus gegen ordentliche Rechnungen saniert – ordentlich sowohl im Sinne dessen, dass ein Stundenlohn vereinbart gewesen war, der das örtliche Niveau überstieg, als auch dass die Umsatzsteuer ordnungsgemäß ausgewiesen war.
Anders als die Ferienwohnung in Niendorf/Ostsee, die nur eine knappe Stunde Autofahrt von Hamburg entfernt war und nach wie vor von Britta Mönke selbst betreut wurde, hatte sie für das Ferienhaus in Koserow einen ortsansässigen Verwalter. Falko Graumann hatte eine kleine Immobilienverwaltung, die außer dem Trojan’schen Haus noch etwa ein Dutzend weiterer Ferienobjekte betreute, die in Privatbesitz waren. Alle Eigentümer hatten eigene Schlüssel, so dass sie diese nicht von der Verwaltung holen mussten. Britta fand es aber angebracht, ihrem Vertragspartner Nikolausgeschenke vorbeizubringen, wenn sie schon im Advent auf Usedom war.
Am Morgen nach ihrer Ankunft verließ sie schon morgens um halb acht das Haus, um Brötchen zu holen und auf dem Weg auch bei Graumann-Immobilien vorbeizuschauen. Verstört schüttelte sie den Kopf, als sie Glockenklang vernahm. Sie setzte sich ins Auto, doch sie öffnete die Tür nochmals, stieg aus und hörte genau hin.
‚Nein, ich spinne nicht. Das kommt wirklich von See … Nee, Britta, komm auf den Boden zurück!‘
Ihr rann ein eisiger Schauer den Rücken hinunter als, sie sich wieder ins Auto setzte und zum Bäcker fuhr. So früh und noch bei Dämmerung war sie die einzige Kundin in der Bäckerei.
„Moin!“, sagte sie und unterdrückte ein Gähnen. „Vier Schrippen, bitte. Schön dunkel.“
Die Verkäuferin suchte die entsprechenden Brötchen aus dem Korb, verpackte sie in eine Tüte und reichte sie Britta über den Tresen.
„Biddeschön. Einsfuffzich!“
Britta bezahlte.
„Sagen Sie … von welcher Kirche läutet denn hier um halb acht eine Glocke?“, fragte sie.
„Kirche? Nee, die läutet um sechse“, entgegnete die Verkäuferin. „Ha’m S’e das eben gehört?“
„Ja, eben als ich ins Auto stieg. Aber das kam nicht von da hinten“, erwiderte Britta und wies ans östliche Ende von Koserow, wo eine uralte Kirche am Ortsrand des Dorfes stand.
„Klang eher wie von da“, ergänzte sie und wies in Richtung Greifswalder Oie auf die See. Die Verkäuferin wurde blass.
„Steh‘ uns bei! Echt?“, entfuhr es der Verkäuferin.
„Ja“
„S’e sind nich‘ von hier, wa?“
„Ich bin hier geboren, in Zinnowitz, aber schon mit sechs Monaten von hier nach Magdeburg gekommen. Jetzt lebe ich in Hamburg“
„Und Ihre Eltern ha’m Ihnen nie von der Glocke von Vineta erzählt?“
„Doch, aber das ist doch ein Kindermärchen.“
„Warten S’e ma‘ ab. Nee, besser, S’e packen Ihr’n Kram und verschwinden! Det is‘ keen Kinnermärchen, Madam! Det is‘ ernste. Hier gibt et bald ‘ne Katastrophe. Hau’n S’e lieber ab!“, warnte die Verkäuferin.
Britta stutzte. Sollte etwa doch etwas an den alten Geschichten sein?
„Danke. Einen schönen Tag noch“, sagte sie und verließ mit rasendem Herzen die Bäckerei. Im Auto überlegte sie kurz, ob sie gleich ins Ferienhaus zurückfahren sollte, entschied sich dann aber doch, zunächst zur Verwaltung zu fahren, die ihr Büro in der Nähe der alten Kirche hatte.
Als sie dort parkte, stand Falko Graumann vor der Tür und sah mit nachdenklicher Miene in Richtung See.
„Guten Morgen, Herr Graumann“, begrüßte sie den noch jungen Verwalter, der allenfalls dreißig Jahre alt sein mochte.
„Oh, Verzeihung“, bat er um Entschuldigung; er schien wie aus weiter Ferne zurückzukommen. „Ich war etwas abgelenkt und habe Sie gar nicht kommen hören. Willkommen auf Usedom, Frau Mönke“, erwiderte er den Gruß.
„Und … was … hat Sie abgelenkt, Herr Graumann?“
„Haben Sie die Glocke nicht läuten hören?“, fragte Graumann verblüfft.
„Doch. Ich hab‘ mich nur gefragt, woher das eigentlich kam.“
„Von Vineta – wie immer, wenn ein Unglück im Anzug ist“, erklärte der Verwalter. Britta schmunzelte.
„Was? Sie junger Kerl glauben an diesen Quatsch?“, amüsierte sie sich. Er sah sie einen Moment an und öffnete die Bürotür.
„Kommen Sie ‘rein, Frau Mönke“, bot er an und ließ sie vorgehen. Er schloss die Tür und wies ihr mit einer Hand den Weg zu seinem eigenen Büro, wo er ihr Platz anbot.
„Danke. Bevor ich das bei dieser Glockengeschichte vergesse: Bitte sehr. Eine kleine Aufmerksamkeit für Sie und Ihre Mitarbeiter“, sagte sie und holte aus dem Einkaufskorb fünf Weihnachtstüten aus durchsichtiger Folie, die mit Weihnachtskugeln und Nikolausfiguren aus Schokolade gefüllt waren.
„Oh, vielen Dank, Frau Mönke, Das ist sehr aufmerksam von Ihnen“, erwiderte er und nahm ihr die Tüten ab. „Ich verteile sie nachher gleich an meine Mitarbeiter“, versprach er. „Was die Glocke betrifft: Nein, das ist kein Quatsch. Was wissen Sie von Vineta?“
„Mein Vater erzählte mir, dass es eine versunkene Stadt sein soll, die man bei der Greifswalder Oie vermutet. Es soll eine reiche Kaufmannsstadt gewesen sein, in der sich die Kaufleute ähnlich benahmen wie aktuelle Heuschrecken; die ihre Leute ausbeuteten, geizig waren wie Disneys Onkel Dagobert, die von der Kirche nichts wissen wollten und die so arrogant waren, dass sie Brotlaibe aushöhlten und sie als Pantoffeln missbrauchten. Bei Letzterem muss man ja nicht weit gucken. In der DDR war Brot so billig, dass es als Viehfutter herhalten musste“, gab Britta ihr Wissen wieder.
„Ja, genau“, bestätigte Falko Graumann. „Und in Vineta gab es eine mannsgroße Glocke, ein Teil, das man eigentlich erst hunderte von Jahren später am anderen Ende der Welt gegossen hat – in China. Nur war Vinetas Glocke erheblich älter. Man hat herausgefunden, dass sie schon in Troja geläutet wurde, wenn Gefahr drohte. Trojaner nahmen sie mit auf der Flucht vor den Griechen. Auf weiten Umwegen und nach sehr, sehr langer Zeit kamen deren Nachfahren hier an die Ostsee. Hier gab es mal eine Familie Trojan. Leute, die diesen Namen tragen, gelten als direkte Nachfahren der überlebenden Trojaner.
Diese Glocke jedenfalls läutete in Vineta erstmals drei Monate vor Allerheiligen 1304, dann drei Wochen vor Allerheiligen und nochmals drei Tage vor Allerheiligen, ohne dass sie jemand angeschlagen hatte. Dann gab es einen entsetzlichen Sturm, der die Ostsee richtig wegpustete. Und während die Kaufleute von Vineta darüber grübelten, wie sie den neuen Boden vermarkten konnten, tauchte aus dem letzten Priel eine Nixe auf, die den Untergang der Stadt prophezeite. Am Himmel erschien die ganze Stadt als Luftspiegelung. Und drei Tage später schwappte die Ostsee zurück, versank Vineta. Einem einzigen Schiff gelang es, zu entkommen. Es gehörte Harm Reimers und hatte die Glocke an Bord. Reimers verließ die Ostsee und ließ sich in Rungholt nieder.
Knapp sechzig Jahre später läutete sie dort in ebensolchen Abständen. Martin Reimers, der Enkel von Harm, erkannte die Gefahr und warnte die Stadtoberen, aber niemand glaubte ihm. Am 13. Januar 1362 läutete sie zum dritten Mal in Rungholt, ohne dass sie jemand angeschlagen hatte. Wieder brach ein schrecklicher Sturm los. Martin Reimers und seine Seeleute holten die Glocke aus dem Turm, brachten sie auf das Schiff Vineta, das Rungholt mit seinem Schwesterschiff Rungholt noch am selben Tag verließ, um nach Hamburg zu segeln. Reimers wollte die Glocke der Kirche Sankt Nikolai stiften, die gerade einen neuen Turm bekommen hatte, um sich mit diesem Geschenk in das Kirchspiel einzukaufen, was ihm möglicherweise das hamburgische Bürgerrecht eingebracht hätte. Aber der schreckliche Sturm, der der Nordseeküste mit der Groten Mandränke an jenem 16. Januar 1362 ein neues Gesicht verpasste, erwischte auch die Schiffe von Reimers. Die Vineta sank mit Mann und Maus und Glocke im Sturm vor Neuwerk, die Rungholt gelangte mit der Flutwelle die Elbe aufwärts bis in den Hamburger Hafen. Martin Reimers konnte in Hamburg bleiben, erlangte das Bürgerrecht aber erst postum und für seine Familie, als er im Kampf gegen Störtebekers Piraten fiel.
1928 wurde die Glocke bei Baggerarbeiten zur Erweiterung der Fahrrinne der Elbe gefunden und nach Hamburg gebracht, weil Neuwerk zu Hamburg gehört. Da stand sie im Museum und wurde in den Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts von Professor Boris Trojan untersucht, der ihre trojanische Provenienz erkannte und auch belegen konnte. Das missfiel den Nazis, die ihn verhafteten und ins KZ brachten. Ende März 1943 läutete sie dort, ohne dass sie angeschlagen worden war. Dann wieder Anfang Juli 1943 und am 21. Juli 1943. Sie wissen, was ab dem 24. Juli 1943 mit Hamburg passierte. Die Nikolaikirche, die nach Reimers‘ Willen die neue Heimat der Glocke hätte werden sollen, war interessanterweise der Zielpunkt der Bomberpiloten. Ein Nazi-Bonze namens Wilhelm Graumann, der selbst von Usedom stammte und die Geschichte so kannte, wie man sie sich hier erzählte, hatte sie selbst läuten hören und warnte den Gauleiter Karl Kaufmann, der ihn aber auslachte. Das Museum für Hamburgische Geschichte gehört zu den wenigen Gebäuden in Hamburg, die nahezu unbeschädigt geblieben sind. Nach der Zerstörung Hamburgs wollte Wilhelm Graumann die Glocke für immer zum Schweigen bringen und ließ sie zerstören. Seither ist sie verschollen.
Aber wenn Gefahr im Verzug ist, dann läutet sie noch heute von der Greifswalder Oie her. Sie hat Mitte September geläutet, sie hat Mitte November geläutet und heute Morgen wieder. Es ist Sturm angesagt und zwar ein richtiger; einer der die Ostsee wieder wegdrücken wird. Es wird in drei Tagen passieren. Das ist kein Ammenmärchen, Frau Mönke“, erklärte Graumann mit ebenso ruhiger wie unheilsschwangerer Stimme.
Britta Mönke hatte mit offenem Mund zugehört. Sie griff in ihre Handtasche und zog Jonas‘ Buch heraus
„Kennen Sie das?“, fragte sie. Graumann nickte.
„Ja. Und Sie denken, dass ich das, was ich Ihnen gerade erzählt habe, aus diesem Buch habe. Dem ist nur nicht so. Diese Geschichte ist in meiner Familie äußerst präsent. Ich weiß, dass die Geschichte, so, wie sie da drin steht, Boris Trojan von meinem Urgroßvater Friedrich Graumann erzählt worden ist – abgesehen von den Ereignissen im 20. Jahrhundert. Denn die hat mein Urgroßonkel Wilhelm Graumann hier erst erzählt, als er nach der Zerstörung Hamburgs auf Urlaub nach Koserow kam. Aber da lebte Boris Trojan schon nicht mehr, weil er am 17. August 1943 beim Angriff auf Peenemünde im KZ Trassenheide ums Leben gekommen war.
Trojan konnte mit seinem Hintergrund als Archäologe belegen, dass die Geschichte, die hier auf Usedom kursierte, nichts als die Wahrheit war. Doch wie allen, die sich mit der Glocke befassen, ist es ihm und seiner Familie nicht gut bekommen. Sein älterer Sohn Johannes, genannt Hannes, ist in Russland gefallen, der jüngere Heinrich oder Hinnerk übernahm die Fischerei von Boris‘ Bruder Alexander und half nach dem Krieg Leuten, aus der DDR zu fliehen, wurde erwischt und landete in Bautzen, während seine Familie nach Magdeburg verbannt wurde. Seither wusste man hier nichts mehr von den Trojans. Aber das wissen Sie, Frau Mönke. Sie und Ihr Vater Hinnerk Trojan haben 2005 Rückübertragungsansprüche gestellt. Da wussten wir hier, es geht weiter, es gibt noch Trojans. Jonas hat das, was hier bekannt war, bevor sein Urgroßvater starb, erstklassig umgesetzt. Aber es würde mich wundern, wenn das glatt gegangen wäre“, sagte er.
„Ist es auch nicht, Sie haben Recht“, erwiderte Britta. „Mein Sohn ist mit einem Urheberrechtsstreit überzogen worden. Nicht wegen des Inhalts, wegen des Titelbildes, das von meinem Vater stammte. Er hat in erster Instanz gewonnen, aber dagegen ist noch Berufung möglich. Der Designer, der sich auf das Urheberrecht berief, hat aus den Aufzeichnungen meines Großvaters praktisch das identische Bild gezeichnet, das mein Vater gezeichnet hat. Der Mann kann dieses Bild nie gesehen haben, aber er hatte sogar eine unvollständige Keilschriftzeile drauf, die im Text nicht beschrieben ist. Er muss noch mehr gehabt haben, als diese Beschreibung. Ist Ihnen zufällig bekannt, ob sich hier auf der Insel mal jemand Fremdes nach der Sage erkundigt hat?“
„Sie kennen doch Peenemünde, oder?“, fragte er, scheinbar zusammenhanglos.
„Klar, wer kennt das nicht? Wieso?“
„Von den Raketenwissenschaftlern ist die eine Hälfte in die USA gegangen, die andere haben die Russen übernommen. Weil die ihre Raketen gerne Richtung Greifswalder Oie geschossen haben, haben die Fischer hier ihnen diese Geschichte erzählt. Die ließen sich aber nicht beirren. Als die Alliierten im August 1943 Peenemünde bombardieren wollten, aber Trassenheide trafen, hatte die Glocke in entsprechenden Abständen geläutet. Das hatte doch eine gewisse Wirkung auf die Wissenschaftler, wie Sie sich vielleicht denken können. Die Leute haben die Geschichte quasi exportiert und in ihre neue Heimat mitgenommen.
Ende 2002 tauchte hier ein Marcus Brown auf, der für eine Filmfirma arbeitete. Sein Chef hatte ihm einen Hinweis auf ein Manuskript von Boris Trojan gegeben. Das hatte er auch gefunden, aber es waren keine Bilder dabei, die es aber geben musste. Das bekam Niko Evers mit. Sein Großvater hatte zu denen gehört, die Ihr Elternhaus und die Strandhütte unten geräumt haben, als Sie hier wegmussten. Als das Haus leer war, hat der alte Gustav Evers ein paar Fotos gefunden, die möglicherweise zu dem Manuskript gehörten. Er hat sie aufbewahrt, und Niko hat sie später gefunden. Brown hat in der Pension der Evers gewohnt und davon erzählt. Niko hat ihm die Bilder gezeigt und Abzüge davon machen lassen, die er Brown gegeben hat“, erklärte Graumann.
„Äh, und wieso erfahre ich das erst jetzt?“, fragte Britta verblüfft. Da hatte der Nachbar Fotos von der Glocke, erzählte ihr nichts, aber einem wildfremden Amerikaner gab er Abzüge davon …
„Weil ich es erst seit ein paar Tagen weiß“, erwiderte Graumann. „Da hat Niko mir die Fotos gezeigt, nachdem er das Buch hier bei mir im Büro gesehen hat.“
Er griff in das Regal hinter sich und zog Jonas‘ Buch heraus.
„Hier in Koserow geht das weg wie warme Semmeln, seit klar ist, dass es die Sage dieser Insel ist und Trojans Forschungen dazu widerspiegelt. Niko ist über die Titelzeichnung gestolpert und meinte, das habe er doch schon mal gesehen. Da war dann auch klar, wo die Fotos hingehören. Ich habe sie vor zwei Tagen an Ihre Hamburger Adresse geschickt. Dass Sie jetzt herkommen, war mir nicht persönlich bekannt, sonst hätte ich Sie Ihnen jetzt gegeben. Ich hatte zwar gestern gesehen, dass Ihr Haus bis zum Jahresende belegt ist, aber den Eintrag in die Liste hat Frau Fischer veranlasst. Ich nehme an, Sie haben sich bei ihr angemeldet“, sagte er. Sie nickte.
„Kommt Jonas auch?“, fragte er.
„Er kommt über das nächste Wochenende.“
„Der Buchhändler hier hat ’ne halbe Palette von seinem Buch bestellt. Es wäre genial, wenn Jonas da Signierstunde machen könnte“, lächelte er.
„Dann hoffe ich mal dass der Fluch der Glocke nicht erneut zuschlägt und Jonas heil hier ankommt“, seufzte sie. „Danke, Herr Graumann. Ich muss jetzt dringend nach Hause. Mein Mann wird sich schon wundern, wo die Brötchen bleiben.“
Um halb zehn klingelte bei Jonas das Telefon – zum x-ten Mal an diesem Tag, wie üblich um diese Jahreszeit.
„Sperling-Assekuranz, Kraftfahrt-Schaden, Mönke, guten Tag“, meldete er sich.
„Hallo, Jonas, mein Schatz“, hörte er die Stimme seiner Mutter. „Geht’s dir gut?“
„Ja, ist nur scheußlich viel zu tun im Moment. Das ist der erste vernünftige Anruf heute, Mutz“, erwiderte er. „Danke.“
„Glaub‘ ich gern. Siehst du heute mal in den Briefkasten, Schatz?“
„Klar, mach‘ ich. Soll ich die Post am Freitag mitbringen?“
„Das wäre lieb, mein Schatz. Da ist ein Brief von der Verwaltung Graumann-Immobilien an mich. Den kannst du aufmachen.“
„Den Teufel werd‘ ich tun!“, protestierte er. „Dann scheißt Dad mich wieder zusammen. Nee, nee, ich bring‘ die Post so mit, wie ich sie vorfinde. Da mach‘ ich keine Experimente!“
„Tu es in diesem Fall. Der Inhalt wird dir helfen, falls es zur Berufung kommt. Glaub‘ mir.“
„Na schön, aber wenn ich doch angeraunzt werde, drehe ich auf der Stelle um und fahre wieder nach Hause“, warnte er.
„Das wird nicht passieren, das verspreche ich dir“, beruhigte ihn seine Mutter.
„Okay. Wie ist das Wetter?“
„Windig. Für Freitag ist richtiger Sturm angesagt. Fahr‘ bitte vorsichtig, ja?“
„Mach‘ ich, Mutz. Hab‘ dich lieb. Tschüß.“
Am Abend fuhr er von der Arbeit zur Wohnung seiner Eltern, nahm die Post aus dem Briefkasten, legte sie zur übrigen Post auf dem Wohnzimmertisch und goss zunächst die Blumen. Dann sah er die Post durch, sortierte sie in einen Stapel für seine Mutter und einen für seinen Vater, sortierte die Werbepost gleich auf einen Extrahaufen, wohl wissend, dass seine Eltern über die Angebote der Woche informiert sein wollten. Unter den Briefen für seine Mutter fand er auch den von Falko Graumann. Zögernd schlitzte er ihn auf und musste sich setzen, als alte Schwarz-Weiß Fotos mit gewelltem Rand herausfielen.
„Fotos von der Glocke?!“, entfuhr es ihm. Eines davon war offensichtlich das, was Marcus Brown als Vorlage für seinen „Entwurf“ verwendet hatte. Er fand auch ein erklärendes Schreiben von Falko Graumann, in dem er mitteilte, was er auch Britta gesagt hatte. Jonas griff zu seinem Mobiltelefon und rief bei Rechtsanwalt Schmidt an.
„Guten Abend Herr Schmidt, Mönke hier. Sorry, wenn ich so spät noch störe“, meldete er sich.
„Keineswegs. Ist doch noch nicht mal acht. Als selbstständiger Rechtsanwalt hab‘ ich zwar auch gleitende Arbeitszeit wie Sie – aber von morgens vor sieben bis abends nach neun. Was kann ich für Sie tun, Herr Mönke?“, erwiderte der Anwalt mit einem Ton, der sein Grinsen geradezu hörbar machte.
„Ich hab‘ den Beweis, dass Brown uns verarscht hat!“, erwiderte Jonas.
„Wow, was haben Sie da?“
„Drei wunderschöne alte Fotos von der Glocke von Troja, Vineta, wie auch immer. Gemacht im Museum für Hamburgische Geschichte im Jahre des Herrn 1935. Gestochen scharf. Uropa muss ’ne professionelle Leica oder so was gehabt haben!“, erklärte Jonas. „Eins davon exakt das, was der so genannte Entwurf zeigt. Und es ist das, was er gegenüber Weta als old pic from German professor B. Trojan bezeichnet. Und ich habe einen Zeugen, der ihm diese Fotos gegeben hat. Ich fahre am Wochenende nach Koserow. Dann will ich auch mit dem Zeugen reden. Kann eine Zeugenadresse dem Kläger eigentlich vorenthalten werden?“
„Im Zivilprozess nicht. Zeugenschutzprogramme mit falschem Namen, Perücke und Bart gibt’s nur in speziellen Strafprozessen. Meinen Sie, Agamemnon Pictures würde ihm Schwierigkeiten machen?“, fragte Schmidt.
„Ich weiß es nicht. Aber wenn man es schon so hindreht, dass der eigentliche Urheber – der angebliche Urheber – als Zeuge im Prozess auftreten kann, wäre ich mir da nicht so sicher.“
„Sie haben ja noch den Brief von Blanchard. Sie erwähnten doch, dass er von Weta die Information zu einem solchen Foto hatte“, gab der Rechtsanwalt zu bedenken.
„Ja, aber den wollten wir aus dem Spiel lassen, um ihn nicht auf irgendeine Schwarze Liste aufmüpfiger Schauspieler geraten zu lassen. Von wegen Aufträge, Angebote und so weiter …“
„Ja, aber da hatten wir nur das. Jetzt haben wir einen völlig neutralen Zeugen. Der Brief von Blanchard mit dem Hinweis von Taylor kann dessen Aussage untermauern.“
„Mir kommt da noch was in den Sinn. Brown hat doch offensichtlich das Foto meines Urgroßvaters als Vorlage für seinen Entwurf genutzt – und zwar früher als siebzig Jahre nach dessen Tod, weshalb das Urheberrecht an diesem Foto bei meinem Urgroßvater liegt beziehungsweise meiner Mutter als dessen Erbin. Mir ist eine Urheberrechtsverletzung vorgeworfen worden, weil ich angeblich ein Bild abgezeichnet habe. Das Urteil enthält nichts dazu, dass eine Urheberrechtsverletzung gemäß § 24 UrhG wegen freier Nutzung eines bestehenden Werkes gar nicht erfolgen konnte. Jetzt würde doch eher umgekehrt ein Schuh daraus werden. Daraus müsste sich doch eine Widerklage ergeben können oder sehe ich das falsch?“
„Ja, das wäre im Prinzip möglich. Es gäbe da nur die Schwierigkeit, wen Sie genau verklagen müssten. Agamemnon macht Ansprüche aus übergegangenem Recht geltend und kann die Klage deshalb über ihre deutsche Vertretung führen. Dafür, dass deren Mitarbeiter sich direkt eines Bildes Ihres Urgroßvaters bedient hat und nicht nur nach der Beschreibung Ihres Urgroßvaters die Glocke gezeichnet hat, wäre Agamemnon nicht unmittelbar verantwortlich. Sie wissen letztlich nicht, was Wolfson Brown genau gesagt hat, als er ihm den Tipp mit Aurich gab. Unmittelbar verantwortlich ist Brown als Privatperson, der dieses Bild genutzt hat. Gegen den als Privatperson müssten Sie in den USA klagen, so wie gegen Sie als Privatperson in Deutschland geklagt werden musste. Das war kein Entgegenkommen von Agamemnon, das ging gar nicht anders. Dazu kommt, dass nicht Sie Inhaber des Urheberrechtes am Foto sind, sondern Ihre Mutter als Erbin des Anspruchs. Sie ist nicht beklagt, und kann deshalb keine Widerklage erheben, sondern nur selbst gegen Brown klagen“, erklärte Schmidt.
„Womit wir wieder bei dem Spruch wären: Leg‘ dich nicht mit Hollywood an! Glauben Sie mir, dass mir gerade die Galle hochkommt?“
„Kann ich verstehen, Herr Mönke, absolut“, erwiderte Ralf Schmidt. „Sie sind ja nicht unerfahren, was Recht betrifft. Sie wissen: Recht haben und Recht kriegen ist leider immer noch zweierlei, selbst wenn man handfeste Beweise dafür hat, dass jemand einem Unrecht zugefügt hat. Ich habe heute gerade die schriftliche Urteilsausfertigung bekommen. Lupus müsste sie ebenfalls heute bekommen haben, womit die Uhr in Sachen Berufung ab heute tickt. Ich kann natürlich einen Versuchsballon starten und dem Lupus mitteilen, dass wir einen Zeugen gefunden haben, mit dessen Aussage wir beweisen können, dass Brown von einem urheberrechtlich geschützten Foto Ihres Urgroßvaters abgezeichnet hat und dass es deshalb Überlegungen gibt, eine entsprechende Forderung an Brown zu richten, der damit in einer Berufung als Zeuge ausfiele. Das könnte dazu führen, dass die Gegenseite auf eine Berufung verzichtet. Garantieren kann ich das aber nicht.“
„Nee, is‘ schon klar. Ich fahre am Wochenende ja nach Usedom. Dann kann ich auch mit meiner Mutter reden, ob sie Ansprüche erheben will. Danke für die Auskunft. Einen schönen Abend noch“, verabschiedete sich Jonas.
Kapitel 14
Fundsachen
Als Jonas sich am 6. Dezember Schlag 14.00 Uhr am Terminal der Sperling-Assekuranz ausbuchte und zum Auto ging, machte er innerlich drei Kreuze, dass er früh genug im Büro gewesen war, um nicht in der Nähe eines Baumes parken zu müssen. Ein Orkan, wie Jonas ihn noch nicht erlebt hatte, zerrte an den Flaggen vor dem Haus, ließ sie laut knallen, rüttelte die Platanen auf der anderen Straßenseite, dass die Äste im Dutzend durch die Luft flogen. Der junge Mann war auch mehr als nur froh, dass die Autobahn A 20 nur an wenigen Stellen durch Wald führte.
Eigentlich schätzte er es, auf der immer noch relativ leeren A 20 ordentlich Gas geben zu können, aber bei diesem Orkan zog er es doch vor, keinesfalls schneller als achtzig Stundenkilometer zu fahren und schön auf der rechten Fahrspur zu bleiben. Die Fahrt nach Usedom dauerte dadurch zwar deutlich länger, als wenn er alle Möglichkeiten seines Autos genutzt hätte, aber besser, man kam spät an als nie. Sein Beruf führte ihm die Gefahren allzu sorglosen Autofahrens täglich vor Augen. Ein VW Polo ist nun mal kein Panzer …
Erst zehn Minuten vor neun Uhr am Abend war er vor der Peenebrücke in Wolgast, die zu bestimmten Zeiten über Tag für maximal eine halbe Stunde geöffnet wurde. Zwar wurde sie zwischen Oktober und März abends um viertel vor neun nur noch für die Berufsschifffahrt geöffnet, aber der Orkan trieb offensichtlich jetzt noch Berufsschiffer in die relative Sicherheit des Peenestroms. Jonas nutzte die Pause, um seine Mutter anzurufen und ihr mitzuteilen, dass er vor der Brücke in Wolgast war. Erst kurz vor halb zehn war er dann in Koserow.
„Gott sei Dank! Du bist endlich da!“, seufzte sein Vater. „Wir haben uns bei dem Orkan richtig Sorgen um dich gemacht.“
„War auch ’ne wackelige Angelegenheit, Paps. Ich bin froh, es unfallfrei geschafft zu haben. Im Radio hab‘ ich gehört, dass es bei Plau am See einen Rettungswagen von der Straße geschmissen hat.“
In der Nacht nahm der Sturm nochmals zu. An den Fenstern rüttelte es, als wollte der Klabautermann sie eindrücken. Am folgenden Morgen traten die Mönkes aus dem Haus, sahen, dass der Küstenwald einiges abbekommen hatte. Aber es fehlte etwas: das vertraute Rauschen der Ostsee. Jonas kehrte kurz ins Haus zurück, zog sich wetterfest an, lief die Straße hinunter und durch den Wald bis an die Dünen.
„Wow! Die See ist weg!“, keuchte er.
„Ja, und das bedeutet nichts Gutes“, vernahm er eine Stimme neben sich. Erst dann bemerkte er Falko Graumann neben sich. Er hatte ihn nicht kommen hören.
„Oh, moin, Herr Graumann!“, grüßte er.
„Bleiben Sie besser nicht hier. Wenn das zurückschwappt, kriegen wir hier nasse Füße“, warnte der Verwalter.
„Was? Hier oben auf dem Dünenkamm?“
„Ja, könnte passieren. Denken Sie an Vineta. Sie kennen die Geschichte“, erwiderte Graumann. Jonas nickte und wollte wieder zurückgehen, als ein Grollen von See kam. Er drehte sich wieder um und sah hinaus auf die weggefegte Ostsee. Weit im Norden erkannte er schäumendes Wasser.
„Weg hier!“, befahl Graumann. Beide rannten eilig durch den Küstenwald zurück nach Koserow.
Es dauerte keine halbe Stunde, bis am Strand richtig krachte. Es klang, als ob ein Schiff auf Grund lief und explodierte. Der Aufprall auf die Dünen war heftig genug, dass das Wasser höher als die Bäume im Küstenwald spritzte. Hölzernes Krachen verriet, dass dort Bäume oder Holzhütten der Urgewalt des Wassers zum Opfer fielen.
„Scheiße! Die Salzhütten!“, entfuhr es Bernd Mönke.
Koserow hatte eine Besonderheit: die Salzhütten, die an der Dünengrenze am Strand waren. Der ursprüngliche Zweck dieser Hütten war, den Fischern als Salzlager zu dienen, damit der angelandete Fisch zu einer Zeit, in der Kühlschränke noch unbekannt gewesen waren, hatte konserviert werden können. Jetzt wurden sie teilweise als Restaurants genutzt, teilweise als Bootshäuser. Eine der Hütten gehörte auch den Mönkes und war mindestens seit Beginn des 20. Jahrhunderts als Bootshaus genutzt worden. Es war von der Landseite her die letzte und von See die erste Hütte am Strand. Vom Ende der Woenigstraße, in der das Haus der Mönkes lag, führte ein Weg schräg durch den Küstenwald zu den Salzhütten.
Vater und Sohn schlüpften eilig in die Winterjacken und rannten durch den Wald zur Steilküste, obwohl es nach wie vor heftig stürmte, nur kam der Wind jetzt von Nordwesten und drückte das Wasser gegen die Küste. Von dort konnten sie sehen, dass die beiden Hütten, die außerhalb der Dünen am Strand waren – ihre eigene und die des Nachbarn Evers – nur noch aus Kleinholz bestanden. Genaugenommen waren diese beiden Hütten keine der aus lehmgefüllten Fachwerk gebauten, denkmalgeschützten Salzhütten, sondern reine Holzbauten, wenngleich sie mit Reet gedeckt waren und deshalb wie zum Salzhüttenensemble gehörig gewirkt hatten. An die Treppe, die vom Weg zum Strand hinuntergeführt hatte, erinnerten nur noch deren Betonfundamente, die aus dem Sand ragten.
„Bei Davy Jones‘ Tentakelbart!“, entfuhr es Jonas. „So stelle ich mir Calypsos Zorn vor!“
„Fehlt nur noch die Black Dutchman samt Captain Sparks, hm?“, grinste sein Vater. Jonas nickte.
„Der wird bei so einem Orkan gut zu tun haben“, erwiderte Jonas.
„Komm, im Moment können wir nichts tun“, sagte Bernd. „Das Wasser steht zu hoch. An das, was mal unsere Hütte war, kommen wir jetzt nicht heran.“
Vater und Sohn gingen den äußeren Weg durch die Salzhütten nach Hause.
Nach dem Mittagessen kehrten beide an den Strand zurück. Das Hochwasser war bereits so weit zurückgegangen, dass die Hütten – oder was davon übrig war – wieder auf trockenem Strand waren. Jonas und Bernd gingen durch die Salzhütten, wo sie nicht erst die empfindliche Düne hinuntersteigen mussten, sondern einen offenen Weg zum Strand hatten. Sie hatten sich außer mit Winterkleidung mit dicken Arbeitshandschuhen, einem Werkzeugkasten und einem Kuhfuß bewaffnet, um die geborstenen Bretter und Balken vom Fundament räumen zu können. Jonas ging einmal um die Hütte herum und bemerkte, dass die zum Wasser zeigende Seite des Fundamentes unterspült war. Er warf sich in den Sand, um festzustellen, ob das Fundament erst abgestützt werden musste, bevor sie es betreten konnten oder ob es sicher war. Er leuchtete mit einer Taschenlampe in den dunklen Spalt zwischen Strand und Hüttenboden und glaubte, seinen Augen nicht zu trauen, als er nicht nur bemerkte, dass die Bodenplatten komplett frei auf den äußeren Fundamentsteinen hingen, sondern, dass aus dem Sand unter der Hütte eine kleine Pyramide herausragte.
„Hab‘ ich Halluzinationen?“, fragte er. Sein Vater warf sich neben ihm auf den Strand.
„Wenn du diese Kante da meinst – nein“, erwiderte der und wies auf die Spitze der Pyramide, die Jonas entdeckt hatte. Sie rappelten sich auf und räumten die geborstenen, verkanteten Bretter und Balken ab, legten sie halbwegs geordnet neben den Hüttenumriss auf den Boden, soweit sie noch verwendbar erschienen. Die Bretter, die so zerschlagen waren, dass sie gewiss nicht mehr als Teile der Außenverkleidung dienen konnten, schoben sie als Stützen unter die Bodenplatten, bis sie sie soweit stabilisiert hatten, dass sie die Bodenbretter gefahrlos betreten konnten. Mithilfe des Kuhfußes entfernten sie die Nägel der Bodenplanken und räumten auch diese beiseite. Die Pyramide, die sie gesehen hatten, ragte etwa in der Mitte des Hüttenbodens aus dem Sand.
Vater und Sohn schoben den Sand weg, der die Pyramide umgab. Die Spitze erwies sich als Ecke einer mit geteertem Segeltuch umhüllten Kiste, die schräge im Sand vergraben war.
„Junge, ich fange an, an Piratenschätze zu glauben“, grinste Bernd, als sie die Kiste frei hatten, die etwa so lang und breit wie ein Unterarm war und zwei Handbreit hoch war. Jonas zog die Kiste auf die noch befestigten Bodenplanken hoch und sah sie sich näher an.
„Das sieht wasserfest verschlossen aus“, brummte er. „Störtebekers Schatz? Was meinst du, Paps?“
Sein Vater grinste breit.
„Ich nehme nicht an, dass es des Toten Mannes Truhe ist. Aber wer weiß? Fünfzehn Mann auf des Toten Manns Kiste. Yohoho – und ‘ne Buddel voll Rum!“, rezitierte er das Lied aus Robert Stevensons Roman „Die Schatzinsel“, das auch in der Black-Dutchman-Trilogie Verwendung gefunden hatte.
„Vorsicht, Dad! Eine Urheberrechtsklage reicht!“, lachte Jonas. Er stellte die Kiste auf den Strand, sie packten die gelösten Bodenplanken wieder auf das Fundament und schichteten die noch brauchbaren Bretter und Balken einigermaßen ordentlich auf den Hüttenboden. Dann standen sie auf und klopften sich den nassen Sand von den Winterjacken und den Hosen.
„Das muss ohnehin erst mal trocknen, bevor wir das Teil wieder aufbauen können“, sagte Bernd. Aus der Jackentasche zog er Schnüre, mit denen sie die Bretter und Balken zu Bündeln banden, damit sie nicht weggeweht werden konnten. Die Knoten nagelte er auf den Bodenbrettern fest, um Passanten daran zu hindern, sie einfach mitzunehmen. Dann kehrten sie mit ihrem Fundstück ins Haus zurück.
„Was habt ihr denn da?“, wunderte sich Britta, als ihre Männer mit der Kiste ins Haus kamen.
„Die Hütte ist Mus. Wir wollten eigentlich nur die Bretter der Hütte sichern. Aber das haben wir da drunter gefunden“, sagte Bernd und präsentierte seiner Frau die Kiste.
„Und was ist da drin?“, hakte Britta nach.
„Keine Ahnung. Aber das haben wir gleich“, erwiderte Jonas. „Es lag unter unserer Strandhütte, also gehört es uns. Ich bin wirklich mehr als neugierig, was da unter unserer Hütte vergraben war.“
Jonas sah sich die Kiste inzwischen näher an. Sie hatte eine sorgsame Verpackung aus geteertem Segeltuch, dessen Enden mehrfach umgeschlagen und mit Teer regelrecht festgeklebt waren, hatte eine Kantenlänge von jeweils vielleicht vierzig Zentimetern Länge und Breite und zwanzig Zentimetern Höhe. Die Verpackung schien wasserdicht zu sein.
Er bewaffnete sich mit einem scharfen Messer, schliff es sicherheitshalber noch einmal nach und schlitzte zunächst das geteerte Segeltuch auf, das die Kiste umgab. Eine hölzerne Kiste kam zum Vorschein, die knochentrocken war. Die Nägel, die die Kiste verschlossen, waren ebenfalls mit Teer vergossen, die Ritzen wie ein Schiffsrumpf kalfatert. Auch der Deckel war mit Teer bestrichen und damit wasserfest zugeklebt. Jonas schob die Klinge gegen den Widerstand der zähen Kalfaterung unter den Kistendeckel. Mit einiger Mühe konnte er die Versiegelung des Deckels ablösen. Mit einem Hammer und einem Stechbeitel gelang es ihm, so viel Platz zu schaffen, dass er den Kuhfuß unter die vernagelten Bretter schieben konnte. Ein kräftiger Ruck – und das erste Brett sauste auf seinen Vater zu, der sich gerade noch mit einem Arm decken konnte.
„He, Vorsicht!“, mahnte Bernd. Mit etwas mehr Achtsamkeit löste Jonas auch die übrigen Deckelbretter. Darunter war ein weiterer mit Teer abgedichteter Segeltuchsack, dessen Oberfläche vollkommen trocken war. Jonas schlitzte auch diesen Sack vorsichtig auf – und löste eine Flut von Fotos, Negativen und Notizzetteln aus.
„Bei Davy Jones‘ Tentakelbart!“, entfuhr es ihm. „Das sind Fotos von Hissarlik, von der ukrainischen Steppe – und von der Glocke!“
„Boah! Das sind die Notizen deines Großvaters, Britta!“, keuchte Bernd, der die Zettel grob durchsah.
„Mit anderen Worten: Das ist der Beweis, dass es a) diese Glocke tatsächlich gibt oder gegeben hat und b) dass Papa die Zeichnung tatsächlich nach der Glocke selbst gefertigt hat oder sie nach einem Foto seines Vaters entstanden ist“, konstatierte Britta.
„Nicht nur das“, frohlockte Jonas. „Es ist Uropas Rehabilitation. Er hat die Geschichte nicht einfach erfunden oder nur hier aufgeschnappt. Er hat das wirklich alles erforscht und dokumentiert, wie es sich für einen ordentlichen Professor der Archäologie gehört. Professor Bluhm wird begeistert sein.“
Er sah sich die Fotos näher an.
„Diese Fotos passen in das Manuskript aus Aurich“, sagte er. „Seht mal, da sind Nummern hinten drauf.“
Er stand auf und holte aus seinem Zimmer das Manuskript, suchte im Abbildungsverzeichnis die Seite des Bildes, das gerade als Erstes auf dem Tisch lag.
„Das hier ist die Nummer 30, die hier hineingehört“, sagte er und legte das Foto auf den freigelassenen Platz, auf dem mit Maschinenschrift Abbildung 30 stand. Es korrespondierte mit der Beschreibung, die im Text auf diese Abbildung verwies.
„Das ist im Museum für Hamburgische Geschichte gemacht“, erkannte Bernd. „Durch das Fenster da ist das Bismarckdenkmal zu sehen. Und es entspricht exakt der Position der Glocke auf der Zeichnung – einschließlich der Keilschrift am unteren Rand.“
Jonas nahm eine Lupe zur Hand.
„Nee, nich‘ ganz“, entgegnete er. „Hier ist die Keilschrift ein wenig verwischt, so dass die unteren Keile nicht klar zu sehen sind. Das entspricht dem so genannten Entwurf von Brown. Hier ist die Nummer 31. Das ist eine Detailaufnahme des unteren Randes mit der Keilschrift.“
Er drehte das Foto nochmals um. Neben der Nummer war noch ein Schrägstrich, dahinter stand eine 3. Eine ebensolche Notiz fand sich auch auf dem Foto mit der Nummer 30.
„Hm, das Foto hat mir doch Graumann geschickt“, warf Britta ein. Jonas nickte.
„Stimmt. Das sind die hier“, sagte er und holte aus einer Schublade den Briefumschlag mit den Fotos. Sein Vater durchsuchte die Fotos nach übereinstimmenden Motiven und hatte schnell das dritte Foto gefunden. Auf allen war hinten neben der Nummer ein Schrägstrich mit einer zusätzlichen Ziffer
„Von denen, die mit so was bezeichnet sind, gibt es mehrere Abzüge“, erkannte Bernd.
„Vielleicht hat Opa schon welche für sich selbst oder für Papa machen lassen“, mutmaßte Britta.
„Oder es sind welche verschlampt worden und dein Großvater hat nochmals Abzüge machen lassen. Das wären dann die, die Graumann von Evers bekommen und nach Hamburg geschickt hat“, meinte Bernd.
„Vielleicht hat Opa auch Wolfson welche gegeben?“, spekulierte Britta weiter. Jonas schüttelte den Kopf.
„Nein, dann hätte er Brown nicht mehr nach Aurich schicken müssen und er wäre nicht hier gewesen, um nach Fotos zu fahnden“, entgegnete Jonas. „Ich nehme eher an, dass sie verloren gegangen waren. Der alte Evers hat sie ja im leeren Haus gefunden, wie Graumann schreibt. Sie könnten hinter einen Schrank gefallen sein. Wir haben jetzt jeweils zwei Abzüge dieser Fotos. Wenn die 3 hinter der Bildnummer drei Abzüge bedeutet, fehlt jeweils einer. Kann es sein, dass Opa die Fotos hatte und danach auch gezeichnet hat?“
„Dann muss er sie gut versteckt haben. In seinen Sachen waren sie jedenfalls nicht, als er zu uns gezogen ist“, erwiderte sein Vater.
„Dann haben wir sie wahrscheinlich versehentlich weggeworfen, als wir seinen Krümelkram aus den Schränken in die Umzugskisten verpackt haben“, seufzte Britta.
„Ist egal. Wir haben das Material, das Uropa zusammengetragen hat“, bemerkte Jonas. „Damit kann Professor Bluhm den Inhalt des Manuskripts abschließend prüfen und sagen, ob es als wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht werden kann. Und wir haben den Beweis – den wirklichen Beweis – dass nicht ich von Brown abgepinselt habe, sondern Brown von Uropa. Selbst wenn Agamemnon in die Berufung gehen sollte, werden sie damit auf die Nase fallen.“
Knapp dreihundert Kilometer weiter westlich räumten an diesem Samstagmorgen Helfer von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Freiwillige in Hamburg auf, was Orkan Xaver an Verwüstung zurückgelassen hatte. Die ebenso angedrohte wie befürchtete Katastrophe war ausgeblieben. Die Sachschäden hielten sich in erstaunlich engen Grenzen, was mit den ständigen Warnungen im Vorfeld des Orkans erklärbar war. Was nicht niet- und nagelfest war, hatten die Bewohner der vom Sturm bedrohten und später betroffenen Landstriche weggepackt, verstaut und gesichert. Die Deiche hatten gehalten und waren hoch genug gewesen, um eine solche Überflutung tiefliegender Stadtteile wie im Februar 1962 zu verhindern.
Am Rissener Elbdeich hatte die Flut einige Kratzer hinterlassen. Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg-Rissen suchten die weggerissenen Steine, um den Deich provisorisch zu flicken. Die Profis von der Hamburg Port Authority – nichts ging mehr ohne englische Bezeichnungen, so schien es – würden die richtige Reparatur vornehmen, sofern die Wetterlage und der Haushalt es hergaben.
„Manni! Kuck‘ ma‘! Was ‘s das denn?“, fragte einer der Feuerwehrleute plötzlich. Manfred Harders, Oberbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr von Hamburg-Rissen, stieg zu Tobias Brennecke hinunter, der ihn gerufen hatte.
„Was gibt’s?“, fragte der ältere Oberbrandmeister.
„Sach‘ ma‘, ist das Gold?“, fragte Brennecke und wies auf golden glänzende Bruchstücke, die aus dem Elbschlick unter der Deichbefestigung schimmerten. Harders kniete sich in die nasse Kälte und legte frei, was Tobias gefunden hatte. Es waren mehrere goldfarbene Bruchstücke, die mit einer Verzierung versehen waren, die ein geometrisches Muster von vertieften Quadraten und darin herausgearbeiteten, stilisierten Figuren zeigten. Ein Teil eines Rades war erkennbar. Harders zog sein Mobiltelefon und wählte die Nummer des Helms-Museums in Hamburg-Harburg.
„Harders, Freiwillige Feuerpatschen Rissen, Moin!“, meldete er sich, als er Verbindung hatte. „Ich steh‘ hier grad‘ im ramponierten Deich am annern Ende der Welt in Rissen, gleich anne Grenze nach Schläfrig-Holstein. Wir ha’m hier was gefunden, das könnte euch interessieren. Sieht nach … Bronze … oder so was aus. Nee, kein Gold. Vielleicht ’ne olle Glocke oder ‘ne zerbröselte Kanone. Wir packen da Steine auf und ich markier‘ das mit ’m roten X aus ‘er Sprühdose. Jou, mook wi, tschüß!“
Er schaltete die Verbindung aus, steckte das Handy ein und bedeutete seinen Kameraden, Steine auf die Fundstelle zu schichten. Er holte aus dem Rüstwagen, der auf der Straße zum Deich stand, eine Sprühdose mit Markierungsfarbe und sprühte ein dickes, signalrotes X auf die Stelle.
In einer Parterrewohnung in der Straße Rauschener Ring in Hamburg-Wandsbek klingelte im Flur ein Mobiltelefon in einer Winterjacke. Der Besitzer, Professor Dr. Roland Bluhm, seufzte.
„Och, nööö! Nicht am Samstagmittag!“, grollte er. „Tschuldigung …“, setzte er hinzu, stand vom Essenstisch bei seinen Großeltern auf und ging in den Flur. Er fingerte das Handy aus der Manteltasche, sah die Nummer des Helms-Museums und drückte die grüne Empfangstaste.
„Bluhm!“, knurrte er ins Telefon.
„Archäologisches Landesmuseum, Herrmann!“, antwortete der Anrufer. „Du musst dringend nach Rissen, Roland.“
„Is‘ grad‘ ‘n büschen ungünstig, Krischan. Ich sitz‘ grad‘ bei Oma und Opa am Mittagstisch …“, protestierte Bluhm.
„… sagte Admiral Kimmel in Pearl Harbor, als die Japse ihn beim Frühstück störten!“, erwiderte Christian Herrmann bissig, Rolands Kollege, der Dienst im Museum hatte. „Burschi, ich würde dich nicht am Samstag nach Nikolaus anrufen, wenn es nicht wirklich wichtig wäre. Die Sturmflut hat am Rissener Deich Bruchstücke einer Bronzeplastik freigelegt. Das muss sofort untersucht werden, bevor die HPA dabeigeht und den Deich repariert. Also, schwing die Hufe, bevor es dunkel wird!“
„Darf ich wenigstens noch aufessen?“
„Ausnahmsweise genehmigt. Aber sei in Rissen, solange es noch hell ist.“
„Zu Befehl, Sir!“, seufzte Bluhm. Er beendete die Verbindung und steckte das Telefon wieder in die Jackentasche. Einen Moment blieb er noch im Flur stehen. Er hasste es, wenn man ihn aus den seltenen Gelegenheiten privater Zusammenkünfte herausriss. Seine Großeltern waren über achtzig Jahre alt. Die Wahrscheinlichkeit, noch sehr oft mit ihnen gemeinsam essen zu können, war nicht besonders groß. Dafür war er zu oft im Ausland, um irgendwo irgendetwas auszugraben. Er war jetzt sechsunddreißig Jahre alt, einer der jüngsten Professoren, die die Universität Hamburg hatte. Gerade deshalb war meist Roland Bluhm gefragt, wenn es um Auslandsaufträge ging …
Er kehrte ins Wohnzimmer zurück.
„Doch nicht etwa ein Grabungsauftrag, Junge?“, wunderte sich seine Großmutter.
„Doch, Oma. Ich muss auch gleich nach dem Essen weg“, erwiderte er.
„Zu Weihnachten lässt du das verdammte Ding im Auto!“, wies sein Großvater ihn an. „Du bist so selten hier! Du siehst deinem Foto ja nicht mal mehr ähnlich!“, erwiderte der alte Herr grinsend. Roland rang sich ein Lächeln ab und aß weiter, aber der richtige Genuss war es nicht mehr.
Eine Viertelstunde später verabschiedete sich der Professor von seinen Großeltern. Während seine Eltern ihn am liebsten in einem einträglichen Job in der so genannten freien Wirtschaft gesehen gehabt hätten und nur schwer hatten verstehen können, dass ihr Sohn eine anscheinend brotlose Kunst wie Geschichte und Archäologie hatte studieren wollen, hatten seine Großeltern väterlicherseits sein schon früh erwachtes Interesse an der Geschichte gefördert, hatten ihrem Enkel Wohnung gegeben, als er studiert hatte und sein Vater gemeint hatte, er könne ihm kein Studium finanzieren.
Er fuhr so schnell, wie es die Straßenverhältnisse und die Verkehrslage zuließen, nach Rissen an die westliche Hamburger Stadtgrenze. Er traf auf hart schuftende Feuerwehrleute.
„He, bleiben Sie da mal weg, junger Mann!“, schnauzte ihn Oberbrandmeister Harders an.
„Bluhm, Universität Hamburg. Irgendwer hat hier nach dem Archäologen vom Dienst geklingelt. War ’n Sie das?“, erkundigte Roland sich mit leisem Knurren in der Stimme. Der ältere Oberbrandmeister sah ihn verblüfft an. Unter Archäologen hatte er sich immer ältere Herren mit Spaten und Hacke vorgestellt – von einem Filmhelden seiner Jugendzeit abgesehen, aber der war eben Kintopp und nicht real. Vor ihm stand ein etwa einen Meter achtzig großer, schlanker junger Mann mit einem recht verwegen wirkenden Drei-Tage-Bart, kurz geschnittenem dunklem Haar in Jeans und Winterjacke. Seine sechsunddreißig Jahre nahm dem Professor kaum jemand ab. Er wirkte deutlich jünger.
„Hallo, Indiana Jones“, grinste Harders. „Is‘ vielleicht nicht gerade die Bundeslade, die wir hier versehentlich ausgebuddelt haben, aber es könnte Sie interessieren. Kommen Sie!“
Er winkte Bluhm zu der markierten Fundstelle am äußeren Deichrand. Der Archäologe räumte die aufgeschichteten Steine ab und legte die Bronzestücke frei. Er glaubte seinen Augen nicht trauen zu können, als er Reliefteile darauf entdeckte, die ihn an die Glocke erinnerten, die er im Prozess Agamemnon gegen Mönke auf dem Foto der Agamemnon Filmgesellschaft gesehen hatte.
„Was meinen Sie? Ist das was wert?“, fragte Tobias, der die Bruchstücke zuerst bemerkt hatte. Der Professor nickte.
„Ja, allerdings. Das sieht nach einer bronzezeitlichen Arbeit aus. Grob geschätzt dreitausend Jahre alt.“
Er kehrte zu seinem Auto zurück und holte eine Kunststoffwanne, um die ausgegrabenen Teile abzulegen. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit hatte er etwas mehr als ein Dutzend Bronzeteile aus dem Deichrand gegraben, als er stutzte. In der Hand hielt er ein halb geschmolzenes Straßenschild, an dem noch ein Rest der für Hamburg typischen blauen Emaillierung zu erkennen war. Ausschläger Weg war mit Mühe darauf zu lesen.
Der Ausschläger Weg war eine Straße im Hamburger Stadtteil Hammerbrook, der während des II. Weltkrieges bei den Luftangriffen der Operation Gomorrha zwischen dem 24. Juli und dem 3. August 1943 im Zentrum des grauenhaften Feuersturms gewesen war. Temperaturen über eintausend Grad Celsius und ein Hurrikan von um die 270 Stundenkilometern, ausgelöst durch den Schornsteineffekt des lodernden Flammenmeeres hatten die Stadtteile Rothenburgsort, Billbrook und Hammerbrook völlig vernichtet, hatten etwa dreißigtausend Tote hinterlassen – und eine unglaubliche Menge Schutt.
Offensichtlich hatte ein Teil dieses Schutts wohl dazu gedient, den Deich bei Rissen zu flicken oder zu verstärken. Wie sonst sollte ein in dieser entsetzlichen Hitze geschmolzenes Straßenschild aus Hammerbrook sonst an den Deich bei Rissen kommen?
Aber wie kamen Bruchstücke einer größeren Bronzearbeit hierher, die etwa dreitausend Jahre alt waren? Wieso lagen sie im Bombenschutt? Und waren das möglicherweise wirklich die Bruchstücke der Glocke, die Professor Trojan beschrieben hatte? Das bedurfte näherer Untersuchung.
Professor Bluhm hatte außer den Bronzeteilen noch einige Schuttstücke in seiner Plastikschüssel liegen, die vielleicht weitere Informationen dazu ergeben konnten, wo die Bronzeplastik vor dem Krieg gewesen war und wie sie in den Bombenschutt gelangt war.
Er brachte die Fundstücke ins Institut für Archäologie und Kulturgeschichte des antiken Mittelmeerraumes der Universität Hamburg, das im Westflügel des Universitätsgebäudes an der Edmund-Siemers-Allee in Hamburg untergebracht war. Als er die Fundstücke auf dem Sortiertisch ausgebreitet hatte, meldete er zunächst seinem Kollegen Herrmann, dass er den Auftrag ausgeführt hatte und rief dann Jonas auf dessen Mobiltelefon an.
„Hallo, Herr Mönke. Bluhm hier. Sie glauben nicht, was ich gefunden habe.“
Kapitel 15
Puzzle
Der Montag, es war der 9. Dezember 2013, holte sowohl Jonas Mönke und seine Eltern als auch Roland Bluhm zunächst in den Arbeitsalltag zurück. Für den Professor war es mitten im Semester, es standen Prüfungen für Scheine an. Für Jonas bedeutete es, mit aller Anstrengung die letzten Reservearbeiten an seinen elektronischen Akten zu machen – in bezahlten Überstunden. Das schloss zunächst aus, dass er nach Feierabend noch nach den Fundstücken sehen konnte, die Professor Bluhm gesichert hatte. Immerhin hatte er Bluhm aber noch Scans der Fotos zuschicken können, die die Glocke im Museum zeigten.
Die Fundstücke hatten Roland Bluhm keine Ruhe gelassen. Er war am Sonntag nochmals in die Universität gefahren und hatte auf seinem Laptop das Foto bei sich, das er als Gerichtssachverständiger zur Verfügung gestellt bekommen hatte.
„Das gibt’s doch nicht!“, stieß er hervor und vergrößerte einen bestimmten Ausschnitt. Darauf nahm er ein Detail der fotografierten Glocke näher in Augenschein. Er erkannte Strukturen wieder, die er auf den Bronzebruchstücken gesehen hatte und begann, die gefundenen Teile zusammenzusetzen. Das Puzzle erwies sich als einfacher als gedacht. Zehn der zwölf Teile passten problemlos ineinander. Die beiden anderen waren augenscheinlich nicht weit von den anderen zu Hause, wenn man das Foto betrachtete.
„Das ist unglaublich!“, sagte er zu sich selbst. „Wenn die Bruchstücke der Glocke alle so groß sind wie diese, besteht das Puzzle aus mindestens tausend Teilen. Wie kommen zwölf Teile einer mannsgroßen Glocke, die fast alle direkt zusammenpassen, auf einem Haufen in bunt gemischten Bombenschutt? Da stimmt doch was nicht!“
Er machte mit einer Digitalkamera ein Foto der zusammengesetzten Teile und überspielte es in den Laptop. Das musste er unbedingt seinen Studenten zeigen.
Professor Bluhm unterrichtete Mittelalterliche Archäologie mit Forschungsschwerpunkt Kreuzzüge und Hanse, ein Fach mit vielen Nebenaspekten wie Religion, Schifffahrt, Kartografie, Handelsbeziehungen, Erbrecht, Rittertum, Lehensrecht, Ständegesellschaft. Seine Forschungen hatten ihn häufig in den Nahen Osten geführt, er arbeitete an einer Publikation über die Adelsfamilie Ibelin, die in der allgemeinen Geschichtsschreibung eher verschwiegen wurde und allenfalls in der Spezialliteratur zu dem Kreuzzügen Erwähnung fand.
Die meisten seiner Studenten – insbesondere seine Studentinnen – hatten gelegentlich den Eindruck, von Balduin von Caymont persönlich unterrichtet zu werden. Ähnlich genug sah der Professor dessen halbfiktiver filmischer Verkörperung jedenfalls …
Die Vorlesung an diesem Montag verlief etwas anders als normal …
„Meine Damen und Herren, wir sind derzeit beim Thema private Lebensumstände der Lübecker Bürger im 13. Jahrhundert, das von den Kollegen der Christian-Albrechts-Universität Kiel gegenwärtig in Lübeck durch Grabungen näher erschlossen wird. Dorthin wird uns auch unsere Tagesexkursion am 22. Dezember führen. Aber selbst im Leben eines Archäologen gibt es hin und wieder Überraschungen, die nicht recht in einen Vorlesungsplan passen mögen. Nach der Sturmflut vom Freitag bekam ich am Samstag einen Anruf von dem Kollegen Dr. Herrmann, der mich bat, einen beschädigten Elbdeich bei Rissen zu besichtigen. Was ich dort fand, sehen Sie hier.“
Er präsentierte ein Foto der zusammengesetzten Teile der Bronzeglocke.
„Boah, ey!“, entfuhr es Maximilian Thomsen. „Das sieht ja voll nach der Glocke aus Mykene aus!“
„Interessant, oder?“, schmunzelte der Professor. „Es hat den Anschein, dass die Bruchstücke, die ich am Samstag geborgen habe, mit Bombenschutt aus dem Zweiten Weltkrieg zur Instandsetzung des Deiches während oder kurz nach dem Krieg verwendet wurden. Und dann ist da noch diese Glocke, die Sie schon mal testweise abgezeichnet haben.“
Er spielte das Foto von Agamemnon-Pictures ein.
„Wie Max es richtig erkannt hat, ist dies tatsächlich die Glocke, die für den Film Mykene, von Weta Digitals als Filmrequisit hergestellt wurde. Sie haben sie nach genau diesem Foto gezeichnet. Jetzt kann ich Ihnen sagen, wofür Sie das gemacht haben. Ich war als Sachverständiger in einem Urheberrechtsprozess. Es ging um genau diese Glocke, die der Beklagte für sein Buch Die Glocke des Todes von dem Foto abgezeichnet haben soll, das ich Ihnen als Zeichenvorlage gegeben habe. Es hat sich im Zuge dieses Prozesses aber herausgestellt, dass nicht Jonas Mönke, der Autor des Buches, abgezeichnet hat, sondern der Konzeptdesigner, der diese Glocke für den Film entworfen haben wollte. Die Klage ist inzwischen abgewiesen. Aber der Autor hat inzwischen auf Usedom Unterlagen ausgegraben, die sein Urgroßvater dort hinterlassen hat. Der Mann war Professor für Archäologie an der Universität Berlin und hieß Boris Trojan. Diese Unterlagen befassen sich mit der untergegangenen Stadt Vineta.“
Einige Lacher im Auditorium wurden laut.
„Vineta wurde lange Zeit für eine reine Legende gehalten, das ist wahr“, ging Bluhm auf die Lacher ein. „Auch Troja galt als Legende oder Erfindung Homers. Inzwischen wissen wir, dass es an der Stelle, die Homer beschrieb, sechs bis zwölf Besiedelungsstufen auf dem Hügel von Hissarlik gegeben hat, von denen die Stufen sechs und sieben der Zeit zuzuordnen sind, in der Homers Geschichten spielen. Hätte sich Heinrich Schliemann nicht mit der Ilias in der Hand auf eben diesen Hügel gestellt und hätte angefangen zu graben, dann säßen Sie wahrscheinlich heute nicht in einem Studiengang, der sich Archäologie nennt. Also, Vorsicht damit, Legenden als per se unmöglich oder als Kindermärchen abzutun“, gab er zu bedenken. „Ob sich aus dem Fund ein richtiges Projekt entwickelt, kann ich jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen, aber das Manuskript von Trojan, das ich während des Prozesses sehen konnte und die nun aufgetauchten Unterlagen, die Trojan zusammengetragen hat, versprechen Forschungsmaterial. Ich möchte heute den Deich weiter untersuchen. Es werden sich dabei mit Sicherheit auch Aspekte anderer Zeiten ergeben, die vielleicht nicht in die von uns hauptsächlich erforschte Zeit passen, aber als Archäologen ist uns keine Zeit gleichgültig. Wenn wir also Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg finden, wird das sicher nicht weniger interessant sein. Wer möchte sich daran beteiligen?“
Zahlreiche Hände flogen nach oben.
Die Expedition an den Rissener Elbdeich war rasch organisiert. Wenig später waren etwa zwei Dutzend Studenten dabei, den Deich vorsichtig auseinanderzunehmen und sämtliche Stücke zu bergen, die nicht ursprünglich für die Deichbefestigung gedacht waren. Es fanden sich außer zahlreichen weiteren Bronzeteilen Ofenkacheln, Straßenschilder, Hausnummern, Fabrikationsmarken in Steinen – und eine Unzahl weiterer Artefakte, die auf Häuser hinwiesen, die im Krieg zerstört worden waren. Die Bronzeteile sammelten die jungen Leute in einem gesonderten Behälter. Die Fundorte wurden sorgfältig dokumentiert und gezeichnet.
Einen weiteren Tag später war der Fundort abgeräumt. Es war nur ein kleiner Teil gewesen, der an diesem Deich mit Bombenschutt ausgebessert worden war. Dr. Christian Herrmann, der zum zweiten Grabungstag mitgekommen war, sah die Kleinräumigkeit des Lochs im Deich.
„Das ist so klein, da könnte ein Blindgänger liegen. Wir sollten die HPA informieren, dass sie auf jeden Fall die Luftbilder zu Rate ziehen, bevor sie den Deich großflächig aufmachen“, bemerkte er und wählte auf dem Mobiltelefon die Nummer der Hafenverwaltung.
Im Archäologischen Institut im Westflügel des Hauptgebäudes der Universität Hamburg an der Edmund-Siemers-Allee bereiteten die Studenten am 12. Dezember die Fundstücke auf, ordneten sie möglichen Entstehungszeiten zu. Maximilian Thomsen, Vanessa Karl, Stefanie Ehlers und Melanie Siems nahmen sich der Bronzestücke an und rekonstruierten die Bronzeglocke unter der persönlichen Begleitung ihres Professors. Sie war in der Tat etwa mannshoch.
Bei den modernen Artefakten zeigte sich schon bald, dass die Teile aus sehr unterschiedlichen Gebäuden stammen mussten. Diverse Straßenschilder und Hausnummern ergaben, dass auch große räumliche Unterschiede der Schuttherkunft gegeben waren. Umso erstaunlicher war es, dass die Bronzeglocke vollständig an diesem eng begrenzten Ablageplatz vorhanden gewesen war.
„Tja, was schließen wir aus diesem Umstand?“, fragte Roland seine Studenten. Max bat ums Wort.
„Max, was meinen Sie?“, forderte Bluhm ihn zur Antwort auf.
„Die Glocke wurde dort gezielt eingebracht. Es kann unmöglich sein, dass wir Artefakte aus zehn Straßen und vierzig Gebäuden in Rothenburgsort, Billbrook und Hammerbrook finden, die offensichtlich bunt gemischtes Füllmaterial für den Deich waren – aber die Glocke in diesem Gemisch so ganz zufällig vollständig enthalten war. Die Glockentrümmer hat jemand bewusst unter diese Ladung Schutt gemischt“, erklärte der junge Mann.
„Sehen wir uns mal dieses Foto an“, sagte der Professor und projizierte über den Laptop eines der gescannten Fotos, die Jonas Mönke ihm von Usedom zugeschickt hatte. „Auf der Rückseite ist als Aufnahmedatum der 27. April 1933 angegeben.“
Melanie hob die Hand. Bluhm nickte ihr zu.
„Darauf ist die Glocke ohne Beschädigung erkennbar“, sagte sie.
„Gut. Was erkennen Sie noch?“, halte Roland nach. Sie sah das projizierte Fotos verständnislos an, wusste nicht, worauf der Professor hinauswollte.
„Sehen Sie jetzt mal nicht auf die Glocke, sondern daneben. Was sehen Sie da, Melanie?“, half der aus.
„Ein … ein Fenster.“
„Okay. Was ist durch dieses Fenster sichtbar?“
„Der olle Bismarck“, platzte Max ohne Aufforderung heraus. Das gewaltige Bismarckdenkmal im alten Elbpark an der Seewartenstraße war mit über vierunddreißig Metern Höhe nicht nur das weltweit höchste Denkmal, das Otto von Bismarck gesetzt worden war, es war nach wie vor neben dem Michel – der Sankt-Michaelis-Kirche – dem Fernsehturm und der noch immer im Bau befindlichen Elbphilharmonie eines der Wahrzeichen Hamburgs.
„Wir folgern daraus …?“, bohrte Roland weiter.
„Na ja, dass die Glocke am 27. April 1933 in intaktem Zustand in Hamburg war“, ließ sich Vanessa vernehmen, ebenfalls ohne großartige Aufforderung durch den Professor.
„Sehr gut, Vanessa“, lobte Bluhm. „Sie sind nicht alle aus Hamburg und kennen vermutlich nicht alle das Gebäude, in dem die Glocke damals stand – oder erkennt es jemand?“
Steffi meldete sich.
„Das müsste das Museum für Hamburgische Geschichte sein“, sagte sie, nachdem Roland sie per Handzeichen zum Sprechen aufgefordert hatte.
„Stimmt. Gut beobachtet und erinnert, Stefanie. Kommen wir nochmal auf unsere schöne rekonstruierte Glocke zurück. Was fällt Ihnen auf – außer den Bruchstellen?“
„Diese Glocke hat eine ungewöhnliche Form, jedenfalls ungewöhnlich für Glocken, die hierzulande in einer Kirche hängen würden“, antwortete Max.
„Max, Ihnen ist doch eine Ähnlichkeit aufgefallen, oder? Erzählen Sie mal …“, forderte der Professor den Studenten auf.
„Nee, im Ernst, die sieht genauso aus wie die Glocke, mit der in der Verfilmung von Mykene von 2004 in Mykene Alarm vor der anrückenden Trojaner-Flotte gegeben wurde“, sagte er. „Äh … wie geht denn das? Ist das Zufall?“
„Tja, das ist die große Frage“, erwiderte Professor Bluhm. „Diese Glocke hat zweifellos asiatischen Charakter – allerdings eher aus dem Mittelalter oder der frühen Neuzeit. Sie passt in keiner Weise in unsere bisherige Vorstellung einer Glocke, die man zur selben Zeit in Mitteleuropa benutzt hat und bis heute benutzt oder in der Antike in Vorderasien Verwendung gefunden hat. Vielleicht würden wir uns weniger wundern, wenn die Aufzeichnungen eines früheren Kollegen meiner Zunft hätten veröffentlicht werden können. Die Aufzeichnungen, die Jonas Mönke gefunden hat, sind in unterschiedlicher Art historisch interessant. Einmal bezüglich der Person des Vineta-Forschers Boris Trojan, dessen Name niemandem von uns bisher bekannt war. Und zum zweiten natürlich wegen seiner Forschungsergebnisse.“
Bluhms Mobiltelefon klingelte. Als Rufzeichen verwendete er den Titel „Caymont“ aus dem Soundtrack zu dem Film Crusade, was seine Studenten regelmäßig schmunzeln ließ. Sein Faible für die Familie Ibelin hatte seine Wurzeln in diesem Film …
Er sah auf die Nummer, erkannte die seines Kollegen Herrmann und drückte die grüne Annahmetaste.
„Bluhm!“, meldete er sich.
„Sitzt du oder stehst du?“, fragte Christian.
„Stehe in der Vorlesung üblicherweise“, knurrte Roland.
„Dann setz‘ dich, sonst fällst du um.“
„Erzähl‘!“
„Die HPA hat den Deich anhand der alten Luftbilder überprüft. Kleiner Einschlagkrater. Sie haben vorsorglich den Kampfmittelräumdienst alarmiert. Die haben da eine Luftmine raus gekratzt. Eine von diesen fiesen Dingern mit Säurezünder, die auch siebzig Jahre nach Abwurf noch aktiv sind. Die Entschärfung ist nur sehr knapp gutgegangen. Der Sprengmeister hat erfahren, dass wir da mit zwei Dutzend Leuten fröhlich gebuddelt haben und hat mich gefragt, ob wir nicht alle Tassen im Schrank haben. Ich hab‘ ihm gesagt, dass wir einem Fund in gemischtem Bombenschutt nachgegangen sind und erst bei der eigentlichen Freilegung der Befunde die Kleinräumigkeit des Deichschadens gesehen haben und die HPA informiert haben. Ich krieg noch nachträglich weiche Knie!“, erklärte Herrmann.
„Danke“, sagte Roland tonlos. „Du lieber Himmel. Danke für die Info, Christian.“
Er drückte die rote Taste, um das Gespräch zu beenden.
„Meine Damen und Herren, wir dürfen den 10. Dezember 2013 als zweiten Geburtstag eintragen“, wandte er sich an das Auditorium und berichtete, was Herrmann ihm erzählt hatte. Die jungen Leute wurden bleich, als ihnen klar wurde, wie gefährlich diese Aktion gewesen war. Die Bombe hätte jederzeit durch eine Erschütterung hochgehen können …
„Krass!“, entfuhr es Maximilian. „Ich hätte nicht gedacht, dass Archäologie mal in einen Krimi umschlagen könnte.“
„Wie meinst ’n das, Maxi?“, fragte Vanessa.
„Eine vollständige Bronzeglocke landet im bunt gemischten Schutt einer einzigen Flickstelle in einem Deichabschnitt, der unter natürlichen Umständen so gut wie nie beschädigt wird. Der einzige Schaden ist ein siebzig Jahre alter Bombenschaden – und das Ding ist ein Blindgänger!“, fasste Jonas zusammen, was sie bisher wussten. „Wer immer die Glocke zerdeppert und da reingestopft hat, wollte, dass sie nie wieder auftaucht!“
„Und wieso meinst du, dass die Glocke mit Absicht zerstört wurde?“, fragte Falko.
„Weil das Museum für Hamburgische Geschichte im Krieg nicht zerstört wurde. Jedenfalls nicht so wie Barmbek, Wandsbek oder gar die richtig üblen Feuersturmgebiete Hammerbrook, Rothenburgsort und Billbrook. Kann sein, dass da mal ‘n paar Scheiben in die Grütze gegangen sind oder das Dach gelüftet wurde – aber richtig zerstört war es nicht. Sonst wäre wohl von den Sammlungen dort nix erhalten geblieben.“
Vanessa nahm ihr Smartphone zu Hilfe und suchte im Internet. Sie fand unter der Webadresse www.geschichtsspuren.de eine Seite mit Kriegsbildern aus Hamburg, auf der auf ein Forschungsprojekt verwiesen wurde, in dessen Rahmen die Zerstörungen in Hamburg auf einem Stadtplan eingetragen waren. Ein Link dort brachte sie auf die Seite www.landkartenarchiv.de weiter, auf der dieser Stadtplan vergrößert und verschiebbar abgelegt war, so dass nicht nur der kleine Ausschnitt von der vorherigen Seite sichtbar war, sondern auch Orte außerhalb dieses Ausschnitts gezielt angesteuert und betrachtet werden konnten.
„Maxi, wo ist das Museum genau?“, fragte sie.
„Holstenwall, fast am Millerntor. Die Hausnummer weiß ich nicht, aber es ist ein einzelnstehendes Gebäude“, erwiderte Thomsen. „Lass mich mal sehen, Nessi.“
Vanessa gab ihm ihr Smartphone, Max suchte, bis er den entsprechenden Abschnitt gefunden hatte.
„Bingo!“, entfuhr es ihm. „Wusst‘ ich’s doch! Nicht zerstört!“, jubelte er, als beim Museum für Hamburgische Geschichte die rote Schattierung fehlte, die – je nach Intensität der Färbung – auf diesem speziellen Stadtplan die Beschädigung oder gar Zerstörung von Gebäuden darstellte.
„Das Museum gibt es dort seit 1908. Wenn es in Mitleidenschaft gezogen worden wäre, hätte es hier rot sein müssen. Is‘ es aber nich‘. Museum heil“, triumphierte er. „Also bleibt nur, dass die Glocke nach dem 27. April 1933 bewusst zerstört wurde und ihre Teile ebenso bewusst beim Ausflicken eines durch einen Blindgänger beschädigten Deiches im dafür verwendeten Schutt verwendet wurde. Und da drängt sich doch die Frage auf: wieso? Wieso zerstört jemand eine aller Wahrscheinlichkeit nach antike Glocke aus der Bronzezeit, die in einem Museum ausgestellt ist, und muschelt die Trümmer unter Bombenschutt?“
Kapitel 16
Wunder
Die Frage, wer die zerstörte, aber komplette Glocke mit Bombenschutt aus mindestens zehn Straßen vermischt hatte, um sie in einem Blindgängerloch verschwinden zu lassen, ließ Roland Bluhm keine Ruhe. Am selben Abend rief er Jonas Mönke an, berichtete ihm von der weiteren Entwicklung und fragte ihn, ob er in den Unterlagen vielleicht etwas gefunden hatte – eine Registernummer des Museums zum Beispiel.
„Nein“, sagte Jonas. „Ich will am Wochenende mit den Fotos ins Museum. Vielleicht findet man über die Fotos etwas. Aber das mit dem Blindgänger ist ja der Hammer! Ich glaube, das wäre etwas für meinen Vater als Journalist. Das gäbe eine Riesenstory.“
„Haben Sie schon was von Ihrem Prozesskontrahenten gehört?“, fragte der Professor weiter.
„Nein, auch nicht. Mein Anwalt wollte die Agamemnon über die Unterlagen informieren in der Hoffnung, sie damit von einer Berufung abzuhalten“, erwiderte Jonas.
„Wann wollen Sie ins Museum? Ich wäre gern dabei, wenn Sie nichts dagegen haben“, erkundigte sich Bluhm.
„Ich wollte nächsten Mittwoch nach Feierabend ins Museum. Ich werde wohl gegen vier Uhr dort sein. Treffen wir uns am Museum?“
„Gut, dann bis Mittwoch um vier“, bestätigte Roland.
Zur gleichen Zeit saß ein totenbleicher Hauke Schiemann im Büro von Simeon Lupus.
„Und Sie sind sicher, dass das in die Hose geht? Kann man da nichts machen?“, fragte er mit versagender Stimme.
„Es lässt sich leider nicht wegdiskutieren, dass Mönke Unterlagen hat, die beweisen, dass er keinesfalls irgendetwas kopiert hat. Die Fotos legen vielmehr nahe, dass sich Herr Brown fremden geistigen Eigentums bedient hat. Sie haben nur Glück, dass Mönke keine Widerklage erheben kann, weil er nicht selbst Anspruchsinhaber ist, und dass Frau Mönke gegen Herrn Brown in den USA klagen müsste“, erklärte Lupus.
„Seit wann geben Sie so leicht auf, Herr Lupus? Das kenne ich nicht von Ihnen!“, versetzte Schiemann. „Welche Möglichkeit besteht, die Echtheit der Dokumente in Zweifel zu ziehen? Darin sind Sie doch sonst Meister.“
Simeon Lupus sah den Geschäftsführer der Agamemnon-Film eine Weile an.
„Ich bin ein Mietmaul, Herr Schiemann. Ich vertrete Ihre Interessen, wenn Sie mir einen entsprechenden Auftrag geben. Mein Geld bekomme ich – von einem unterlegenen Beklagten oder von Ihnen, wenn der Prozess Ihrerseits verloren wird“, sagte er schließlich. „Aber selbst ein Rechtsanwalt wie ich hat einen Ruf zu verlieren. Bislang konnte ich bei meinen Mandanten damit punkten, dass ich die Prozesse gewinne, wenn ich entsprechendes und legales Futter bekomme, mit dem ich die Argumente der Gegenseite wegputzen kann. Hier haben wir ein Problem: Brown hat mir gegenüber eingeräumt, dass er seinen Entwurf nach dem Foto gemacht hat, das er auf Usedom bekommen hat. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Herrn Brown wegen Falschaussage und hat sogar einen Haftbefehl gegen ihn erwirkt. Er hatte nur Glück, dass er rechtzeitig am Flughafen und außer Landes war, bevor der Haftbefehl erlassen wurde. Den können wir als Zeugen nicht mehr präsentieren – unabhängig von dem Umstand, dass er bei einer Rückkehr nach Deutschland sofort am Flughafen verhaftet werden würde.
Und mir erschließt sich nicht, wie die Zeugen der Gegenseite als unglaubwürdig dargestellt werden können, solange wir keine frühere Bekanntschaft zwischen ihm und dem Archivar, dem Journalisten, dem Schriftsachverständigen und dem Professor nachweisen können. Können Sie das?“
„Ich habe da einen IT-Spezialisten, der in der Lage ist, die Sicherheitseinrichtungen von Telekom und Co zu umgehen und Handydaten auszulesen …“, erwiderte Schiemann.
„Ist das derselbe, der dem Felder-Verlag schon vergeblich den Entwurf von Herrn Brown als neues Bild untergejubelt hat, getarnt als E-Mail von Mönke?“, fragte Lupus bissig.
„Ich konnte ja nicht ahnen, dass dieser grüne Junge das rechtzeitig spitzkriegt und die sich irgendwie anders verständigt haben“, brummte Schiemann.
„Herr Schiemann, ich kenne Herrn Mönke aus seinem Beruf, ich kenne seinen Laden. Bei Sperling-Assekuranz und einigen anderen Versicherern stehe ich in dem Ruf, Betrüger zu vertreten, weil häufig Leute zu mir kommen, die in … sagen wir … zweifelhafte Unfälle verwickelt waren oder Abrechnungen vornehmen, die der Versicherungswirtschaft nicht passen. In der Regel kann ich damit argumentieren, dass die Versicherer nur ihre Kröten zusammenhalten wollen und nicht willens sind, einen Schaden angemessen zu regulieren. In Ihrem Fall habe ich damit langsam Schwierigkeiten …“
„Wie meinen Sie das?“, fragte Schiemann.
„Es ist doch offensichtlich, dass Sie einen Anspruch durchsetzen wollen, der nie bestanden hat. Als Sie mit der Angelegenheit zu mir kamen, haben Sie es mir gegenüber so dargestellt, dass Mönke die Glocke abgezeichnet hat, die Ihr Designer Brown entworfen hat. Es ist natürlich Pech, dass Sie dabei ausgerechnet an den Urenkel dessen geraten sind, der die Geschichte dieser Glocke erforscht hat und das Foto gemacht hat, nach dem Ihr Designer die Glocke … ähem … entworfen hat, um nicht kopiert zu sagen. Bei achtzig Millionen Einwohnern, die Deutschland etwa hat, ist das ein richtiger Lottotreffer – nur im negativen Sinn. Ich nehme an, Ihr IT-Spezialist wäre wahrscheinlich auch in der Lage, Handydaten zu manipulieren und würde das auch tun, wenn damit die Glaubwürdigkeit der Zeugen untergraben werden kann. Ihr Problem besteht darin, dass Ihr Zeuge noch viel unglaubwürdiger ist – und das ohne jede Manipulation. Diesen Prozess, Herr Schiemann, den können Sie nicht gewinnen. Ich rate Ihnen von einer Berufung dringend ab.“
„Und wenn ich verlange, dass Sie in die Berufung gehen?“
„Mit manipulierten Handydaten, so wie Sie die neue Auflage von Mönkes Buch manipulieren wollten? In dem Fall lege ich das Mandat nieder“, entgegnete Lupus.
„Ich werde darüber nachdenken.“
„Weshalb machen Sie diesen Zirkus, Herr Schiemann? Wieso wollen Sie einem jungen Schriftsteller wegen eines Bildes, an dem Sie und die Agamemnon-Film keine Rechte haben, Geld abknöpfen?“, fragte Lupus direkt.
„Die Hintergründe gehen Sie nichts an. Sie sind Rechtsanwalt und vertreten die Interessen Ihrer Mandanten“, entgegnete Schiemann. „Sie sind doch sonst nicht so gefühlsduselig.“
„Gefühlsduselig?“, schnappte Lupus. „Wenn Sie wirklich meinen, jemandem ein Bein stellen zu müssen, indem Sie dessen E-Mail-Konto hacken lassen, um seinem Verlag ein Bild unterzuschieben, das er selber gar nicht gefertigt hat und auch nie freiwillig seinem Verlag schicken würde; indem Sie möglicherweise dessen Handy manipulieren lassen wollen, um Telefonate vorzugaukeln, die nie stattgefunden haben, um mit diesen Daten einen Prozess zu gewinnen, dann ist das Betrug, Herr Schiemann. Und da mache ich nicht mit. Haben wir uns verstanden? Ich lege das Mandat nieder. Punkt.“
Schiemann stand auf.
„Sie werden sich hoffentlich der anwaltlichen Schweigepflicht entsinnen, Herr Lupus. Ich würde es nicht amüsant finden, wenn Sie den Inhalt unseres heutigen Gespräches weitergeben würden“, sagte er.
„Sollte ich mich in dem Fall darauf einrichten, dass Ihr IT-Spezialist sich auch meiner Kommunikation so liebevoll annehmen würde, wie der des Beklagten? Oder dass Sie mir Igor, den Türsteher vom Kiez, auf einen Freundschaftsbesuch schicken würden?“. Verschwenden Sie daran lieber nicht mal einen Gedanken, Herr Schiemann. Ich werde dem Gericht und der Gegenseite mitteilen, dass ich das Mandat niederlege. Nicht mehr, nicht weniger. Ich schicke Ihnen meine Rechnung. Verlassen Sie bitte mein Büro!“
Derart hinauskomplimentiert stand Hauke Schiemann eine Weile vor der Tür des Hauses, in dem sich Lupus‘ Büro befand.
‚Sollte an dem Fluch der Glocke etwa doch was dran sein?‘, fragte er sich in Gedanken.
Am nächsten Tag rief Simeon Lupus Jonas‘ Anwalt an.
„Lupus, guten Tag Herr Kollege. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich in der Sache Agamemnon gegen Mönke das Mandat niedergelegt habe.“
„Wie bitte?“, hakte Schmidt verwirrt nach.
„Herr Schiemann wollte mit aller Gewalt in die Berufung. Ich habe ihm davon abgeraten, weil mit den vorhandenen Beweisen die Klage auch in der Berufungsinstanz nur abgewiesen werden kann, aber er bestand darauf. Aussichtslose Prozesse führe ich aber nicht und habe das Mandat niedergelegt“, erklärte Lupus.
„Dann muss mein Mandant also mit einer Berufung rechnen, verstehe ich Sie richtig, Herr Kollege?“, hakte Schmidt nach.
„Ja, ich nehme es an.“
„Gut, ich werde es ihm sagen. Danke für die Information, Herr Kollege.“
Der Telefonhörer lag knapp auf der Gabel, als Schmidt ihn wieder abhob und Jonas‘ Büronummer wählte.
„Hallo, Herr Mönke, Schmidt hier“, meldete er sich, nachdem Jonas abgenommen hatte. „Ich hatte eben einen Anruf von unserem Freund Lupus. Er hat das Mandat niedergelegt.“
„Wie bitte?“, fragte Mönke ebenso verwirrt wie zuvor sein nun informierter Anwalt.
„Schiemann wollte unbedingt die Berufung, von der Lupus ihm abgeraten hat. Und weil er nicht auf Lupus hören wollte, hat der das Mandat niedergelegt“, erklärte Schmidt. „Mit Berufung müssen wir also weiterhin rechnen.“
„Gut. Danke für die Info. Wenn der Lupus nicht mehr mitspielen will, dann ist an der Sache wirklich was faul. Mailverkehr also weiterhin über die neue Adresse, die ich Leon gegeben habe, telefonische Absprachen nur über Festnetz. Ich werde jetzt Strafanzeige erstatten, weil mein E-Mail-Konto gehackt wurde. Leon hat Ihnen ja bestimmt davon erzählt.“
„Sie meinen, Schiemann steckt dahinter? Oder Lupus?“, hakte Schmidt nach.
„Ich denke jetzt eher an Herrn Schiemann, nachdem Lupus offensichtlich mit der Sache nichts mehr zu tun haben will“, erwiderte Jonas. „Er wäre schließlich der Profiteur gewesen, wenn durch das untergeschobene Bild plötzlich doch eine Zeichnung von Brown auf meinem Buch gewesen wäre. Ich hätte bei einer Berufung ziemlich alt ausgesehen, wenn der Coup gelungen wäre.“
Am selben Abend fuhr Jonas zunächst zum Polizeirevier 38 in der Scharbeutzer Straße, um die Manipulation seines E-Mail-Kontos anzuzeigen.
„Das ist schon ein paar Tage her. Weshalb kommen Sie erst jetzt?“, fragte der aufnehmende Polizeibeamte.
„Weil mir erst heute richtig klargeworden ist, dass weder ich noch der Mitarbeiter des Felder-Verlages Halluzinationen hatten, als wir uns über eine E-Mail gewundert haben, die angeblich ich geschickt hatte. Ich habe auch einen leisen Verdacht, wer mir da ein Bein stellen wollte“, erklärte Jonas.
„Sagen Sie uns, was Sie wissen, Herr Mönke“, bat der Beamte. Jonas erzählte von dem Prozess, den er gewonnen hatte, von der durch die falsche E-Mail möglichen Manipulation von Beweisen, davon, dass auch sein Anwalt eine Mail erhalten hatte, deren Inhalt er selbst gewiss nie aufgegeben hätte, nachdem die erste Instanz gewonnen war.
„Ich habe ein bislang nicht genutztes E-Mail-Konto aktiviert und verkehre mit dem Verlag und meinem Anwalt auch nur noch per Festnetztelefon oder per Brief“, schloss er. Der Beamte nickte.
„Wir werden der Sache nachgehen und Ermittlungen aufnehmen“, fügte er hinzu.
„Da ich grad‘ einen Experten habe … Wo müsste ich graben, wenn ich einen alten Kriminalfall recherchieren wollte?“, fragte Jonas.
„Alter Kriminalfall?“, wunderte sich der Beamte.
„Zum Beispiel aus dem Krieg.“
„Um was würde es da gehen?“
„Um das Verschwinden einer bronzenen Glocke aus dem Hamburg-Museum, die in Einzelteilen mit gemischtem Schutt von zerbombten Häusern als Flicken für einen Deich missbraucht wurde“, erklärte Jonas.
„Am ehesten im Staatsarchiv, denke ich“, erwiderte der Beamte.
„Vielen Dank. Tschüß.“
Als er vor der Tür stand, seufzte Jonas Mönke tief. Er konnte das nicht alles selbst machen. Sein Beruf setzte ihm in diesem Fall sehr enge Grenzen. Dass diese Entwicklung ausgerechnet in der arbeitsreichsten Zeit des Jahres passieren musste, war ein wenig glücklicher Zufall.
‚Zufall?‘, durchzuckte es ihn. ‚Nein, das ist der Fluch der Glocke! Und obendrein Freitag, der 13.!‘
Er fuhr weiter zu seiner Wohnung, doch als er kurz vor der Einfahrt zu seiner Tiefgarage war, unterließ er es, links zu blinken und abzubiegen. Stattdessen fuhr er weiter auf den Berner Heerweg, bog rechts ab und fuhr zu seinen Eltern zum Schierenberg.
„Du bist völlig platt“, resümierte Bernd Mönke, als Jonas ihm und seiner Mutter von der neuen Entwicklung berichtet hatte. „Die Idee, Opas E-Mail-Konto zu benutzen, war gut. Auf den Dreh kommen diese Banditen nie. Mach‘ du deine normale Arbeit …“
Jonas wollte aufbegehren, aber sein Vater unterbrach ihn mit einer unwirschen Handbewegung.
„Nein, hör mir zu!“, entgegnete er. „Du wirst über diese Glocke nirgends etwas finden, weder im Staatsarchiv noch im Museum und erst recht nicht in alten amtlichen Ermittlungsakten. Ich habe heute mit Graumann telefoniert. Er hatte gegenüber Mutti Andeutungen gemacht, dass sein Urgroßonkel ein Nazibonze war, der mit der Glocke zu tun hatte. Das wollte ich genauer hinterfragen. Ergebnis: Wilhelm Graumann, Falko Graumanns Urgroßonkel, war ein Vertrauter von Gauleiter Karl Kaufmann. Als Hamburg von den Alliierten plattgemacht worden war – du weißt: Operation Gomorrha – war es Graumann, der Kaufmann den Floh ins Ohr setzte, dass die Glocke im Museum verflucht sei und sich der Fluch der Glocke mit der Auslöschung weiter Teile Hamburgs durch die Alliierten realisiert habe. Mit Einverständnis oder sogar im direkten Auftrag von Kaufmann wurde die Glocke aus dem Museum entfernt, alle Unterlagen darüber vernichtet und die Glocke zerstört. Dass sie als Beimischung zu Schutt verwendet wurde, um damit den Deich in Rissen zu stopfen, ist dann nur logische Folge. Und wenn das ein Blindgänger war, ist es nur noch passender. Wer das unvorsichtig anrührt, findet sich in den Ewigen Jagdgründen wieder. Der Professor und seine Studiosi haben irres Glück gehabt, dass ihnen die Glocke nicht um die Ohren geflogen ist.“
„Wär‘ das nicht ’ne Wahnsinnsstory für dich, Paps?“, fragte Jonas mit müdem Grinsen. Sein Vater grinste zurück.
„Ich hab‘ auch mit der Redaktion telefoniert. Ja, es ist ’ne Wahnsinnsstory. Die scharren schon mit den Hufen. Ich habe Graumann gebeten, mir seine Angaben schriftlich zu geben, damit ich eine Quelle nachweisen kann.“
„Und ich hab‘ vorhin noch gedacht, der Fluch der Glocke hätte sich mal wieder bemerkbar gemacht“, schmunzelte Jonas.
„Kommt drauf an, für wen. So, wie es im Moment aussieht, scheint der Fluch sich eher gegen jene zu richten, die sich dieser Glocke unrechtmäßig bedienen wollten“, erwiderte seine Mutter.
Obwohl er völlig fertig mit der Welt war, fuhr Jonas auch nach Hause, wo er kurz vor acht Uhr abends ankam. Er stellte sein Auto in der Tiefgarage ab und ging zum Briefkasten. Außer zwei als Reklamesendungen erkennbaren Briefen – Adressat: An die Bewohner des Hauses Ebeersreye 110 – war ein Luftpostbrief im Kasten. Absender: Agamemnon-Productions Los Angeles!
Jonas fiel vor Schreck der Autoschlüssel aus der Hand und landete scheppernd auf den Steinfliesen des Hausflurbodens. Den Wohnungsschlüssel konnte er nicht fallen lassen, weil der noch im Schloss des Briefkastens steckte …
‚Freitag, der 13. plus Glockenfluch!‘, durchzuckte es ihn. Mit zitternden Händen hob er den Schlüssel wieder auf, steckte ihn ein, die Briefe in die Seitentasche seines Bürorucksacks, schloss den Briefkasten wieder ab und ging mit wackeligen Knien zum Fahrstuhl, um in den fünften Stock zu fahren, wo seine Wohnung war.
Er schloss auf, schmiss den Rucksack um die Ecke des Wohnzimmers auf das dortige Sofa, zog sich eilig aus und öffnete den Brief. Er staunte nicht schlecht, dass der Brief auf Deutsch geschrieben war …
Los Angeles, 6. Dezember 2013
Sehr geehrter Herr Mönke,
Sie hatten im Mai dieses Jahres im Rahmen eines Interviews Mr Jonathan Blanchard Ihren Roman „Die Glocke des Todes“ überreicht. Mr Blanchard hat sich den Text übersetzen lassen und war mit Ihrer deutschen Ausgabe bei mir und hat mir Ihr Buch freundlicherweise überlassen. Von ihm habe ich auch Ihre Adresse. Ich hätte Sie per E-Mail angeschrieben, aber Ihre Mailadresse hatte Jonathan leider nicht.
Der Inhalt Ihres Buches ist mir insoweit bekannt, als ich als Junge auf Usedom die Sage gehört habe und mein Vater ein Freund des Archäologen Boris Trojan war, der im Auftrag der Nazis Mitte der Dreißigerjahre die Geschichte der Vineter erforschen sollte. Die Glocke, die Sie auf Ihrem Einband verwenden, kenne ich von einem Foto, das Trojan meinem Vater gegeben hatte. Mein Vater nahm ein Manuskript von Boris Trojan in Verwahrung, als dieser wegen unerwünschter Forschungsergebnisse ins KZ kam, wo er auch ums Leben kam. Das Manuskript hat mein Vater der Bibliothek meiner Heimatstadt Aurich gestiftet, weil er den rechtmäßigen Erben nicht ausfindig machen konnte. Der Inhalt dessen, was Trojan erforscht hat, ist als Geschichtsdokumentation gemeinfrei, aber Ihr Buch und die von Ihnen als Träger der Handlung erfundenen fiktiven Figuren sind es nicht.
Nachdem ich vor zehn Jahren die Glocke, die Trojan fotografiert hatte, für meinen Film Mykene verwendet hatte, hatte ich immer die Idee, die tatsächliche Geschichte dieser Glocke zu verfilmen. Ihr Roman bietet mir die Grundlage dazu, weil die von Ihnen ergänzten fiktiven Figuren eine spannende Handlung tragen. Deshalb wäre ich an den Rechten für die Verfilmung interessiert.
Ich werde zur Berlinale vom 6. – 16. Februar 2014 in Deutschland sein und werde im Hotel Adlon wohnen. Es wäre schön, wenn Sie es möglich machen könnten, zu dieser Zeit nach Berlin zu kommen. Ich füge Ihnen eine Gastakkreditierung bei, die es Ihnen möglich macht, in Bereiche zu gelangen, die dem üblichen Berlinale-Publikum nicht zugänglich sind. Sollten Sie ein weniger öffentlichkeitswirksames Treffen wünschen, wird Ihnen diese Gastakkreditierung auch Zugang zum Hotel Adlon gewähren.
Es wäre mir eine Freude, wenn wir uns treffen könnten.
Mit freundlichem Gruß
Peter Wolfson
Im Briefkopf fand Jonas eine Telefonnummer und sah auf die Uhr. Es war jetzt kurz vor halb neun am Abend. Er warf den PC an, um nach der Zeit von Los Angeles zu schauen. In Los Angeles war es jetzt 11:30 Uhr. Kurz entschlossen griff er zum Telefon und wählte die Nummer in Los Angeles.
„Good day. My name is Jonas Mönke. I’m calling from Hamburg in Germany. I want to speak to Mr. Peter Wolfson“, meldete er sich.
„What is the reason for your call, Sir?“, fragte die Telefonistin.
„I’ve got a letter from Mr. Wolfson, who wants to meet me in Berlin. Would you please so kind and connect me?“, bat Jonas.
„Just a moment, please.“
„Wolfson!“
„Guten Tag, Herr Wolfson. Mein Name ist Mönke, Jonas Mönke. Ich halte gerade Ihr Schreiben vom 6. Dezember in der Hand.“
Es dauerte einen Moment, bis Jonas wieder etwas hörte.
„Toll, dass Sie gleich anrufen. Danke, Herr Mönke. Ja … sind Sie bereit, über die Rechte zu verhandeln?“, fragte Wolfson.
„Ich frage mich gerade, wie sich Ihr Angebot mit dem Urheberrechtsprozess wegen des Titelbildes zu meinem Buch verträgt, den Ihre deutsche Vertretung gegen mich geführt hat“, erwiderte Jonas.
„Wie bitte? Prozess? Ja, wieso sollte unsere Vertretung das denn tun?“
„Das, Herr Wolfson, habe ich mich seit Februar auch gefragt, nachdem ich deswegen eine Abmahnung bekommen habe. Ihr hiesiger Vertreter, Herr Hauke Schiemann, hat mich im März 2013 wegen Nutzung des Titelbildes verklagt – eines Titelbildes, das Ihr Produktionsdesigner Marcus Brown von einem verloren gegangenen Exemplar des Fotos meines Urgroßvaters Trojan abgezeichnet hat.“
„Um Himmels Willen! Herr Mönke, glauben Sie mir bitte, dass ich das weder veranlasst habe noch gebilligt hätte, wäre mir das bekannt gewesen“, wehrte Wolfson erschrocken ab.
„Herr Schiemann hat sich mit Hinweis darauf, dass er erst Ihre Zustimmung hätte einholen müssen, auch strikt geweigert, die Klage zurückzunehmen, als die Beweise sich gegen ihn und Mr. Brown drehten. Deshalb bin ich natürlich davon ausgegangen, dass Sie ihn entsprechend angewiesen haben. Es beruhigt mich sehr, dass das nicht der Fall ist.“
„Äh … darf ich fragen, wie weit dieser Prozess ist?“
„Sie dürfen. Das Landgericht Hamburg hat die Klage Ihrer Vertretung abgewiesen. Die Berufungsfrist läuft. Mein Anwalt hat mir mitgeteilt, dass Herr Schiemann gegen den Rat des von ihm beauftragten Anwaltes unbedingt die Berufung wollte, der sie aber für aussichtlos hält und deshalb das Mandat niedergelegt hat.“
„Würden Sie … würden Sie dennoch über die Filmrechte verhandeln wollen?“, fragte Wolfson.
„Grundsätzlich ja. Ich wäre nur gern dieses Damoklesschwert los. Solange die Berufung möglich ist, traue ich mich nämlich nicht, meine Tantiemen für das Buch auch nur zu verplanen.“
„Ich werde dem Problem abhelfen, das verspreche ich Ihnen. Sie täten mir einen großen Gefallen, wenn Sie mir die Klage in Kopie zukommen lassen würden“, bat der Regisseur.
„Im Augenblick möchte ich das nicht über meine private E-Mail-Adresse machen. Sie bekommen morgen eine E-Mail mit Absender Jonas Mönke@Sperling-Assekuranz.de Das ist kein Spam, das ist die Kopie von der Klage. Soll ich das an die E-Mail schicken, die in Ihrem Briefkopf ist?“
„Nicht ganz. Verwenden Sie bitte pewo@agamemnon-movies.com. Das kommt bei mir direkt an. Wie kann ich Sie erreichen?“
„Über die Absendeadresse. Das landet auch bei mir direkt, nur im Büro. Hier ist es jetzt kurz vor neun am Abend. Ich schicke ihnen das gleich morgen früh.“
„Sind Sie morgen um diese Zeit erreichbar?“
„Ja.“
Kapitel 17
Klarstellungen
In dieser Nacht schlief Jonas vor Aufregung kaum. Als der Wecker am folgenden Morgen losging, um ihn zum letzten Überstundensamstag zu rufen, war er nicht sicher, ob es nicht ein Traum gewesen war. Doch er fand den Brief auf dem Wohnzimmertisch wieder. Nein, er hatte nicht geträumt. Der Brief war tatsächlich von Peter Wolfson.
Wegen seines schlechten Schlafs in dieser Nacht zog er es vor, mit Bus und Bahn zur Arbeit zu fahren. Die Klage hatte er noch am Abend gescannt und per Mail ins Büro geschickt. Nachdem er dort angekommen war und den Computer hochgefahren hatte, rief er umgehend das E-Mail-Programm auf und schickte die angekündigte E-Mail an Wolfson.
Er war an diesem Tag überhaupt nicht bei der Sache, erledigte die Arbeiten zum einen nur im Schneckentempo, zum anderen machte er Fehler. Gegen Mittag rief sein Chef ihn in sein Büro.
„Sag‘ mal, was ist das für ein Mist, den du da heute zusammenarbeitest?“, fragte Gunnar Mahnke, nachdem er zum sechsten Mal eine Zweitunterschrift wegen Fehlern in der Überweisung oder dem dazugehörigen Schreiben verweigert hatte.
„Ich weiß nicht. Ich hab‘ heute Nacht kaum geschlafen, Chef“, erwiderte Jonas bedrückt. Sein Chef nickte und rief sich die Statistik und das Zeitkonto seines Mitarbeiters auf.
„Du Wahnsinniger! Seit Montag jeden Tag über zehn Stunden! Hast du sie nicht alle?“
„Ich muss doch mit dem Kram fertig werden, Gunnar“, wehrte sich der junge Mann. Gunnar nickte und sah sich die Aktennummern durch. Die alten Akten, die geprüft werden sollten, waren schon am Montag fertig gewesen, alle anderen waren aktuelle Akten, deren letzte Posteingänge nicht älter als zwei Wochen waren. Für die Zeit der Reservearbeiten war das ein guter Bearbeitungsstand.
„Deine Reserve ist erledigt. Du hast mehr Plusstunden als Überstunden bezahlt werden. Wenn ich dich jetzt weiterarbeiten lasse, machst du nur noch mehr Müll als bis jetzt schon. Schluss für heute!“
„Chef, ich werde den Zeitausgleich im Februar brauchen …“
„Jonas Mönke, wenn ich dich jetzt weiterwursteln lasse, kannst du den ganzen Scheiß nochmal beackern. Es reicht, wenn du deine Fehler von heute ausbügeln musst. Nein, du fährst nach Hause – sofort!“, versetzte sein Chef. „Heute ist der Vierzehnte, du bist mit den Sonderarbeiten fertig. Es ist kurz vor zwölf. Ab mit dir!“
„Aye, Sir!“, grinste Jonas schwach und deutete einen militärischen Gruß an. Er kehrte in sein Büro zurück, schloss die gerade offene Akte, ohne den begonnenen Brief fertig zu schreiben, meldete sich ab, packte seine Sachen, zog sich an, buchte sich am Terminal aus und verließ das Bürogebäude.
Als er auf der Straße stand, wurde ihm klar, dass er sich irgendwie noch eine Stunde um die Ohren schlagen musste, bevor er sich mit Professor Bluhm am Museum traf. Das würde reichen, um noch etwas zu essen. Er ging zur U-Bahn Sengelmannstraße und nahm die nächste U-Bahn der Linie U 1 Richtung Hauptbahnhof und stieg an der Station Kellinghusenstraße in die Linie U 3 um, die er an der Station Feldstraße verließ. Von dort waren es nur wenige Minuten Fußweg bis zum Restaurant September, in dem er am Tag der Urteilsverkündung mit dem Professor, dem Zeugen Thamsen und seinem Rechtsanwalt etwas gegessen hatte.
Wie am 19. November bestellte er sich einen Burger und ein Getränk, aß in aller Ruhe. Danach schlenderte er an den Gerichtsgebäuden vorbei in die Wallanlagen und nahm den Fußweg durch diese Grünanlage zum Museum. Er erreichte das Museum kurz vor halb zwei. Vor der Tür stand bereits Professor Roland Bluhm, der ihm winkte.
„Tag, Herr Mönke!“, grüßte Bluhm.
„Guten Tag, Herr Professor. Ich hätte Sie beinahe angerufen und Ihnen gesagt, dass hier mit größter Wahrscheinlichkeit nichts mehr bezüglich der Glocke zu finden sein wird, aber mit einem Archäologieprofessor das Museum zur Hamburger Stadtgeschichte zu besuchen, ist ein Erlebnis, das ich mir als historisch interessierter Mensch nicht entgehen lassen will“, erklärte Jonas grinsend.
„Was meinen Sie?“, fragte Bluhm.
„Mein Vater hat mit dem Verwalter unseres Ferienhauses auf Usedom gesprochen, einem Falko Graumann. Sein Urgroßonkel Wilhelm Graumann …“
Bluhms Nicken ließ Jonas stocken.
„Was wissen Sie über ihn?“, fragte er.
„Wilhelm Graumann! Ich hätte es wissen müssen!“, grinste Bluhm.
„Jetzt steh‘ ich gerade auf dem Schlauch …“, erwiderte Jonas.
„Wilhelm Graumann war ein Nazibonze, der dem Hamburger Gauleiter Karl Kaufmann nahe stand – und er galt als extrem abergläubisch. Ich vermute, Graumann hat Kaufmann den Floh ins Ohr gesetzt, dass die Glocke aus Vineta an der Beinahe-Auslöschung Hamburgs Schuld war und hat erreicht, dass sie aus dem Museum entfernt wurde. Dabei hat er es aber nicht belassen, sondern hat die Glocke zerschneiden lassen und dieses Tausend-Teile-Puzzle der Glocke in den Schutt gemischt oder mischen lassen, mit dem der Bombentreffer im Deich geflickt wurde. Graumann wird auch mitbekommen haben, dass es wahrscheinlich ein Blindgänger war. Anderenfalls wäre der Schaden im Deich erheblich größer gewesen. Das kam ihm entgegen, denn für den Fall, dass dort jemand unvorsichtig gräbt, würden ihm die Teile um die Ohren fliegen, während ihm am Himmelstor gerade die Engelsflügel angepasst werden. Stimmt’s?“, erklärte Bluhm. Jonas nickte mit offenem Mund.
„Exakt das hat mir mein Vater erzählt“, sagte er schließlich, als er seine Verwunderung im Griff hatte.
„Einerseits wäre anzunehmen, dass Graumann dafür gesorgt hat, dass jede Meldung, jede Akte und jede Notiz über diese Glocke ebenso vernichtet wurde wie die Glocke selbst“, ergänzte der Professor. „Andererseits muss es dazu eine Anweisung gegeben haben – und die könnte hier im Museum oder im Staatsarchiv vorhanden sein. Kommen Sie, wir gehen dem nach.“
Sie gingen ins Museum, Roland fragte nach dem Kurator, der am Samstag jedoch nicht im Hause war. Dafür fand sich ein anderer Mitarbeiter, der Auskunft geben konnte. Akten des Museums aus der Nazi-Zeit waren nicht mehr im Hause, sondern im Staatsarchiv Hamburg.
„Wenn Sie dort in diesem speziellen Fall suchen, suchen Sie nicht nach Museumsakten, sondern in den Beständen, die von der Partei geblieben sind“, ergänzte der Mann, nachdem er wusste, worum es ging. „Das wird nur nicht viel sein, fürchte ich. Kaufmann hat die Stadt zwar kampflos übergeben, aber vorher haben die ihre Akten weitgehend vernichtet. Wenn es eine Anweisung an das Museum gegeben hat, einen bestimmten Ausstellungsgegenstand zu entfernen, wenn der auch noch geschreddert wurde, dann hat der Bonze, der das veranlasst hat, auch dafür gesorgt, dass diese Akte ganz bestimmt vernichtet wird.“
„Genau das, was mein Vater nach dem Gespräch mit Graumann auch gesagt hat“, seufzte Jonas.
„Gut. Danke für die Auskunft“, sagte der Professor. „Ich werde im Staatsarchiv dennoch mal suchen.“
„Hm, was versprechen Sie sich davon, wenn die Akte wahrscheinlich vernichtet sein dürfte?“, fragte Jonas im Hinausgehen.
„Ihr Urgroßvater hat die Geschichte dieser Glocke bis zum Museum verfolgen können. Wir haben die Glocke gefunden, haben sie wieder zusammenbasteln können“, sagte Roland. „Aber wie es zur Zerstörung gekommen ist, ist im Augenblick reine Mutmaßung, eine Hypothese. Solange noch eine Chance besteht, diese Informationslücke zu schließen, würde ich das versuchen. Wenn im Staatsarchiv tatsächlich nichts ist, kann diese Hypothese in die Forschungsarbeit als solche auch einfließen. Würden Sie mir erlauben, diese Forschung fortzusetzen und mit dem Manuskript Ihres Urgroßvaters als komplette Forschungsarbeit zu veröffentlichen? Sie bekommen natürlich Ihren Anteil an den Tantiemen.“
Jonas lächelte.
„Meine Mutter ist die Erbin meines Urgroßvaters, Herr Professor. Sie ist die Anspruchsinhaberin. Ich nehme zwar an, dass sie zustimmen wird, aber ich kann ihnen diese Zusage nicht machen. Sie sollten mit meiner Mutter sprechen, ob sie dazu bereit ist. Ein Prozess um Urheberrechte genügt mir“, sagte er.
„Volles Verständnis. Ist das Urteil eigentlich inzwischen rechtskräftig?“
„Nein, aber es gibt da eine neue Entwicklung, die mich hoffen lässt, dass es nicht zur Berufung kommt.“
„Und wie sieht die Entwicklung aus?“
„Ich habe einen Brief von Peter Wolfson bekommen. Er ist an den Rechten für die Verfilmung meines Buches interessiert und ist aus allen Wolken gefallen, als ich ihm gesagt habe, was seine Deutschland-Vertretung hier angestellt hat. Er hat mir zugesagt, diese Klage aus der Welt zu schaffen“, erklärte Jonas mit breitem Grinsen. Roland schlug ihm auf die Schulter.
„Wow! Herzlichen Glückwunsch!“, gratulierte er. „Was wird das einbringen?“
„Darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber er wollte mich heute Abend nochmals anrufen.“
„Dann drücke ich die Daumen für erfolgreiche Verhandlungen.“
Zur selben Zeit, als sich Jonas und Roland vor dem Museum trennten, meldete sich Hauke Schiemanns Smartphone. Er nahm es zur Hand, sah den Namen Peter Wolfson und nahm den Anruf an.
„Hallo, Chef! Womit habe ich die Ehre verdient, am frühen Samstagnachmittag angerufen zu werden?“, meldete er sich.
„Mit einer Klage, von der ich nur auf Umwegen erfahre!“, grollte Wolfson. „Ich bemühe mich selbst um die Rechte an der Verfilmung der Geschichte der Glocke von Vineta, weil Sie angeblich nicht in der Lage waren, die Adresse des Autors zu ermitteln und höre von dem Mönke, dass Sie ihn wegen angeblicher Urheberrechtsverletzung wegen des Bildes verklagt haben. Wann wollten Sie mir davon eigentlich was erzählen?“
Schiemann schluckte heftig.
„Klage? Was für eine Klage?“, tat er unwissend.
„Die, die ich als gemailte Kopie gerade auf dem Bildschirm meines PCs habe! Unterschrieben von Rechtsanwalt Simeon Lupus im Auftrag der Agamemnon-Filmgesellschaft Deutschland und einer von Ihnen unterschriebenen Vollmacht, werter Herr Schiemann! Und mit einem schönen Eingangsstempel des Landgerichts Hamburg!“, knurrte Wolfson. „Sie haben mich schlicht belogen, als Sie mir mitteilten, dass Sie die Adresse des Autors nicht von seinem Verlag bekommen konnten. Ich weiß nicht, wie Sie auf die Idee gekommen sind, den Brown dazu auch noch als Zeugen anzugeben! Ich selber habe ihn nach Aurich geschickt, damit er sich von dort ein Muster holen konnte, weil er mir frank und frei erklärt hat, dass er keine Ahnung hat, wie eine griechische Glocke der Bronzezeit aussehen könnte und eine Reise nach Griechenland daran scheiterte, dass er die griechische Schrift nicht lesen konnte und die Zeit auch langsam knapp wurde. Und Sie benennen ihn via Lupus als Zeugen dafür, dass er das alles ganz allein erfunden hat!“
„Da… das muss gefälscht sein!“, behauptete Schiemann kreidebleich.
„Ach, nein! Das muss aber ein Insider sondergleichen sein, wenn er sogar Ihre Unterschrift fälschen kann!“, versetzte Wolfson bissig. „Ich habe am Montag eine cc-Kopie einer E-Mail von Ihnen an das Gericht, dass auf eine Berufung definitiv verzichtet wird und dass Sie die Prozesskosten aus eigener Tasche bezahlen. Ferner erwarte ich, dass Sie noch heute eine offizielle Firmen-E-Mail an das Anwaltsbüro Schmidt senden, dass auf eine Berufung verzichtet wird. Auch davon will ich eine Kopie cc haben. Und eine an Mönke gleichen Inhalts – samt einer Bitte um Entschuldigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten, ebenfalls cc an mich. Anderenfalls werde ich alle in Deutschland nötigen arbeitsrechtlichen Schritte gegen Sie einleiten, um Sie für den Verlust haftbar zu machen und Sie vor die Tür zu setzen. Ich komme im Laufe der kommenden Woche nach Hamburg, um mit Herrn Mönke über die Rechte zu verhandeln. Ich wollte das eigentlich bei der Berlinale machen, aber Ihre Aktion macht es nötig, dass ich mich darum früher kümmere – auch, um zu verhindern, dass da erneut etwas schiefläuft.“
„Wann … wann werden Sie hier sein?“, stotterte Schiemann.
„Das werde ich Ihnen jetzt nicht sagen. Rechnen Sie täglich mit mir. Wir sehen uns!“
Damit beendete Wolfson das Gespräch. Schiemann sah verstört auf sein Telefon. Er hatte gründlich verspielt. Wolfson hätte auf keinen Fall von der Klage erfahren sollen. Dessen Idee, mit Jonas Mönke um die Rechte an der Verfilmung zu verhandeln, hatte Schiemann erst auf die Idee gebracht, bei dem scheinbar unerfahrenen Autoren Rahm abzuschöpfen. Er saß eine ziemlich lange Zeit wie erstarrt da und wusste nicht, was er nun tun sollte.
Jonas saß im Schnellbus, der ihn nach Hause bringen sollte, als sein Telefon klingelte.
„Mönke, guten Tag“, meldete er sich, als er eine ihm nicht bekannte Nummer im Display sah.
„Hallo, Herr Mönke, Wolfson hier.“
„Oh, hallo! Ich hatte erst heute Abend mit Ihrem Anruf gerechnet. Nett, dass Sie sich jetzt schon melden“, erwiderte Jonas.
„Ich habe eben Herrn Schiemann auf den Topf gesetzt. Sie werden heute noch eine E-Mail von ihm erhalten, dass eine Berufung nicht erfolgen wird und er Sie um Entschuldigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten bittet. Er wird auch an Ihren Anwalt eine Mail mit ähnlichem Inhalt schicken und am Montag dem Gericht mitteilen, dass eine Berufung nicht erfolgen wird. Sie können Ihre Tantiemen verplanen“, sagte Wolfson „Wann hätten Sie in der kommenden Woche Zeit?“
„Na ja, ich arbeite tagsüber bei einer Versicherung. Aber meine Überstunden, die ich für Jahresabschlussarbeiten zu machen hatte, sind durch. Ich kann nächste Woche um halb drei Feierabend machen“, erwiderte Jonas.
„Wo arbeiten Sie in Hamburg? Ich habe dort lange gelebt und kenne mich immer noch ganz gut aus.“
„Kennen Sie die City Nord? Ich arbeite am Kapstadtring.“
„Ja, kenne ich. Gibt es das Hotel am Mexikoring noch? Ich kenne es noch als Esso-Motel“, fragte Wolfson.
„Ich meine, da wäre eins. Ich sehe mal nach, wenn ich zu Hause bin. Im Moment sitze ich nämlich gerade im Bus und habe ein schnödes Mobiltelefon, kein Smartphone.“
„Nee, ich hab’s schon. Bietet sich schon wegen der Nähe zum Flughafen an. Ich melde mich, wenn ich dort bin.“
„Sehr gut. Dann bis nächste Woche“, verabschiedete sich Jonas.
Jonas beschloss, über das Angebot erst einmal zu schweigen. Vielleicht konnte er seinen Eltern mit der Nachricht ein besonderes Weihnachtsgeschenk machen. Tatsächlich fand er auf seiner gehackten E-Mail-Adresse die von Wolfson angekündigte Nachricht vor. Sie konnte nur von Schiemann sein, denn alle anderen, die ihm Mails schickten, benutzten die Ausweichadresse. Es war auch ein Indiz dafür, dass Schiemann tatsächlich für das hacken der Mailadresse verantwortlich war. Dass er das Grinsen kaum aus dem Gesicht bekam, konnte er gegenüber seinen Eltern, bei denen er am Wochenende zum Mittagessen war, zwar nicht verbergen, dies aber mit der Mail von Schiemann begründen. Dass der erst einen heftigen Tritt von seinem Chef hatte bekommen müssen, musste er ja nicht unbedingt sofort erzählen.
Montagmittag klingelte sein Mobiltelefon, als er sich gerade am Terminal zum Mittagessen ausbuchte. Es war tatsächlich Peter Wolfson, der ihn nach Feierabend in das Hotel am Mexikoring einlud.
Mit erneut bis zum Hals hämmerndem Herzen ging Jonas vom Kapstadtring Nummer 10 zu Fuß zum Hotel am Mexikoring, in dem er in Kindertagen nach einem besonders guten Zeugnis mit seinen Eltern und Großeltern hatte essen dürfen. An der Rezeption fragte er nach Peter Wolfson.
„Mein Herr, Diskretion ist in unserem Hause Gesetz! Ob und eventuell wo Gäste bei uns logieren, geben wir nicht bekannt“, entgegnete der Empfangschef indigniert gegenüber dem leger gekleideten jungen Mann.
„Herr Wolfson hat mich heute Mittag im Büro angerufen und um ein Treffen hier im Hause gebeten. Seien Sie bitte so freundlich, ihm mitzuteilen, dass Jonas Mönke in der Lobby ist“, versetzte Jonas, der sich beherrschen musste, höflich zu bleiben. Der Portier holte Luft, als sich die Lifttür in der Lobby öffnete und Peter Wolfson den Lift verließ.
„Herr Wolfson?“, rief Jonas, bevor der Portier ihn hindern konnte. Wolfson drehte sich um.
„Herr Mönke?“, fragte er.
„Ja“
Wolfson ging auf ihn zu, streckte ihm die rechte Hand entgegen, die Jonas nur zu gerne ergriff und den Händedruck des berühmten Regisseurs erwiderte.
„Schön, dass Sie gekommen sind. Danke, Herr Mönke. Herr Wehmeyer?“
Der Portier stand prompt stramm.
„Herr Wolfson, was kann ich für Sie tun?“, erkundigte er sich diensteifrig.
„Sie können dafür sorgen, dass Herr Mönke und ich einen Raum bekommen, in dem wir vertraulich sprechen können. Und bitte ein paar Tapas. Trinken Sie Wein?“
„Grundsätzlich ja, aber ich muss heute noch fahren“, erwiderte Jonas. „Ein alkoholfreies Weißbier, bitte“
„Sehr gerne. Und Sie, Herr Wolfson?“
„Ach, das nehme ich auch, danke.“
Wenn Sie mir bitte folgen wollen?“
Der Portier lotste sie in einen Raum, der zwar zum Jahnring Fenster hatte, aber hinter einer Hecke lag, so dass er von der Straße her nicht einsehbar war – abgesehen von dem Umstand, dass die Straße über fünfzig Meter vom Hotel entfernt war.
„Bitte, die Herren. Die Bestellung kommt umgehend. Benötigen Sie sonst noch etwas?“
„Fällt mir im Moment nicht ein. Gegebenenfalls gebe ich Bescheid“, sagte Wolfson. Der Portier schloss die Tür und ließ die Verhandlungspartner allein.
Kapitel 18
Verhandlungen
„Setzen Sie sich doch, Herr Mönke“, bot Wolfson an. Jonas nickte und nahm an dem Tisch Platz, der am Fenster war. Wolfson setzte sich ihm gegenüber.
„Ich gebe zu, ich hatte Sie mir älter vorgestellt“, begann der Regisseur. „Wie alt sind Sie, Herr Mönke?“
„Vierundzwanzig, Herr Wolfson.“
„Ich bin beeindruckt. Es gibt nicht so viele junge Leute in Ihrem Alter, die solche Bücher schreiben. Wie sind Sie darauf gekommen?“, erkundigte sich der Ältere.
„Mein Großvater hatte mir schon von dieser Glocke erzählt, da konnte ich knapp über den Tisch sehen. Er war ein großartiger Erzähler, der einen ganzen Kindergarten als Märchenonkel fesseln konnte. Er hat immer frei gesprochen. Das war sehr nützlich, als er 1998 plötzlich erblindete. Die Geschichten hatte er im Kopf und konnte sie sogar noch packender erzählen, als er nicht mehr sehen konnte. Diese Geschichte von der Glocke von Vineta, die von sehr viel weiter herkam, hat mich so mitgerissen, dass ich sie schließlich aufgeschrieben habe. Das habe ich meinem Großvater vorgelesen, und er hat mir Ratschläge für bessere Formulierungen gegeben“, erklärte der Jüngere.
„War? Ihr Großvater lebt nicht mehr?“, hakte Wolfson nach.
„Nein. Er war als Zeuge für den Prozess benannt, starb aber zwei Tage vor dem ersten Termin. Er war dreiundneunzig, ein wahrhaft gesegnetes Alter“, erwiderte Jonas mit einem melancholischen Lächeln. Wolfson schluckte.
„Meinen Sie, der Prozess …“
„Ich denke nicht“, sagte Jonas und schüttelte den Kopf. „Mein Vater hat mir zwar genau das vorgehalten, meinte, es wäre für den alten Herrn zu viel. Aber mein Großvater war ein mehr als nur zäher Mann, den so etwas wohl nicht umgehauen hätte. Nein, er wollte für mich kämpfen. Inzwischen bin ich ziemlich sicher, dass er mit seiner Aussage die Richter gleich im ersten Termin davon hätte überzeugen können, dass ich nicht von Mr. Brown abgezeichnet hatte.“
„Ich bitte im Namen meines Unternehmens um Entschuldigung für diese Unannehmlichkeit. Es geschah ohne mein Wissen. Ich selbst habe Marcus Brown nach Aurich geschickt, weil ich von dem Manuskript dort wusste“, sagte Wolfson. „Ich habe ihm auch den Tipp gegeben, sich in Koserow umzusehen, ob er dort vielleicht noch Verwandte findet, die möglicherweise Zugang zu den Bildern haben, von denen ich wusste, dass es sie gab. Boris Trojan hatte meinem Vater einige Bilder gegeben, an die ich mich auch erinnerte, aber die müssen irgendwie weggekommen sein. Ich habe nicht nur mein Haus in Hollywood danach auf den Kopf gestellt, ich habe auch in meinem Haus hier in Hamburg gesucht, aber die waren einfach weg. Ich hätte sie Ihnen gerne übergeben.“
„Wir haben inzwischen alles gefunden – auch die Bilder, die mein Urgroßvater Boris Trojan mit allen Notizen zu seiner Forschung am Strand von Koserow vergraben hatte. Unter seiner Strandhütte hat niemand etwas vermutet“, erwiderte Jonas. „Wenn Sie sagen, Ihr Vater hatte Bilder von der Glocke, dann sind das wahrscheinlich die, von denen Abzüge fehlen. Meine Eltern und ich hatten so etwas schon vermutet.“
„Boris Trojan war Ihr Urgroßvater?“, keuchte der Regisseur.
„Ja. Hatte ich das noch nicht erwähnt?“
„Vielleicht ist es mir zunächst entgangen. In dem Fall habe ich doppelt um Entschuldigung zu bitten.“
„Wieso?“
„Dass Sie keine Information bekommen haben, dass wir – meine Filmgesellschaft – uns der Glocke bedient haben, die Ihr Urgroßvater erforscht hatte.“
„Dafür müssen Sie nicht um Entschuldigung bitten. Die Stadtbibliothek Aurich hat im Auftrag Ihres Vaters nach Erben geforscht. Weil mein Großvater aber als politischer Häftling von der Bundesrepublik freigekauft worden war, für die DDR-Behörden unbekannt verzogen war und obendrein eine Tochter hatte, die bei der Heirat den Namen wechseln musste, konnte die Bibliothek nichts erreichen. Den Aufruf an Erben im Internet haben wir wirklich eher per Zufall entdeckt, weil wir ohne den Prozess danach nie gesucht hätten. Wir waren der Meinung, Uropa hätte alles irgendwo versteckt. Dass er das Manuskript weitergegeben hatte, darauf ist nicht mal sein Sohn gekommen.“
„Uff, da räumen Sie mir einen großen Stein vom Herzen! Wie lange haben Sie an dem Buch geschrieben?“
„Ziemlich“, lächelte Jonas. „Ich habe mit zwölf angefangen zu schreiben. Aber das ist so scheußlich, das kann man niemandem zumuten. Fertig war ich vor etwa drei Jahren. Da hatte ich einen Text, den Opa gutheißen hat. Damit bin ich auf Tour gegangen. Über eine Fanseite, die sich zum Thema Mykene gebildet hatte, bin ich mit Stefan Diener vom Felder-Verlag in Kontakt gekommen. Der Verlag stellt auch Bildbände zu Filmen her, unter anderem zu Mykene. Er fand das Manuskript gut und überredete seinen Chef, das Wagnis einzugehen, einem unbekannten Autor eine Chance zu geben. Diese Woche kommt die dritte Auflage in die Läden. Beinahe hätte mich das richtiges Geld gekostet, denn jemand hat mein E-Mail-Konto gehackt und dem Verlag den Entwurf von Ihrem Produktionsdesigner Marcus Brown untergejubelt – mit dessen Initialen. Das wäre für Herrn Schiemann und Anwalt Lupus ein gefundenes Fressen gewesen. Denn dann hätte ich tatsächlich ein Bild verwendet, das ich nicht selbst produziert hatte. Zum Glück hat Stefan mich angemorst und gefragt, wieso ich für die neue Auflage praktisch dasselbe Bild nochmal schicke. Der Unterschied zwischen den Bildern besteht nur in den Initialen und den auf Browns Zeichnung nur teilweise vorhandenen Keilschriftzeichen. Ich habe das Foto gefunden, an dem sich Brown orientiert hat – nein, das er detailliert abgezeichnet hat. Die Schriftzeichen sind darauf nur teilweise erkennbar. Und im Zuge des Prozesses fand ein Archäologe heraus, dass die Schriftzeichen, die ich von einer Zeichnung meines Großvaters hatte, tatsächlich eine Bedeutung haben: Geschenk des Königs von Hattuša an den König von Taruiša. Taruiša ist die hethitische Bezeichnung für Troja, wie der Archäologe sagte …“, erklärte Jonas.
„Wirklich Troja?“, hakte Wolfson nach.
„Ja, Troja.“
„Das ist natürlich genial. Einen Film, der wirklich einen historischen Hintergrund hat, wollte ich schon immer machen“, sagte Wolfson. „Ihre Geschichte wäre dafür gut geeignet. Was würden Sie davon halten, wenn das, was Sie geschrieben haben, visualisiert würde?“
„Nun ja, es gibt Leute, die behaupten, sie könnten sich das, was ich geschrieben habe, plastisch vorstellen“, erwiderte Jonas. „Das aber wirklich auf der Leinwand zu sehen … ich gebe zu, das wäre großartig. Sie werden sich vielleicht denken, dass ich gewisse Vorstellungen für die Schauspieler habe, die da mitmischen sollten …“
Wolfson schmunzelte.
„Ich nehme an, wenn nicht Jonathan Blanchard den Alaksandu spielt, wären Sie beleidigt“, mutmaßte er mit Hinweis auf den historischen König von Taruiša, dessen Name verdächtig nach Alexander klang, einem Beinamen des trojanischen Prinzen Paris. Wolfson hatte ihn unter dem Namen Alexaris in Mykene eingesetzt.
„Wie sind Sie nur darauf gekommen?“, grinste Jonas.
„Mykene erzählt die Geschichte des Trojanischen Krieges, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Troja soll von den Griechen attackiert worden sein, weil Paris Menelaos die Frau entführte. Wären Sie sehr vergrämt, wenn die Geschichte von Mykene die Vorgeschichte dazu wäre?“, erkundigte sich Wolfson.
„Sozusagen als Fortsetzung? Revanchefoul der Griechen?“, hakte Jonas nach.
„Ja, so in der Art“, bestätigte der Regisseur.
„Und was würden Sie mir dafür abziehen?“, fragte Mönke.
„Wieso abziehen?“
„Na ja, die Geschichte von Mykene ist Ihre Erfindung oder die von Ben Jaminoff, Ihrem Drehbuchautor“, erinnerte Jonas.
„Es wäre keine große Änderung“, warb Wolfson weiter. „Nur der Grund für die Anwesenheit der Griechen würde sich ändern.“
„Möglich, aber wie viel Prozent würde das bedeuten?“, beharrte Jonas.
„Nein, dafür würde ich nichts abziehen. Ich schulde Ihnen etwas. Denn ohne die Forschung Ihres Urgroßvaters wäre ich nicht auf die Idee gekommen, Mykene zu entwickeln“, erwiderte Wolfson.
„An welche Rechte haben Sie genau gedacht und was wollen Sie dafür geben?“, fragte Jonas nun direkt.
„Weltweite Rechte an der Verfilmung und Vermarktung – zum Beispiel in Form von Heimkino und Fernsehauswertung. Was ich dafür geben würde? Sie können eine Million dafür sofort bekommen oder eine Beteiligung von einem Prozent an den Einspielergebnissen.“
„Eine Million … US-Dollar oder Euro?“, hakte Jonas nach. Wolfson kämpfte einen Moment mit sich, das war auch für einen jungen und in solchen Verhandlungsdingen nur mäßig erfahrenen Mann erkennbar. Der Umstand, dass er gleich nach seiner Ausbildung zu einem Verhandlungsseminar geschickt worden war, half ihm allerdings.
„Euro“, rang der Regisseur sich eine Verbesserung seines eigentlichen Angebotes ab.
„Die Beteiligung an den Einspielergebnissen: Ist damit der Netto-Umsatz an den Kinokassen gemeint oder der Gewinn, der nach Abzug aller Kosten verbleibt? Das kann ein himmelweiter Unterschied sein“, sagte Mönke.
„Was meinen Sie?“
„In Fankreisen wird behauptet, dass von dem, was die Kinobesucher bezahlen, die Hälfte bei den Kinobetreibern bleibt, weshalb ein Film, der nicht wenigstens das Doppelte seiner Produktionskosten einspielt – und zwar in den USA, wenn es ein amerikanisch produzierter Film ist – als Flop gilt“, erwiderte Jonas. „Schließlich müssen von den Einnahmen auch noch die Produktionskosten gedeckt werden – Schauspieler, die eine feste Summe vertraglich vereinbaren oder ebenfalls prozentual beteiligt sein wollen, Ausstattung, Spezialeffekte, eventuell Reisen an Außendrehorte …“
Wolfson musste schlucken.
„Eine Million, das klingt verlockend; besonders in Euro. Dafür muss eine alte Oma lange stricken“, fuhr Jonas fort. „Andererseits … es soll Leute geben, die sich ein Monogramm in den Allerwertesten beißen könnten, wenn sie an die wesentlich höhere Summe denken, die ihnen eine prozentuale Beteiligung eingebracht hätte. Wenn Sie die Beteiligung an den reinen Einnahmen an der Kinokasse und eine entsprechende Beteiligung an den Einnahmen aus Merchandising meinen, wäre das meine Wahl.“
„Merchandising?“, hakte der Regisseur verblüfft nach. Er war es nicht gewohnt, dass ein Autor, dem er ein Angebot machte, an mehr interessiert sein konnte, als an den Einnahmen für die Rechte an der Verfilmung.
„Ja, Merchandising. Repliken von prominenten Ausstattungsutensilien – Schwerter, Helme, Schilde, Ringe, Gewänder, Schmuck, eventuell Gesellschaftsspiele“, erklärte Jonas. „Bei einigen Filmproduktionen werden die Fans damit geradezu überschüttet, andere sind unglaublich geizig mit so etwas oder bringen es nur für sehr spezielle Fangesellschaften heraus. Balduin von Caymonts Ring gehörte in Japan zum Standard-Merchandising. Ich zum Beispiel habe ihn nur bekommen, weil ich als Reporter für den Felder-Verlag ein sehr ausführliches Interview mit Jonathan Blanchard führen konnte, ich mich als wirklicher Fan beweisen konnte und er mir von Richard Taylor eine Replik beschaffen konnte. Das Glück hat bei Gott nicht jeder Fan. In Deutschland ist nur das Schwert für kurze Zeit zu haben gewesen. Inzwischen gibt es zwar auch Nachfertigungen der Gambesons und Wappenröcke, aber solche Sachen sind nur schwer zu finden. Das führt nicht jeder Mittelalter-Laden. Bei der Black-Dutchman-Reihe ist die Produktion erst kurz vor dem ersten Sequel auf die Idee gekommen, einen Roman zum Film zu veröffentlichen, Spielzeug dazu produzieren zu lassen und unter die Leute zu bringen.“
„Meinen Sie, dass daran Interesse bestehen könnte?“, hakte Wolfson nach.
„Mein Buch verkauft sich im Moment gut. Als jemand, der selbst Fan von Filmen ist und sich auch die Romane dazu kauft, wenn sie nur angeboten werden, glaube ich, dass eine Visualisierung per Film das Eine ist. Eine Veröffentlichung als DVD oder Blu-Ray und den Vertrieb der Filmmusik halte ich für eine blanke Selbstverständlichkeit, besonders wenn jemand wie Hans Zimmer, John Williams, James Horner oder Harry Gregson-Williams die Musik dazu schreiben würde. Eine Erinnerung an einen Film buchstäblich greifbar zu haben – wie diesen Ring“, er zeigte Wolfson den Caymont-Ring, den er am linken kleinen Finger trug, „ist das Andere. Ich nehme an, dass Leute, die mein Buch kaufen, auch Dinge kaufen würden, die auf der Basis der Beschreibungen als Merchandising hergestellt würden.“
Peter Wolfson lächelte sanft. Wirkliche Fans nahmen, was sie kriegen konnten. Besser als in einem Gespräch mit jemandem, der sich als Fan outete, konnte er sich den Beleg für diese These nicht liefern lassen.
„Jetzt verstehe ich auch, weshalb Jonathan mich vor ein paar Tagen angerufen hat und mir gesagt hat, wenn ich ihn nochmal in einen kurzen Rock stecken wolle, sei er auf der Stelle dabei“, sagte er. „Wie gut ist Ihr Englisch?“
„Nicht so gut, dass ich Bücher auf Englisch schreiben könnte“, räumte Jonas ein.
„Haben Sie schon mal ein Drehbuch geschrieben?“
„Ich habe zwar welche aus dem Internet, aber ich selber habe das noch nie versucht. Bislang habe ich mich nur an Romanen versucht.“
„Romanen?“, hakte Wolfson nach. „Gibt es noch mehr von Ihnen?“
„Offiziell nur Die Glocke des Todes“, erwiderte Jonas „Ich habe Mr. Blanchard das und noch eine inoffizielle Fortsetzung zu Crusade mitgegeben. Er wollte sich beides übersetzen lassen und fragte mich, ob ich noch was zu Black Dutchman hätte. Da habe ich etwas, aber das muss ich erst noch drucken und binden, bevor ich es ihm schicken kann.“
„Gut, bleiben wir erst einmal bei der Glocke von Vineta. Also ein Prozent vom Umsatz an der Kinokasse, ganz gleich, wo der Film aufgeführt wird, und ein Prozent vom Umsatz beim Merchandising. Habe ich Sie so korrekt verstanden?“, fragte Wolfson.
„Ja – und den Gerichtsstand in Deutschland, denn ich habe gar kein Interesse, eventuell vor einem amerikanischen Gericht mit zwölf Geschworenen klagen zu müssen, die nicht nach einem bestimmten Gesetz, sondern nach dem Bauchgefühl urteilen.“
„Wow! Sie wissen, was Sie wollen! Wäre Jonathan die einzige schauspielerische Bedingung?“
„Wenn Sie eine direkte Fortsetzung von Mykene drehen wollen und überlebende Charaktere aus diesem Film auch in diesem Film auftreten sollten, dann sollten der Kontinuität wegen auch deren Schauspieler diese Rollen erneut übernehmen. Aber – abgesehen von Jonathan ist das keine Bedingung. Schön wäre es dennoch, wenn es möglich zu machen wäre.“
Wolfson nickte.
„Ein paar Euro ließen sich ja einsparen, wenn ich keinen Drehbuchautor bezahlen müsste. Ich mache Ihnen den Vorschlag, dass Sie aus Ihrem Buch ein Drehbuch machen – auf Deutsch. Übersetzen kann ich es selbst. Wäre das etwas?“, schlug Wolfson vor.
„Sie … Sie möchten wirklich einen blutigen Laien ein Drehbuch verfassen lassen?“, hakte Jonas nach, der meinte, sich verhört zu haben.
„Sie können schreiben, Sie können Charaktere beschreiben. Versuchen Sie es einfach mal. Muster haben Sie ja und wissen, wie so etwas aussehen müsste“, blieb der Regisseur bei seinem Vorschlag.
„Dann hoffe ich, dass ich das neben meinem Job gebacken bekomme. An meinen Büchern arbeite ich oft ein halbes Jahr, wenn nicht länger“, warnte Jonas.
„Das macht nichts. Ich meinerseits muss die Finanzierung durchrechnen. Das dauert auch eine gewisse Zeit. Vor der zweiten Hälfte des kommenden Jahres wäre da ohnehin nichts spruchreif. Ich schicke Ihnen den Vertrag – in deutscher Sprache –, sofern ich alles ausformuliert habe. Das kann zwei, drei Wochen dauern. Ist das okay?“
„Ja, natürlich. Ich kann es beruflich nicht leiden, wenn mich jemand hetzt. Da habe ich Verständnis, wenn mir jemand sagt, dass alles seine Zeit braucht. Ich kann in der Zwischenzeit ja schon mal anfangen, mich am Drehbuch zu versuchen“, erwiderte Jonas. „Bleiben Sie länger in Deutschland?“
„Nein, nur heute und morgen“, sagte Wolfson. „Aber ich bin im Februar zur Berlinale wieder hier. Wieso?“
„Weil ich Sie gerne mit meinen Eltern bekanntmachen würde und es schön wäre, wenn sie von Ihnen selbst hören, welches Angebot Sie mir gemacht haben. Sonst werden sie mir das kaum glauben. Es wäre ein geniales Weihnachtsgeschenk für sie. Außerdem ist mein Vater Journalist und wäre über ein Interview mit einem der wenigen deutschen Regisseure, die es in Hollywood zu etwas gebracht haben, vermutlich sehr glücklich. Und ich würde Sie gern mit Professor Bluhm zusammenbringen. Die Glocke wurde zwar aus dem Hamburg-Museum entfernt und zerstört, aber als Flickzeug für einen Deich bei Rissen verwendet, wo sie dann bei der Nikolausflut ebenso wieder an die Oberfläche kam wie die Unterlagen meines Urgroßvaters auf Usedom freigespült wurden. Der Professor und seine Studenten haben sie rekonstruieren können. Es ist offensichtlich, dass sie zerschweißt wurde. Deshalb sieht sie auch im rekonstruierten Zustand recht ramponiert aus. Richard Taylor hat sie richtig toll nachgegossen. Also … wenn es nicht zu unverschämt wäre, wäre es super, wenn die Glocke von Weta eines Tages im Hamburg-Museum ein neues Zuhause finden würde.“
Wolfson nickte.
„Sie kennen die Geschichte der Glocke. Mein Vater hat mir dazu gesagt, dass auf der Glocke ein Fluch liegt. Sie wissen, dass Mykene finanziell nicht ganz den Erwartungen entsprochen hat, die sich Filmstudios in Hollywood allgemein machen. Ich habe es nie wahrhaben wollen, aber vermutlich hat mich der Fluch auch erwischt. Es war mein Glück, dass ich den Film mit meiner eigenen Produktionsfirma realisieren konnte und nicht von einem der Studios abhängig bin. Mit dem, was Ihrem Urgroßvater und Ihnen selbst passiert ist, werden Sie wahrscheinlich inzwischen auch an den Fluch glauben, oder?“
„Im Grunde ja. Andererseits hat er in diesem Fall unter dem Strich wohl den getroffen, der sich unrechtmäßig daran bereichern wollte“, erwiderte Jonas.
„Wissen Sie, derjenige, der für die Zerstörung der Glocke gesorgt hat, muss die Sage auch gekannt haben, aber nicht wirklich vollständig. Denn es heißt, dass der Fluch gebrochen wird, wenn die Glocke zerstört und erneuert wird. Und die Wendung, die sich für Sie ergeben hat, scheint das zu belegen.“
„Woher wissen Sie das?“, fragte Jonas verblüfft. Wolfson lächelte.
„Mein Vater war ein guter Freund Ihres Urgroßvaters. Ihr Urgroßvater hat ihm deshalb auch das Manuskript anvertraut, als es für ihn zu gefährlich wurde. In der wissenschaftlichen Arbeit konnte er so etwas natürlich nicht erwähnen, das wäre unwissenschaftlich gewesen; aber er hat privat davon gesprochen, wie mein Vater mir erzählte“, erklärte er. „Mein Flug ist zwar gebucht, aber ich glaube, ich kann es mir leisten, die Stornokosten zu tragen. Es wäre mir eine Ehre, Ihre Eltern kennen zu lernen.“
Kapitel 19
Glück und Fluch
Jonas kehrte zum Kapstadtring zurück, holte sein Auto und fuhr am Hotel vor, wo Peter Wolfson schon wartete. Bevor es irgendjemand mitbekam, dass ein berühmter Hollywood-Regisseur aus dem Hotel kam, saß Wolfson schon in Jonas‘ VW Polo.
„Ist der niedlich!“, kicherte der Regisseur. „In L.A. fährt jeder Riesenschlorren von Autos, die das Benzin wie Wasser saufen!“
„Was fahren Sie selbst, Herr Wolfson?“
„Einen ziemlich unverschämt großen Audi, der auch nicht bescheidener schluckt. Was nimmt der hier?“
„Wenn ich mir ganz viel Mühe gebe, komme ich mit fünf Litern Diesel pro hundert Kilometer aus. In der Stadt ist das aber schier unmöglich.“
„Fünf Liter?“, keuchte Wolfson. „Drüben fangen die unter zehn gar nicht erst an – Benzin versteht sich. Das kostet allerdings gerade halb so viel wie hier.“
„Deshalb ist Sparsamkeit wahrscheinlich auch keine Option, oder?“
Der Mann aus Hollywood lachte herzlich.
„So kann man es nennen!“, sagte er. „Sie schreiben also, seit Sie zwölf waren. Und dann werden Sie Versicherungskaufmann. Wie kommt das?“
„Mein Vater hätte es gern gesehen, wenn ich wie er Journalist geworden wäre. Aber nach einem Praktikum war mir klar, dass das nicht meine Welt ist. Meine Schreibleidenschaft ist ein Hobby, das meinem Vater bis vor kurzem gar nicht gefallen hat. Ich habe großes Glück gehabt, dass der Felder-Verlag es riskiert hat, einem Unbekannten eine Chance zu geben. Einen künstlerischen Beruf hätte ich nicht ergreifen können, denn meine Eltern hätten mir das nicht finanziert. Ich sollte einen ordentlichen Beruf lernen und Geld verdienen. Selbst ein Studium hätte ich mir mit Nebenverdiensten finanzieren müssen“, erwiderte Jonas.
„Lieben Sie Ihren Beruf?“
„Ich tue etwas Sinnvolles, denn ich reguliere Schäden, die unsere Kunden verursachen. Ich helfe Menschen, jedenfalls finanziell. Aber das Anspruchsdenken wird immer heftiger, die Geschädigten immer aggressiver. Die Arbeit wird jedenfalls nicht weniger. Und dann ist da noch im Gespräch, dass mein Arbeitsplatz vielleicht in die Zentrale nach Köln verlegt wird. Mein Arbeitgeber hat vor fünf Jahren einen anderen Versicherer aus Hannover aufgekauft. Da sind natürlich irgendwelche Einsparpotenziale immer gefragt. Und eine Schadenabteilung kostet nun mal viel Geld – sowohl vom eigentlichen Schadenaufwand als auch von den Personalkosten. Es wird versucht, alles zu automatisieren, selbst die ziemlich komplexe Schadenregulierung. Die oberen zehntausend träumen davon, dass der Versicherungsnehmer oder Anspruchsteller seine Daten in den PC eingibt, ein Regulierungssystem diese Daten mit den Bedingungen und den einschlägigen Gesetzen abgleicht und daraus eine Entscheidung trifft. Mich graust bei dieser Vorstellung. Die Dinge sind nicht nur schwarz und weiß. Es gibt ’ne Menge Graustufen – und das kann das menschliche Gehirn immer noch am besten unterscheiden“, erklärte Jonas.
„Ich höre da heraus, dass Sie durchaus für einen anderen Beruf zu haben wären.“
„Wenn Sie damit meinen, ob ich lieber Schriftsteller wäre: Jein. Ich will nicht schreiben müssen. Das würde meine Fantasie blockieren, denke ich.“
„Was verdienen Sie mit Ihrer Arbeit?“
„Genug, um mir dieses Auto und zwei Urlaube im Jahr leisten zu können. Meine Wohnung ist Eigentum meiner Eltern. Ich bezahle das Wohngeld selbst – quasi als Miete. Ich komme zurecht.“
„Und wie viel ist das?“, bohrte Wolfson weiter.
„In Deutschland spricht man ungern über den Verdienst, Herr Wolfson. In den Staaten stellt man sich damit praktisch vor, ich weiß; aber es ist nicht meine Art, damit anzugeben oder anderen vorzuführen, was für ein armes Schwein ich bin“, wehrte Jonas ab.
„Sie haben Recht. In den Staaten ist es normal über den eigenen Verdienst zu sprechen, während man es hier immer noch als persönliches Geheimnis behandelt und sich in einer Art diesbezüglicher Schweigepflicht wähnt. Wenn Ihr Fahrzeug nicht gerade einen Lautsprecher hat, mit dem ein Gespräch von hier drinnen nach draußen posaunt wird, sind wir unter uns. Ich will Ihnen freiwillig eine Million Euro für die Filmrechte an Ihrem Buch geben – oder noch mehr, wenn der Film entsprechend erfolgreich wird. Meinen Sie nicht, dass Sie mit mir über Ihren aktuellen Verdienst reden können?“, entgegnete der Regisseur.
„Ich bin jetzt seit gut zwei Jahren Sachbearbeiter und bekomme unter dem Strich rund 2.000 Euro ausbezahlt. Das ist – gemessen an anderen Berufen – relativ viel Geld für einen normalsterblichen Angestellten“, rang Jonas sich die erbetene Information ab. Wolfson rechnete im Geiste
„24.000 im Jahr … da müssten Sie für das Geld, was Sie für die Filmrechte bekommen aber mal locker vierzig Jährchen arbeiten, hm?“
„Ja“
„Und das führt Sie nicht in Versuchung, sich dieser Unsicherheit zu entledigen und das tun zu können, was Sie tun wollen? Wenn Sie Ihren Lebensstil nicht völlig umkrempeln, hätten Sie damit ausgesorgt, oder?“
Jonas lächelte.
„Klar hätte ich das. Aber ich habe das Geld noch nicht, Herr Wolfson. Ob ich meinen Job behalte oder hinschmeiße, darüber kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Entscheidung treffen, ich sicherheitsverliebter Deutscher. Wenn ich es habe und sehe, was die Steuer mir davon lässt, kann ich darüber nachdenken, ob es sich lohnt, den Bürojob an den Nagel zu hängen. Vorher kriegen mich keine zehn Pferde dazu.“
Wolfson nickte mit einem sanften Lächeln.
„Sie gefallen mir, Herr Mönke. Ich wünschte, es gäbe solche Leute wie Sie in Hollywood.“
„Mit einer Million da drüben? Nein. Zum einen wird von jemandem in der Filmbranche sicher erwartet, dass er was anderes fährt als einen Polo Diesel und in was anderem wohnt als in einer Zwei-Zimmer-Eigentumswohnung. Zum anderen sind die Grundstückspreise dort in Höhen abgeschwirrt, bei denen man auch mit ’ner Million nicht weit gucken kann.“
„Genau das meine ich: Diese Nüchternheit, mit der Sie die Welt betrachten, die gefällt mir“, erwiderte Wolfson. „Und davon gibt es in Hollywood definitiv zu wenige.“
„Na ja, wir Deutschen gelten ja eher als humorlos. Das wäre wohl das, was man in Hollywood dazu sagen würde, nehme ich an. Ich kann mir zwar vorstellen, morgens aufzustehen und an den eigenen Computer zu gehen, um zu schreiben, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mir nicht falsche Vorstellungen davon mache. Durch meine Arbeit habe ich Kontakt zu ganz unterschiedlichen Menschen. Einiges von dem, was ich bei meiner Arbeit schon erlebt habe, verarbeite ich schriftlich. Bislang war es für mich das Ventil, an der mangelnden Wertschätzung, die meinereiner erfährt, nicht zu verzweifeln“, sagt Jonas. Es klang recht bitter.
„Wie meinen Sie das?“, hakte Wolfson nach.
„Tja, wie meine ich das?“, seufzte Jonas. „Es gibt Leute, die Versicherungs- und Bankangestellte als legal herumlaufende Banditen bezeichnen. Ich werde – nach hiesigen Vorstellungen – gut bezahlt, aber ich frage mich gelegentlich, wie viel davon eigentlich Schmerzensgeld für das ist, was uns um die Ohren gehauen wird. Vor ein paar Tagen nahm ich ein Telefonat für einen Kollegen an, der zur Mittagspause war. Am anderen Ende der Leitung war ein Anwalt, der überhaupt kein Verständnis dafür hatte, dass jemand es tatsächlich wagt, seine tariflich garantierte Pause zu machen. Der meinte doch wirklich, ich solle mal schleunigst meinen Kollegen auf dem Handy anrufen, dass er ihn auf der Stelle mit seinem privaten Handy anruft. Anderenfalls würde er sich beschweren. Ich habe ihm gesagt, dann möge er sich beschweren, denn ich würde den Kollegen nicht aus der Pause rufen. Den Telefonhörer musste ich dann auf Armlänge weghalten, weil der Typ richtig ins Telefon gebrüllt hat, was mir eigentlich einfiele, ihn so zu behandeln. Dann hat er stehenden Fußes meinen Chef angerufen und sich massiv beschwert, dass ich eine ordnungsgemäße Bearbeitung verweigere. Der zitierte mich ebenso auf der Stelle zu sich und forderte mich zur Stellungnahme auf. Danach war zwischen uns zwar alles in Butter, aber der Ärger war erst einmal da. Hier ist der 1. Mai Feiertag – gesetzlicher Feiertag. Und an diesem 1. Mai ruft hier jemand an und kriegt natürlich keinen. Mault drei- oder viermal aufs Band. Beschwert sich tatsächlich am nächsten Tag. Chef macht ihm klar, was ein gesetzlicher Feiertag ist. Danach ist er erst mal auf Läusegröße geschrumpft, aber zwei Wochen später schreibt er an den Vorstand und beschwert sich da, dass bei uns nie einer erreichbar ist. Und bei einer Vorstandsbeschwerde ist erst einmal Hauptalarm. Dass die Beschwerde letztlich zurückgewiesen wurde, weil es dem Arbeitgeber an einem gesetzlichen Feiertag gesetzlich verboten ist, seine Angestellten zur Arbeit zu bestellen, wenn sie nicht gerade wirklich lebenswichtige Dienste leisten wie Polizei, Feuerwehr und Co., war dann nicht mehr so aufregend. Es gibt Kollegen, die bei wirklich jedem neuen Schaden sofort Betrug wittern und komplett auf stur schalten. Und es gibt Versicherungsnehmer, die bei jedem bezahlten Schaden der Meinung sind, wir hätten entweder gar nicht regulieren dürfen oder hätten auf jeden Fall zu viel bezahlt. Es gibt sogar welche, die meine, wir sollten höchstrichterliche Rechtsprechung nicht befolgen, sondern den Schaden so regulieren, wie es ihnen gerade passt.“
„Und das wollen Sie sich wirklich weiter antun?“, fragte Wolfson. „Wie lange machen Sie das schon?“
„Vier Jahre, einschließlich der Ausbildung.“
„So, wie Sie mir die Reaktionen der anderen Seite schildern, halten Sie das nicht lange aus“, konstatierte der Regisseur.
„Wahrscheinlich“, seufzte Jonas. „Aber wenn ich vom Schreiben leben muss, wird der Stress nicht weniger. Solange das mein Hobby ist und ich schreiben kann, wenn ich Ideen habe und mich niemand mit Terminen drängt, werde ich schreiben können. Sobald jemand mit ’ner Uhr oder dem Kalender daneben steht, geht nichts mehr. Wenn ich in der Schule einen Aufsatz scheiben sollte, hatte ich zwischen den Ohren ein schwarzes Loch. Das habe ich nie ganz ablegen können. Fremdbestimmte Themen und Zeitdruck sind Gift für meine Kreativität in Sachen Schreiben. Und es hat mich wieder voll erwischt, als mein Vater mich drängte in seiner Redaktion ein Praktikum zu machen.“
„Aber mit einer Million auf dem Konto …“
„Wie gesagt: Mal sehen, was der Fiskus mir davon lässt, wenn ich es erst einmal habe, Herr Wolfson. Bis dahin werde ich mich weiter dem Unmut meiner Versicherungsnehmer und Anspruchsteller stellen und hoffen, dass es eines Tages eine bessere Lösung für mein Leben gibt.“
Die Ampel schaltete auf Grün, Jonas bog in die Straße Schierenberg ein, als der Gegenverkehr es zuließ. Kurz hinter der Einmündung des Alaskawegs suchte er einen Parkplatz an der Straße.
„So, da sind wir. Drüben auf der anderen Straßenseite wohnen meine Eltern“, sagte er, als er den Motor abstellte.
Bernd Mönke öffnete, als es an der Tür zweimal klingelte – das familieninterne Zeichen, dass es jemand aus der Familie war, der klingelte – und drückte gleichzeitig auf den Öffner für die Haustür. Er hatte bis zum Klingeln auf dem Sofa gesessen und Kreuzworträtsel geraten und hatte den Bleistift noch in der Hand. Als er den Mann sah, der hinter Jonas in den Hausflur eintrat, fiel ihm dieser Bleistift glatt aus der Hand.
„Herr … Wolfson?“, fragte er verwirrt. Jonas grinste über das ganze Gesicht.
„Herr Wolfson, mein Vater, Bernd Mönke. Paps, Herr Peter Wolfson“, stellte er die Herren einander vor.
„Wie … wie kommen Sie …?“, stotterte Mönke senior verdattert.
„Mit mir in meinem Auto, Paps“, antwortete Jonas grinsend.
„Wer ist da?“, rief Britta aus der Küche.
„Das glaubst du mir nicht, Schatz. Komm her!“, erwiderte Bernd. Britta trocknete sich die Hände ab und ging in den Korridor. Sie blieb stehen, als sei sie gegen eine Wand gelaufen, als sie Peter Wolfson neben ihrem Sohn erkannte.
„Holla! Ich … ich …“, stotterte sie. „Ich hab‘ nicht mit Besuch gerechnet …“
„Musst du auch nicht. Ich wollte euch gerne Herrn Wolfson vorstellen“, fragte Jonas.
Wenig später saß die Familie im Wohnzimmer vor den Kaffeetassen. Britta hatte tausendmal um Entschuldigung gebeten, nichts im Haus zu haben, aber sie hatte noch ein paar Kekse gefunden, die sie dem überraschenden Besuch angeboten hatte.
„Entschuldigung, ich habe mich verhört, oder? Sie bieten meinem Sohn für die Rechte an der Verfilmung eine Million oder noch mehr, wenn der Film Erfolg hat?“, hakte Bernd Mönke ungläubig nach.
„Nein, Sie haben sich nicht verhört. Zum einen ist die Geschichte es wirklich wert, zum anderen möchte ich Sie und Ihren Sohn für den Ärger entschädigen, der Ihnen ohne mein Wissen und Willen von meinem deutschen Geschäftsführer zugefügt wurde. Dafür kann ich nichts anderes als Geld bieten. Die Nerven, die Sie das gekostet hat, würde ich Ihnen auf der Stelle ersetzen, wenn es möglich wäre. Unglücklicherweise kenne ich den Zauberspruch nicht, der das bewirken würde“, erwiderte Wolfson.
„Ich bin gleich wieder da!“, sagte Bernd, stand auf, zog sich seine Winterjacke an, nahm seinen Autoschlüssel und verschwand.
„Wo will er hin?“, fragte Jonas. Britta zuckte mit den Schultern.
„Keine Ahnung. Möchten Sie noch Kaffee, Herr Wolfson?“
„Nein, danke. Sie sind die Enkelin von Boris Trojan, nicht wahr?“
„Ja … wieso?“
„Sie sehen ihm sehr ähnlich“, sagte der Regisseur und nahm aus der Mappe, die er bei sich hatte, ein erkennbar altes Foto heraus.
„Das ist mein Vater – der in der Marineuniform. Der elegante Herr daneben ist Professor Boris Trojan, Ihr Großvater, Frau Mönke“, erklärte er. „Dass es eine familiäre Verbindung zwischen Onkel Boris und dem Autoren dieser genialen Geschichte gibt, habe ich erst heute im Gespräch mit Ihrem Sohn erfahren.“
„Onkel Boris?“, hakte Britta verblüfft nach.
„Mein Vater und Ihr Großvater waren gute Freunde. Deshalb konnte er ihm auch das Manuskript anvertrauen, als es für ihn zu gefährlich wurde. Ich war zwar noch sehr klein, als Ihr Großvater starb, habe auch keine eigene Erinnerung an ihn, aber meine Eltern haben mir gesagt, dass ich ihn als Onkel Boris angesprochen habe, kaum dass ich ein paar Worte sprechen konnte.“
Wenig später kehrte Bernd Mönke zurück und präsentierte zwei Flaschen Champagner – wirklich Champagner. Die Aussicht auf den Millionenvertrag seines Sohnes und die Gelegenheit, mit einem der bedeutendsten Regisseure deutscher Herkunft mit Karriere in Hollywood ein Interview zu führen, hatte den sonst bei Ausgaben sehr zurückhaltenden Journalisten zu dieser Investition verführt.
„Tadaaaa!“, jubilierte er in der Wohnzimmertür, in jeder Hand eine Flasche des teuren Rebensprudels. „Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber das is‘ ‘n Schampus wert!“
Während Peter Wolfson mit Jonas und seinen Eltern das glückliche Ende des Glockenfluchs und den Vertrag für die Filmrechte an Jonas‘ Buch feierten, lief auf der anderen Alsterseite Hauke Schiemann unruhig durch das großzügig bemessene Geschäftsführerbüro im zweiten Stock des außen mit Marmor verkleideten Büroblocks am Herwardeshuder Weg. Das Gebäude passte von seiner Architektur nur bedingt in das Villenviertel an der Außenalster. Es war ursprünglich auch nicht als Büro gebaut worden, sondern als Kunsthaus gedacht gewesen. Gebaut worden war es Mitte der Fünfzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts im Auftrag von Johann Sperling, dem Vorstandsvorsitzenden der Sperling-Assekuranz, der ein kunstsinniger Mensch gewesen war. Anfang der Sechzigerjahre waren die früheren Büroräumlichkeiten seiner Hamburger Vertretung in der Mönckebergstraße in der Innenstadt zu klein geworden. Sperling hatte darauf verfügt, dass die Hamburger Niederlassung in dieses repräsentative Gebäude in einer der feinsten Gegenden Hamburgs umzog. Jahrzehntelang hatte hier die Hamburger Vertretung der Sperling-Assekuranz logiert, bis der Kölner Versicherer im Jahr 2007 den Hannoveraner Versicherer Versicherungsunion des Handwerks übernommen hatte. Dann war auch dieser Standort zu klein geworden und man war zum Kapstadtring umgezogen, wo etwa die doppelte Fläche zur Verfügung stand.
Das Haus hatte ein Jahr leer gestanden, dann hatte Peter Wolfson es für seine Deutschlandvertretung gekauft und sein wachsendes Büro von Billstedt im Hamburger Osten an die Außenalster verlegt. In Billstedt hatte man dafür die Studios deutlich vergrößern können, in denen Teile von Innenaufnahmen der Wolfson-Filme entstanden, in denen aber auch ein erheblicher Teil der Tricktechnik untergebracht war. Hier an der Alster waren die Büros, in denen die Verträge gemacht und verwaltet wurden. Peter Wolfson liebte diese Ecke Hamburgs. Er war in dieser Stadt aufgewachsen, hatte hier auch seine ersten Filme gedreht.
Hauke Schiemann hatte als Deutschland-Geschäftsführer von Agamemnon Productions vielleicht einen der schönsten Arbeitsplätze, die es in Hamburg überhaupt gab. Das Fenster seines Chefbüros zeigte ihm die Schönheit des Alsterparks, während die Angestellten, die an der Straßenseite des Herwardeshuder Stiegs arbeiteten, zwar auf andere Villen sahen, die an der Westseite der Alster standen, aber nur auf die Straße, die Parkplätze und die Vorfahrt sehen konnten. Keine Frage: Es war eine repräsentative Vorfahrt, die Wolfson auch schon für Filmaufnahmen genutzt hatte, aber die Wiese an der Alsterseite, in deren Mitte eine uralte Solitärbuche stand, hatte eben doch noch einen anderen Wert.
Der Geschäftsführer seufzte. Wenn sein Chef die Akten prüfte, würde er von dieser wunderschönen Aussicht nicht mehr viel haben. Vielmehr würde er schneller auf der Straße stehen, als er bis drei zählen konnte, das war ihm klar. Es würde Gefängnis bedeuten – nicht weil er den jungen Schriftsteller hatte über den Tisch ziehen wollen, sondern weil er mit dessen Geld etwas hatte begleichen wollen, was er verbockt hatte.
Schiemann sah auf das Buch, das auf dem Tisch lag. Er hatte es inzwischen noch einmal gelesen. Was Professor Trojan einst über die Glocke herausgefunden hatte, stimmte. Was ganz besonders daran stimmte, war das, was er eigentlich für blanken Aberglauben gehalten hatte: der Fluch.
Sein Plan war wasserdicht gewesen und hatte doch nicht funktioniert. Dass er mit seiner unberechtigten Forderung unter achtzig Millionen Deutschen ausgerechnet an den geraten war, der Trojans Erbe war, war für ihn ein negativer Lottogewinn. Schiemanns Blick fiel auf eine ziemlich alte Fotografie auf seinem Schreibtisch. Sie zeigte einen Mann in einer Feuerwehruniform. Für die Uniform war der Begriff retuschiert eine grobe Untertreibung. Von dem ursprünglichen Foto war kaum mehr original als der Kopf des Mannes. Der Rest war ein mithilfe eines professionellen Bildbearbeitungsprogramms sehr gut manipuliertes Foto. Es war sein Urgroßvater Wilhelm Graumann, der vor der Retusche auf dem Foto in Parteiuniform abgelichtet gewesen war.
„Wir hätten es wissen müssen, Uropa. Dich hat der Fluch geholt und mich hat er ebenso erwischt. Wenn ich das jetzt laufen lasse, wird es nur noch schlimmer. Es ist besser, wenn ich es beende“, brummte er im Selbstgespräch an das Foto seines Urgroßvaters gewandt.
Er sah auf die Uhr. Es war halb acht Uhr am Abend. In den Büros an der Straßenseite war jetzt niemand mehr. Er hatte alles vorbereitet. Bevor die Courage ihn wieder verließ, ging er in das erste Büro jenseits des Chefbereichs, öffnete das Fenster des Büros, stieg auf das Fensterbrett und sprang hinunter. Das Haus war zwar nur zwei Stockwerke hoch, aber unter dem Fenster war das Pflaster der Vorfahrt. Schiemann schlug dort unten mit einem dumpfen Aufprall und lautem Schrei auf – und war tot.
[1] Adresse fiktiv.
Fortsetzung folgt
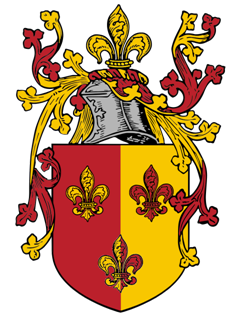

Schreibe einen Kommentar