Prolog
Im Jahre des Herrn 1095 rief der Papst Urban II. die europäischen Ritter dazu auf, die von Muslimen besetzte Stadt Jerusalem für das Christentum zurückzugewinnen. In der Folge machten sich zahlreiche Ritter auf den Weg ins Heilige Land, um dem Befehl des Papstes zu folgen.
Die katholischen Kreuzritter, die sich mit Gottfried von Bouillon und seinem jüngeren Bruder Balduin auf den Weg nach Jerusalem machten, waren die jüngeren Söhne ihrer Väter; Männer, die kein Erbe zu erwarten hatten, weil nur der älteste Sohn überhaupt etwas erbte. Um sich eine eigene Existenz aufzubauen, hätten sie anderen Adligen, die über Land verfügten, als Lehnsleute oder als Ritter dienen müssen. Die andere Möglichkeit war der Weg in ein Kloster und damit die Abkehr von der Welt, insbesondere von einer eigenen Familie.
Die Aussicht, das Heilige Land nicht nur von den als Heiden betrachteten Muslimen zu befreien, sondern auch deren Ländereien zu erlangen und damit eigenes Land zu besitzen, beflügelte die Ritter, die diesen Weg gingen.
Am 15. Juli 1099 wurde Jerusalem von den Kreuzrittern unter dem Kommando von Gottfried von Bouillon erobert. Die Männer richteten unter den Bewohnern Jerusalems ein solches Blutbad an, dass sie – einem Chronisten zufolge – bis zu den Knöcheln im Blut wateten. Dabei schlachteten sie nicht nur Muslime ab, sondern auch Juden und orthodoxe Christen.
Gottfried von Bouillon wurde als dem erwählten Anführer des Kreuzzuges von seinen Gefolgsleuten die Krone Jerusalems angetragen, doch Gottfried lehnte ab. Er wolle an dem Ort, an dem Christus eine Dornenkrone getragen habe, keine goldene Krone tragen, sagte er, akzeptierte aber die Führerschaft der katholischen Neuankömmlinge, die nun die Herren des Heiligen Landes waren und nannte sich fortan Vogt des Heiligen Grabes.
Als Gottfried im folgenden Jahr eher überraschend starb, wurde eine Nachricht an seinen älteren Bruder Eustach, den Grafen von Bouillon gesandt, dem die Herrschaft über Gottes eigenes Reich übertragen werden sollte. Eustach reagierte jedoch nicht. Ob er die Nachricht erhalten hatte und einfach nicht nach Jerusalem gehen wollte oder ob sie ihn nie erreichte, blieb unklar. Den Kreuzrittern schien es aber ein Zeichen Gottes, dass nur einer von denen dessen eigenes Reich regieren solle, der auch etwas zu dessen Befreiung von den „Ungläubigen“ beigetragen hatte. Da in Gestalt von Balduin von Bouillon, Gottfrieds jüngerem Bruder, ein naher Verwandter des bisherigen Oberhauptes der katholisch-christlichen Gemeinschaft im Lande war, trugen die Führer der Kreuzritter ihm die Krone an.
Balduin hatte weniger Skrupel, sich zum König von Jerusalem erheben zu lassen und wurde am 25. Dezember 1099 zum ersten christlichen König Jerusalems gekrönt.
Jerusalem blieb in Kleinasien und dem Vorderen Orient als christliche Herrschaft nicht allein. Schon vor der Eroberung Jerusalems war den Kreuzrittern auf ihrem Weg dorthin die Gründung der Grafschaft Edessa gelungen, die östlich von Antiochia lag. Kurz darauf wurde 1098 auch Antiochia erobert, das einer christlichen Belagerung lange standgehalten hatte und zum christlichen Fürstentum Antiochia erhoben. Zwischen Antiochia und Jerusalem klaffte noch eine Lücke, weil Tripolis sich einer christlichen Eroberung ebenso hartnäckig widersetzte wie zuvor Antiochia. Erst zehn Jahre nach der Eroberung Jerusalems fiel im Jahr 1109 auch Tripolis unter christliche Herrschaft und wurde zur Grafschaft Tripolis. Diese Kreuzfahrerstaaten sahen sich jedoch als weitgehend souverän an und wollten eine Vorherrschaft des Königreichs Jerusalem nicht einfach hinnehmen, wenngleich der König von Jerusalem sich jedenfalls nominell als deren Lehnsherr sah.
Die Kreuzritter waren und blieben wenige. Europa bot jedoch den benötigten Nachschub, weshalb auch im Jahr 1106 immer wieder Gesandte aus den Kreuzfahrerstaaten nach Europa zurückkehrten, um für solche Verstärkungen zu sorgen.
Eine dieser Gesandtschaften erreichte die Vizegrafschaft Chartres und warb um neue Ritter für das Heilige Land. Der Vizegraf von Chartres, Hugo II. du Puiset, hatte knapp zehn Jahre zuvor die Vizegrafschaft von seinem verstorbenen Bruder Ebrard III. in Verwaltung für dessen noch unmündigen Sohn Hugo übernommen. Jetzt war Hugo alt genug, um die Vizegrafschaft selbst zu regieren. Ebrard III. hatte noch einen jüngeren Sohn mit Namen Barisan, der lediglich Geld von seinem Vater geerbt hatte. Das Geld hatte ausgereicht, um eine gute Rüstung, ein Pferd und ein ordentliches Schwert anzuschaffen. Hugo II. hatte ohne die Vizegrafschaft, die das Erbe seines Neffen war, nach eigener Überzeugung nichts mehr in Frankreich verloren. Er hatte seine beiden Neffen zu Rittern ausgebildet und verdeutlichte seinem jüngeren Neffen Barisan, dass es in Frankreich für ihn ebenfalls nichts mehr zu holen gab, wenn er nicht seinem Bruder als einer von dessen Rittern dienen wollte. Barisan, noch nicht ganz mündig, ließ sich von seinem Onkel überzeugen, mit ihm und seiner Familie – seiner Frau Mabilla und dem knapp zweijährigen Sohn Hugo – die weite Reise ins Heilige Land anzutreten.
Onkel und Neffe du Puiset witterten ihre Chance und ergriffen sie.
Im Königreich Jerusalem angekommen, fanden die die Neuankömmlinge rasch Anschluss, sogar im königlichen Palast, wo Barisan seine Ausbildung als Ritter vervollkommnete. Hugo, der ältere von beiden, erhielt schon bald von König Balduin von Jerusalem die erstmals vergebene Grafschaft Jaffa und stand damit eine Rangstufe über seinem verstorbenen Bruder, der lediglich Vizegraf gewesen war. Seinem Neffen Barisan übertrug er 1115 das Amt des Konstablers* von Jaffa. Als Konstabler hatte Barisan für die Sicherheit Jaffas zu sorgen, was bedeutete, dass er die Truppen der Grafschaft führte und sie auch persönlich in eine Schlacht zu führen hatte.
König Balduin starb 1118. Sein Nachfolger als König wurde noch im selben Jahr sein Sohn als Balduin II. und dessen Tochter Melisende Kronprinzessin, denn Söhne waren Balduin II. und seiner Gemahlin versagt geblieben, so dass Melisende die einzige mögliche Erbin des Thrones war. Eine weibliche Alleinherrscherin war den patriarchalisch denkenden Adligen im Heiligen Land aber ebenso suspekt wie ihren Verwandten in Europa. Es musste also ein Ehemann her, der die Last der Krone mit ihr teilen würde (was nichts anderes hieß, als dass er allein der entscheidungsberechtigte Herrscher war …).
Für Hugo I. du Puiset, Graf von Jaffa, war der viel zu frühe Tod des Königs ein Unglück, denn er hätte gern eine noch nähere Verbindung mit dem Haus Bouillon in Form der Heirat seines Sohnes mit der Kronprinzessin gesehen. Als Graf von Jaffa gehörte Hugo zwar schon zum oberen Zirkel der Macht, doch trotz seines Titels galt er als noch nicht etabliert, zudem zählte sein Sohn Hugo erst 14 Jahre, Melisende war erst 13 Jahre alt, als ihr Großvater starb und ihr Vater König wurde – er war noch viel zu jung, um sie zu heiraten.
Barisan du Puiset, Graf Hugos Cousin, fand in Helvis von Ramleh die Königin seines Herzens und heiratete sie 1120. Doch als Konstabler von Jaffa erhielt er keine Reichtümer, die die Gründung einer Familie möglich machen würden. So verzichteten er und seine Frau vorläufig auf Nachwuchs.
Im selben Jahr verstarb auch Graf Hugo von Jaffa recht unerwartet. Sein Sohn Hugo war jetzt sechzehn Jahre alt und wurde als mündig betrachtet. König Balduin II. von Jerusalem übertrug ihm zwar die Grafschaft seines Vaters, die er als Hugo II. von Jaffa nun regierte, eine Ehe seiner Tochter würde aber einstweilen nicht möglich sein, denn Melisende sollte erst heiraten, wenn sie mündig würde.
Hugo II. hoffte dennoch, dass er als guter Bekannter, als Graf der bedeutenden Grafschaft Jaffa, die Chance bekommen würde, um Melisende zu freien, wenn sie alt genug war. Doch er hatte noch ein weiteres Problem: Jaffa war zwar ein gutes Lehen, das auch etwas abwarf, aber damit er um Melisende werben konnte, musste schon mehr Geld heran.
Während andere Väter von Töchtern Mitgift leisten mussten, konnte ein König mit einer thronerbenden Tochter dagegen einen Brautpreis verlangen, schließlich hinterließ er seinem Schwiegersohn ein ganzes Königreich. Um zu mehr Geld zu kommen, warb Hugo 1123 um die reiche Witwe Emma von Jericho, die sein Werben auch erhörte. Dass Emma bereits Söhne hatte, die ebenso alt (oder jung) waren wie ihr Bräutigam, störte Hugo wenig. Aus seiner Sicht war Emma alt genug um nicht mehr zu lange zu leben, so dass er frei sein würde, wenn Melisende den Thron erben konnte.
König Balduin hatte bezüglich seiner Tochter jedoch andere Pläne. Kurz nach Hugos Hochzeit mit Emma von Jericho ließ er in Europa nach einem passenden Gemahl suchen und fand ihn 1129 in Fulko von Anjou, dem regierenden Grafen von Anjou, der kurz zuvor verwitwet war. Fulko akzeptierte die Werbung und reiste ins Heilige Land, nachdem er die Regierung seiner Grafschaft seinem ältesten Sohn Gottfried übertragen hatte.
Fulko kam im Mai 1129 in Jerusalem an, die Hochzeit mit Melisende fand am 2. Juni 1129 statt. Hugo du Puiset war wie vor den Kopf geschlagen. Mit der Ehe der Prinzessin schien der Weg zum Thron endgültig versperrt – es sei denn, die Grafen und Barone Jerusalems würden darauf bestehen, ihren König wählen zu können, wenn Balduin II. das Zeitliche segnen würde. Diese Chance schwand aber dahin, als König Balduin sein Ende nahen spürte und – um Melisendes Ansprüche zu untermauern – seine Tochter 1131 zur Mitregentin ernannte. Es war gerade noch rechtzeitig gewesen, denn am 21. August 1131 starb König Balduin II.
Weil er Melisende schon zur Mitkönigin gemacht hatte, wurden sie und ihr Gemahl Fulko am 14. September 1131 in der Grabeskirche in Jerusalem zu Königin und König von Jerusalem gekrönt. Die neue Königin verlangte nun von den Grafen und Baronen des Reiches den Treueschwur.
Jetzt zeigte sich tatsächlich der Widerstand, auf den Hugo gehofft hatte, denn einige Barone vertraten die Ansicht, dass das Königreich Jerusalem ein Wahlkönigtum hatte. Schließlich hatten die Adligen des Kreuzzuges Gottfried von Bouillon zu ihrem Führer erwählt und hatten nach dessen Tod erneut gewählt, auch wenn die Führerschaft in Gottfrieds Familie geblieben war. Dass Balduin II. die Krone tatsächlich geerbt hatte, sollte besser eine Ausnahme bleiben, fanden die opponierenden Barone. Und da nun „nur“ eine Tochter als mögliche Erbin zur Verfügung stand, die tatsächliche Macht aber bei deren Ehemann liegen würde, würde mit König Fulko ein neues Geschlecht Inhaber des Thrones werden. Das sollte nicht ohne ausdrückliche Zustimmung der Barone erfolgen. Dass Balduin II. Fakten geschaffen hatte, als er Melisende zur Mitregentin erhoben hatte, mochten sie nicht akzeptieren.
Zu denen, die zwar Melisende als Königin akzeptieren würden, nicht aber Fulko als König, gehörte auch Hugo du Puiset, der im Falle eines Treueides seine Felle endgültig davon schwimmen sah. Seine Gemahlin Emma hatte sich trotz fortgeschrittenen Alters als ausgesprochen zäh erwiesen und ihm nicht den Gefallen getan, sich vor der Hochzeit der Prinzessin ins Himmelreich zu verabschieden.
Hugo weigerte sich also, den Treueid zu leisten und beharrte auf einem Wahlrecht der Grafen und Barone. Mit seiner Verweigerung stieß er in seiner eigenen Familie auf Widerspruch, denn seine Stiefsöhne standen hinter König Fulko. Stiefsohn Walter hatte gleich den Verdacht, dass die Verweigerung seines Stiefvaters eigentlich auf dem Drang zum Thron beruhte. Hugo hatte auch nach der Heirat mit Emma und der Eheschließung zwischen Melisende und Fulko weiterhin ein sehr vertrautes Verhältnis zu Melisende – zu vertraulich, für Walters Geschmack. Ein gutes Jahr nach Fulkos und Melisendes Krönung bezichtigte er seinen Stiefvater des Ehebruchs mit der Königin.
Die Haute Court, der Rat der Grafen und Barone des Königreichs Jerusalem, konnte keine Entscheidung treffen, denn sowohl Melisende als auch Hugo bestritten eine außereheliche Beziehung der unkeuschen Art. Weil Aussage gegen Aussage stand, setzte die Haute Court einen gerichtlichen Zweikampf an. Walter von Jericho erschien pünktlich in voller Rüstung – Hugo kam nicht. Die Haute Court sah dies als Schuldeingeständnis an und sprach Hugo du Puiset schuldig.
Hugo hatte nicht nur vor den Zweikampf gekniffen, nein, er floh obendrein nach Askalon, das weiterhin in muslimischer Hand war und suchte dort Schutz, der ihm auch gewährt wurde. Nur mit einer mächtigen ägyptischen Eskorte traute er sich nach Jaffa zurück und rief den Adel Jerusalems auf, sich gegen den König zu stellen. Es gab einige, die ihm folgen wollten, aber in einem hatte er sich verrechnet: in seinem Cousin Barisan.
Dass die ägyptische Eskorte seines Vetters die Gelegenheit dazu genutzt hatte, die Ebene südlich von Jaffa zu plündern, die christliches Gebiet war, war für Barisan schlichter Verrat an den Menschen, die sich dem Schutz des Grafen von Jaffa anvertraut hatten. Die Truppen, die die Grafschaft Jaffa zum Schutz ihrer Untertanen unterhielt, konnten die Ägypter vertreiben, aber der Schock saß doch recht tief.
König Fulko und Königin Melisende waren ebenfalls nicht amüsiert, dass einer ihrer Lehnsleute es zuließ, dass die Bauern und Bürger von erklärten Feinden drangsaliert wurden. Im November 1132 forderte König Fulko ultimativ den Treueid von Hugo, der ihn abermals verweigerte. Fulko ließ das Heer zusammenrufen und durfte feststellen, dass die meisten seiner Lehnsleute dem Ruf folgten. Am 11. Dezember 1132 war das Heer bereit und rückte gegen Jaffa aus, das gut vierzig Meilen westlich von Jerusalem an der Küste lag.
Als das Heer von Jaffa aus gesichtet wurde, traf Barisan eine Entscheidung, von der er wusste, dass sie einem Cousin gar nicht gefallen würde: Er wies die Torwächter an, das Tor zu öffnen und ritt hinaus, um dem König die Stadt kampflos zu übergeben.
Hugos Aufstand war damit gescheitert, bevor er eigentlich angefangen hatte.
Weil auch ein anderer muslimischer Führer die aufkeimende Uneinigkeit der Kreuzfahrer genutzt hatte, um weiter nördlich Unruhe zu stiften, brauchte König Fulko Ruhe im Land. Er konnte es sich nicht leisten, einen Bürgerkrieg zu entfachen, also kam Hugo du Puiset trotz seines Verrates glimpflich davon. Er sollte lediglich für drei Jahre verbannt werden. Doch auf dem Schiff, das ihn nach Sizilien bringen sollte, kam es zu einem Attentat auf Hugo, der zwar zunächst überlebte, aber zwei Jahre später im Exil an den Folgen des Mordanschlages starb.
Um weiteren Vorstößen der Muslime zuvorzukommen, ließ der König den Bau von drei Burgen planen, die die Straßen, die von Süden her zur Pilgerstraße nach Jerusalem führten, bewachen sollten. Barisan gab der König das Versprechen, dass er ein eigenes Lehen erhalten sollte, sofern die geplanten Burgen fertig sein würden. Barisan war mit dem Versprechen des Königs am Ziel seiner Wünsche. Er war angekommen, er hatte eine Frau, er hatte die Gunst des Königs, ihn erwartete ein eigenes Lehen.
Jetzt konnten er und Helvis sich auch um Nachwuchs kümmern. 1133 wurde mit Hugo der erste Sohn geboren, 1135 schenkte sie in Gestalt von Balduin ihrem Gemahl den zweiten Sohn und gebar 1139 den jüngsten Sohn, der den Namen Balian erhielt. Helvis schenkte ihrem Gemahl auch noch zwei Töchter, nämlich Ermengarde und Stefanie.
Eine der Burgen entstand bei der ehemaligen römischen Siedlung Jamnia, war gut mit Wasser versorgt und wurde 1141 fertiggestellt. Ihr Name: Ibelin. König Fulko betraute den treuen Barisan du Puiset mit dieser Burg, der damit zum Baron von Ibelin erhoben wurde. Barisan legte seinen Geburtsnamen du Puiset ab und nannte sich fortan Barisan von Ibelin.
Doch Barisan von Ibelin hatte gerade zehn Jahre etwas von seinem Lohn, dann berief Gott ihn im Jahr 1150 in das eigentliche Himmelreich. Weil sein Sohn Hugo noch nicht alt genug war, um die wichtige Burg Ibelin zu übernehmen, gab König Balduin III. von Jerusalem sie in die Verwaltung des Johanniterordens. Helvis von Ibelin und ihren Kindern blieb nichts anderes, als auf den Eigenbesitz der Mutter in Ramleh umzuziehen. Die drei Söhne konnten nur hoffen, dass Ibelin eines Tages wieder von der Familie Ibelin bewohnt werden konnte.
Kapitel 1
Neues Leben
Man schrieb das Jahr 1158 der christlichen Zeitrechnung. In Mirabel im Königreich Jerusalem herrschte Jubel. Der Jubel galt der Taufe der am 15. August neugeborenen Tochter des jungen Barons Balian II. von Ibelin und seiner Frau Helvis. In der gerade fertig gewordenen von der Familie Ibelin gestifteten Kirche des Ortes wurde das kleine Mädchen auf den Namen Maria getauft, war sie doch am Fest der Himmelfahrt Mariens zur Welt gekommen.
Balian hatte sich zwar einen Sohn gewünscht, zumal sein Bruder Balduin, der mit Helvis’ Schwester Richhilde verheiratet war, schon die beiden 1156 und 1157 geborenen Töchter Eschiva und Stefanie hatte. Doch die Eltern, die mit gerade zwanzig Jahren selbst noch sehr jung waren, waren glücklich, dass die erste Geburt für Helvis doch recht unproblematisch gewesen war.
Eineinhalb Jahre später, am 13. Januar 1160, ging Balians Wunsch in Erfüllung, als Helvis ihr zweites gemeinsames Kind gebar – einen kleinen Jungen, der in der Taufe den Namen Balian Roland erhielt. Die Kinder wuchsen heran. Beide waren ihrem Vater überaus ähnlich, hatten fast schwarzes Haar und die sanften, dunkelbraunen Augen, die auch Balian II. hatte.
Bei seinem Ritterschlag, den Balian II. am 23. April 1157 erhalten hatte, hatte König Balduin III. von Jerusalem den jungen Mann mit dem kleinen Lehen Mirabel belehnt, das zu seinen eigenen Domänen gehörte, genauer: zu Jaffa. Balian hatte eigentlich auf Ibelin spekuliert, das etwas südöstlich von Jaffa lag, doch daraus war nichts geworden.
1157, zu dem Zeitpunkt, als Balian mündig wurde und zum Ritter geschlagen wurde, hatten die Johanniter Ibelin sechs Jahre verwaltet, die älteren Söhne der Ibelins hatten dem König treu gedient, so dass die Hoffnung bestand, dass Ibelin wieder zur Familie Ibelin zurückkehren würde. Doch König Balduin III. hatte damit argumentiert, dass es nicht angemessen gewesen wäre, dem jüngsten Sohn einer Familie das namengebende Lehen zu geben, solange er sich nicht als Ritter erwiesen hatte. So war Balian II. mit Mirabel belehnt worden, das noch kleiner war als Ibelin und auch keineswegs die Bedeutung für das Königreich Jerusalem hatte.
Mirabel, das war dem jungen Ritter klar, würde gerade genug abwerfen, um die Familie zu ernähren. Maria würde eines Tages heiraten, was Mitgift kosten würde. Balian Roland würde Mirabel erben, aber er würde zusätzliche Einkünfte benötigen, wenn sich die Situation nicht verbesserte.
Am 11. Februar 1162 starb König Balduin III. eher unerwartet. Er hatte keine Kinder, die den Thron erben konnten. Die Haute Court, der Rat der Barone des Königreichs Jerusalem, trat zusammen, um über den neuen König zu beraten. Den Vorsitz des Rates führte Amaury, der Bruder des verstorbenen Königs.
„Mylords“, eröffnete er die Versammlung, „wir haben uns hier eingefunden, um über die Nachfolge meines zum Herrn befohlenen Bruders Balduin zu beraten. Seit König Balduin I. hat stets ein Blutsverwandter des dahingegangenen Königs die Krone geerbt. Das war so bei Balduin II., das war so bei Königin Melisende, meiner geliebten Mutter, die ihren Vater beerbte, das war so bei Balduin III., meinem Bruder. Ihm war es versagt, eigene Nachkommen zu haben, doch er hat mit mir einen Blutsverwandten, der in der Lage wäre, das Königreich Jerusalem im Interesse unseres Herrn zu regieren, dessen eigenes Reich dies ist. Durch mich, der ich auch einen Sohn und zwei Töchter habe, wäre auch die weitere Nachfolge auf dem Thron und damit ein Erhalt des Königreichs Jerusalem gesichert. Ich bitte um Eure Zustimmung für mich als Nachfolger unseres verstorbenen Königs Balduin III.“, bewarb er sich um die Krone.
„Ihr habt Erben, Mylord, aber auch eine Ehefrau, die ich nicht gerne als Königin haben möchte“, meldete sich Raymond von Tripolis, der Graf von Tripolis, zu Wort.
Amaury von Jerusalem seufzte. Er wusste, was für einen Drachen er geheiratet hatte. Agnes de Courtenay hatte ihr wahres Gesicht erst gezeigt, als mit den Zwillingen Sibylla und Veronika die ersten Kinder auf der Welt gewesen waren. Sie war launisch und konnte richtig bösartig sein. Es war nicht nur der Graf von Tripolis, der sich gegen Agnes von Jerusalem, geborene de Courtenay, aussprach. Abgesehen von Joscelin de Courtenay, Agnes‘ Bruder, fand sich keiner der Barone, der für sie war.
„Was verlangt Ihr, Mylords?“, fragte Amaury. Die Barone sahen sich an.
„Lasst Euch scheiden, Prinz Amaury, und heiratet Maria Komnena, die Prinzessin von Byzanz. Ihr Großonkel Kaiser Manuel hat Werber durch die Lande gesandt und sucht einen königlichen Gemahl für sie“, empfahl Raymond. „Wenn Ihr Agnes aufgebt und Maria heiratet, bedeutet dies auch ein Bündnis mit Byzanz, das wir in der gegenwärtigen Situation sicher gut gebrauchen können.“
„Eine Scheidung ist nach unseren Grundsätzen nicht möglich, denn was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen!“, warf der Lateinische Patriarch ein.
„Eine Eheauflösung ist möglich“, gab der Templergroßmeister zu bedenken. „Es würde jedoch voraussetzen, dass die Ehe nicht vollzogen ist, was hier gewiss nicht der Fall ist, da Prinz Amaury und Prinzessin Agnes drei Kinder haben. Dieses Argument entfiele, es sei denn, dass die Kinder in ehebrecherischer Weise gezeugt worden wären, also nicht von Prinz Amaury wären. Dann allerdings hätte er noch keine Nachkommen, könnte aber in einer neuen Ehe Kinder zeugen.“
Amaury schüttelte empört den Kopf.
„Auf meine Kinder werde ich keinesfalls verzichten“, versetzte er. „Wenn die Haute Court darauf der Scheidung von Agnes besteht, will ich, dass meine Kinder als ehelich anerkannt werden und eines von ihnen meinen Thron erben kann!“
Die Diskussion währte noch einige Zeit, auch andere Thronprätendenten wurden besprochen, doch letztlich einigte man sich auf Amaury von Jerusalem als Nachfolger seines Bruders. Der Lateinische Patriarch erklärte sich mit einer Eheauflösung wegen erwiesenen Irrtums über das Wesen der Ehefrau einverstanden. Amaurys Kinder wurden als ehelich anerkannt, womit Amaurys Sohn Balduin nach der Krönung seines Vaters Kronprinz werden würde.
Eine Gesandtschaft der Jerusalemer Ritter wurde nach Byzanz geschickt, um Kaiser Manuel die Werbung König Amaurys um seine Großnichte zu unterbreiten. Zu der Gesandtschaft gehörten auch die Brüder Hugo, Balduin und Balian von Ibelin. Der König hatte darauf bestanden, dass nur verheiratete Ritter und Johanniterbrüder auf diese Reise gehen sollten. Balian war es schwergefallen, mehrere Wochen von Frau und Kindern getrennt zu sein, aber wenn er sich vom König ein besseres Lehen erhoffen wollte – vielleicht sogar die Rückgabe Ibelins – war es besser, dem König treu zu dienen und dessen neue Gemahlin aus Byzanz abzuholen.
Die jungen Männer, die die künftige Königin in ihre neue Heimat geleiten sollten, kannten Jerusalem, das gegenüber den Landen, aus denen ihre Vorfahren stammten, die als Kreuzritter nach Palästina gekommen waren, schon wesentlich luxuriöser erschien. Doch der Glanz Konstantinopels ließ auch diese orienterfahrenen Männer zu staunenden Landeiern werden.
„Gütiger Himmel!“, entfuhr es Balian. Der nun vierundzwanzigjährige Ritter war der jüngste Gesandte aus Jerusalem.
„Mach den Mund zu, Balian! Du erkältest dir noch den Magen!“, wies Hugo, der älteste der Brüder Ibelin, ihn zurecht.
„Entschuldige bitte, Hugo. Ich habe so etwas nur noch nie gesehen“, bat der Jüngere um Vergebung für seinen Ausbruch. Er bekam einen kräftigen Schlag auf die Schulter, den ihm Raymond von Tripolis verpasste.
„Keiner von uns hat je eine solche Pracht gesehen, Junge! Außer Hugo, der ist hier fast zu Hause, seit er Ramleh verlassen hat und sich dem Fürsten von Antiochia angeschlossen hat! Deshalb kann er auch so unbeteiligt tun!“, lachte Raymond.
Die Abordnung aus Jerusalem erreichte den kaiserlichen Palast. Auf Anordnung des Kaisers wurden vier der Ritter zur Audienz vorgelassen: Humfried von Toron, der Konstabler Jerusalems, Raymond von Tripolis und die beiden jüngeren Ibelin-Brüder. Alle vier verneigten sich vor dem Kaiser von Byzanz.
„Tragt vor, wer ihr seid und was ihr vom Kaiser des Reiches von Byzanz wünscht!“, forderte der Haushofmeister die Kreuzritter auf Griechisch auf. Raymond von Tripolis, ein weitgereister Mann, der auch des Griechischen mächtig war, trat einen Schritt vor, verneigte sich nochmals und sagte:
„Wir sind Abgesandte des Königs von Jerusalem und bitten für unseren neuen König Amaury um die Hand der Maria Komnena, die er zu ehelichen wünscht.“
Kaiser Manuel klatschte in die Hände.
„Man hole meine Großnichte!“, befahl er. Diener eilten fort und kehrten bald mit Maria Komnena zurück. Sie war eine gerade zwanzig Jahre zählende junge Frau mit langem, fast schwarzem Haar und tiefbraunen Augen, eher dunklerem Teint, aber doch unverkennbar Europäerin griechischer Herkunft.
Als Balian sie sah, hatte er das Gefühl, dass vor ihm ein Blitz eingeschlagen wäre. Wäre er nicht glücklich verheiratet und voller Sehnsucht nach seiner geliebten Frau gewesen, hätte er sich auf der Stelle in seine künftige Königin verliebt. Er ahnte nicht, dass Maria Komnena genau dasselbe erlebte – nur mit dem Hintergrund, noch nicht verheiratet zu sein und den ihr zugedachten Gemahl noch gar nicht zu kennen.
„Stellt Euch vor, Ihr Ritter aus dem Heiligen Land!“, forderte der Haushofmeister die Männer auf. Humfried von Toron stellte sich als Baron von Toron und Konstabler Jerusalems vor, Raymond als Graf von Tripolis, Hugo von Ibelin als Gesandter des Fürsten von Antiochia; Balduin von Ibelin gab sich als Baron von Ramleh zu erkennen. Balian wollte sich fast die Zunge verknoten, doch irgendwie gelang es ihm, sich als Herr von Mirabel bei Jaffa vorzustellen.
Maria lachte hell, als der junge Mann noch ergänzte, dass er des Griechischen leider nicht mächtig sei und hoffe, dass seine Vorstellung auf Französisch angemessen sei. Sie ging auf ihn zu und nahm seine Hand.
„Macht Euch darüber keine Gedanken, Mylord Balian. Mein Großonkel ließ mich auch in Eurer Sprache unterrichten. Sagt, Mylord, seid Ihr verheiratet?“
„Ja, meine Prinzessin.“
„Habt Ihr Kinder?“
„Ja. Eine Tochter und einen Sohn. Sie sind beide noch klein – so wie jene, die unser König mit in die Ehe bringt“, erwiderte Balian mit einem ebenso sanften wie freundlichen Lächeln.
„Stiefkinder?“, fragte Maria verblüfft.
„Ja, die Prinzessinnen Sibylla und Veronika, die jetzt zwei Jahre alt sind, und den Prinzen Balduin, der seinen Vater eines Tages als König von Jerusalem beerben wird“, erklärte Balian.
„Soll das heißen, dass ein Sohn, den ich dem König gebären würde, den Thron nicht erben würde?“, erkundigte sich die Prinzessin – und es klang geradezu entsetzt.
„Nein, meine Prinzessin; es sei denn, die Kinder, die unser König bereits hat, verlassen diese Welt vor den Kindern, die Ihr als unsere Königin dem König schenken werdet“, gab Humfried von Toron Auskunft. Kaiser Manuel schwoll langsam die Zornesader.
„Unter diesen Bedingungen gebe ich die Hand meiner Großnichte nur dann Jerusalems König, wenn sie ein Leibgedinge erhält, das ihr Einkünfte ermöglicht, die der Großnichte des Kaisers von Byzanz würdig sind, wenn der König vor ihr stirbt und der Sohn aus der ersten Ehe des Königs den Thron erwirbt. Dieses Leibgedinge darf ihr unter keinen Umständen genommen werden und soll das Erbe ihrer Kinder sein“, versetzte er mit grantigem Unterton. Humfried von Toron verneigte sich vor dem Kaiser.
„Es wird so geschehen, wie Ihr es bedingt, o Kaiser“, versprach er.
Maria sah Balian an.
„Wie bedauerlich, dass Ihr schon vergeben seid, Mylord Balian“, seufzte sie leise, so dass nur er es hören konnte.
„Ich bin ein unbedeutender Ritter Jerusalems und kein Fürst, Mylady“, wehrte der junge Ritter pflichtschuldigst ab.
„Und ich bedaure, dass ich nicht unbedeutend bin. Ich habe es mir so wenig ausgesucht wie Ihr.“
Er verneigte sich vor der byzantinischen Prinzessin und wusste, dass er sie nie ganz aus seinem Gedächtnis würde streichen können; doch er wusste auch, dass er seiner Helvis treu bleiben würde. Daran gab es für ihn keinen Zweifel.
Die Gesandtschaft Jerusalems kehrte mit der künftigen Königin nach Jerusalem zurück. Balian hätte die Reisegesellschaft am liebsten in Ramleh verlassen, um nach Mirabel zurückzukehren, aber Raymond von Tripolis ließ ihn nicht ziehen.
„Nein, kommt nicht infrage! Du bist auserwählt, die neue Königin von Jerusalem zu ihrem Gemahl zu bringen – und das wirst du auch tun!“, befahl er.
„Ich fühle mich schon wie ein Ehebrecher, Raymond. Ich weiß nicht, wie lange ich widerstehen kann!“, entgegnete Balian.
„Du liebst deine Helvis. Das ist ebenso schön wie selten in diesen Landen. Deshalb traut dir auch niemand zu, in die Gehege des Königs einzubrechen. Und du hast Kinder. Auch deshalb wirst du einen Ehebruch nie riskieren.“
„Nein, natürlich nicht“, erwiderte Balian. „Aber es schmerzt doch, obwohl ich weiß, dass ich ihr nichts bieten könnte, selbst wenn ich frei wäre.“
Die königliche Hochzeit in der Grabeskirche war ein gewaltiges Fest, das nichts zu wünschen übrig ließ. Zu Balians Erleichterung war seine ganze Familie eingeladen – samt Kindern, die ja fast im gleichen Alter waren wie die Kinder des Königs
Kapitel 2
Intrigantenstadel
Die Jahre zogen ins Land. Das Königreich Jerusalem hatte einen relativ stabilen Frieden, weil die Muslime, deren Reiche die Kreuzfahrerlande umgaben, untereinander zerstritten waren, während die Kreuzfahrerlande sich halbwegs vertrugen und sich im Falle von Bedrohungen von außen Beistand leisteten. Ausnahme war hier das Fürstentum Antiochia, dessen Regenten das Königreich Jerusalem nicht als Lehnsherrn anerkennen wollten und sich als souverän betrachteten.
Balian von Ibelin wurde 1167 zum Lehrer des Kronprinzen Balduin berufen, unterrichtete aber ebenso die Prinzessinnen Sibylla und Veronika sowie seine eigenen Kinder, die den Königskindern vertraute Spielkameraden und Freunde wurden. Balian junior, zur Unterscheidung von seinem Vater in der Regel bei seinem zweiten Namen Roland genannt, bekam zusammen mit Prinz Balduin von seinem Vater Unterricht in den ritterlichen Disziplinen Schwertkampf, Bogenschießen, Reiten und Lanzenstechen.
Balian Roland von Ibelin war ein gelehriger Schüler, der Balduin in der Kampftechnik bald deutlich überflügelte. Er war zwar ein gutes Jahr älter als der Prinz, aber das allein erklärte den Vorsprung nicht. König Amaury hatte den Verdacht, Balian könnte seinem eigenen Sohn Extra-Unterricht geben, aber als der König Raymond von Tripolis mit dem Kampftraining beauftragte, änderte sich nichts. Balian Roland blieb der bessere von beiden. König Amaury machte dieser Umstand neidisch. Balians Hoffnung, für seine treuen Dienste mit Ibelin belehnt zu werden, erfüllte sich nicht.
Mirabel war ein so kleines Lehen, dass die Familie Ibelin nicht besser lebte als ihre Untertanen. Während andere Lehensleute des Königs Sklaven für sich schuften ließen – vornehmlich muslimische Kriegsgefangene, für die kein Lösegeld gezahlt worden war – wollte Balian nichts davon wissen, Sklaven zu halten. Für ihn war es mit seinem christlichen Glauben unvereinbar, Sklaven zu besitzen. Doch er kaufte auch muslimische Gefangene frei, was auch ein Grund dafür war, dass den Ibelins nicht so viel Geld für den eigenen Komfort zur Verfügung stand wie anderen Kreuzritterfamilien. Helvis unterstützte Balian jedoch in seinem Tun.
Zu denen, die Balian aus Kriegsgefangenschaft freigekauft hatte, war Amir ad-Din, ein Mann aus Damaskus, der von Beruf Waffenschmied war. Amir war auch ein Mann von Ehre, der Güte mit Güte vergalt und erst nach Damaskus zurückkehren wollte, wenn er das Lösegeld, das Balian für ihn gegeben hatte, abgearbeitet hatte. Er verstand sich auf die hohe Kunst, Damaszenerklingen zu schmieden. Die Messer, die daraus bestanden, verkauften sich auf den Märkten in Jaffa und Jerusalem trotz des doppelten Preises normaler Klingen hervorragend, so dass Balian von Ibelin aus dem Verkauf dieser Waffen und Küchengeräte gute zusätzliche Einkünfte hatte. Dem fränkischen Ritter war durchaus bewusst, dass er diese Einkünfte nur so lange hatte, wie jemand in seinem Einflussbereich über die Fähigkeit verfügte, Damaszenerklingen herzustellen. Er hatte es selbst versucht, hatte aber feststellen müssen, dass er zwar Kraft, aber keinerlei Talent zur Schmiedekunst hatte.
Als Balian Roland zehn Jahre alt war, interessierte ihn, wie die Schwerter und die anderen Klingen gemacht wurden, die er als Sohn eines Ritters und künftiger Ritter benutzen sollte. Er fragte seinen Vater danach.
„Das kann ich dir nicht sagen, Roland. Aber ich kenne jemanden, der weiß, wie es geht. Komm!“, antwortete der und ging mit seinem Sohn in Amirs Schmiede.
„As-salam a’laykum, Sidi!“, begrüßte der Schmied Balian.
„U a’laykum as-salam“, erwiderte der Baron den Gruß. „Meister Amir, mein Sohn möchte wissen, wie man eine Klinge schmiedet. Erkläre es ihm!“, forderte er Amir auf. Der Schmied lächelte.
„Ich denke, es ist besser, wenn ich es ihm zeige, Sidi“, sagte er. „Dein Sohn ist noch jung. Wünschst du, dass er Schmied lernt? Ihr Franken seid doch sonst Krieger.“
Balian lächelte ebenfalls.
„Mirabel ist klein, Amir. Ohne deine Klingen könnte es kaum leben. Ich selber tauge nicht zum Schmied, das hast du mir schon vor Jahren gesagt. Vielleicht ist mein Sohn talentierter als ich. Du wirst eines Tages nach Damaskus zurückkehren, wenn du meinst, mir alles zurückgegeben zu haben, was du glaubst, mir zu schulden. Wenn Roland genug Talent hat, bilde ihn aus, damit deine Schmiedekunst Mirabel weiter stützen kann“, erklärte er.
„Und du, junger Sidi? Möchtest du Schmied werden?“, wandte Amir sich an den Jungen.
„Wenn du es mir beibringen kannst, würde ich das gerne. Ich will meinem Vater helfen, wenn ich kann“, sagte Roland. Der kurdische Schmied sah die Aufrichtigkeit in dessen sanften, braunen Augen.
„Inschallah! Du bist deines Vaters Sohn, junger Sidi. Dann will ich dir zeigen, was ich weiß. Komm her!“
Amir merkte bald, dass er mit Balian Roland von Ibelin einen äußerst interessierten und geschickten Schüler hatte. Durch das Schwertkampftraining hatte der Junge auch schon eine gute Armmuskulatur und war für den Schmied – jedenfalls für kleinere Schmiedearbeiten –bald ein unentbehrlicher Helfer.
König Amaury mochte auf Balian neidisch sein, doch als Lehrer für seinen Sohn Balduin war der Baron von Mirabel ähnlich unentbehrlich wie dessen Sohn als kleiner Schmiedegehilfe. Er wurde samt seinem Sohn wieder an Hof zurückgeholt und unterrichtete den Prinzen wieder im Schwertkampf, aber auch in anderen Dingen wie Verhandlungstechnik.
Zusammen mit Prinz Balduin lernten auch dessen ältere Schwestern Sibylla und Veronika sowie Balians ältere Schwester Marie. Die älteren Kinder rissen den Prinzen mit. Balian lehrte die Kinder Solidarität und gegenseitige Hilfe; lehrte sie, dass Juden und Muslime den gleichen Wert hatten wie die Christen und viel wertvolles altes Wissen hatten – zum Beispiel in der Heilkunst, die bei Christen eher von Aberglauben als von Wissen geprägt war. Schon seit Barisan dem Alten hatte das Haus Ibelin muslimische Ärzte. Es gab auch Johanniterritter, die das Haus Ibelin medizinisch betreuten, die auch von Muslimen lernten, aber die Ibelins vertrauten dem medizinischen Sachverstand ihrer muslimischen Ärzte noch mehr.
Königin Maria von Jerusalem liebte Balian von Ibelin. Es war eine heimliche Liebe, die sie mit Freundschaft zu dem treuen Diener ihres königlichen Gemahls zu tarnen wusste. Es war ihre Idee gewesen, Balian als Lehrer ihrer Stiefkinder an den Hof zurückzuholen. Sie und Helvis von Ibelin verband eine Freundschaft, die verhinderte, dass König Amaury eifersüchtig werden konnte.
Problematisch war für Maria, dass ihre Schwangerschaften ab der Hochzeit mit Amaury in Fehlgeburten endeten. Agnes de Courtenay nahm die Fehlgeburten der Königin zum Anlass, dies als Strafe Gottes wegen der Eheauflösung zu propagieren.
Helvis von Ibelin hatte allerdings einen ganz anderen Verdacht. Sie nahm einen Besuch im Palast zum Anlass, die Küche zu besuchen, gab vor, an einem bestimmten Rezept interessiert zu sein und hatte Gelegenheit, die Küchenkräuter näher zu untersuchen. Dabei bemerkte sie, dass Joscelin de Courtenay, der Bruder von Agnes de Courtenay, ebenfalls in der Küche etwas suchte.
„Oh, Mylord Joscelin! Habt Ihr Euch verlaufen?“, sprach sie ihn an. Er wandte sich verblüfft um.
„Wer seid Ihr, dass Ihr mich einfach ansprecht?“, fuhr er sie an.
„Ich bin Helvis von Ibelin, Gemahlin des Balian von Ibelin, der der Lehrer der königlichen Kinder ist, falls Euch das entfallen sein sollte. Ich suche hier nach einem Rezept für Falafel. Und Ihr? Was sucht Ihr hier?“, erwiderte sie bestimmt.
„Das geht Euch nichts an!“, knurrte Joscelin. „Euer Gespons mag die Kinder des Königs unterweisen. Das gibt Euch aber nicht das Recht, andere Gäste dieses Hauses anzusprechen, als wäret Ihr die Herrin dieses Hauses!“
Damit ließ er sie stehen und verschwand durch eine Tür, die Helvis noch nie bemerkt hatte. Sie tippte einen der Küchenhelfer an.
„Wohin führt diese Tür, mein Freund?“, fragte sie.
„Die? Die führt in den Seitenflügel, wo die Kinder des Königs leben. Einmal im Monat ist deren leibliche Mutter hier, um ihre Kinder zu besuchen. Sie ist dann auch schon mal hier in der Küche und lässt für die Königin kochen“, erwiderte der Küchengehilfe.
„Moment: Die geschiedene Frau des Königs ist einmal im Monat im Palast und lässt dann für die Königin kochen?“, hakte sie nach.
„So ist es, hohe Frau“, bestätigte der Küchenhelfer.
„Was hat sie heute für die Königin zubereiten lassen?“, bohrte Helvis weiter. Der Küchengehilfe wischte sich die Hände an seiner Schürze ab und ging zu einem Bord, auf dem Kochbücher standen und die schriftlichen Anweisungen für das jeweilige Essen im Palast angeheftet wurden. Er zeigte ihr die Rezeptanweisung für das Mahl der Königin. Helvis las die Anweisung und fand darin Kräuter, von denen sie gehört hatte, dass sie Frauen beeinflussen konnten.
„Danke“, sagte sie und verließ die Küche, um schnurstracks zum Stadthaus der Familie Ibelin zu eilen, das nicht weit vom Palast lag. Dort suchte sie nach der Hebamme, die wegen einer Geburt bei einer der verheirateten Dienerinnen im Hause war. Ihr berichtete sie von dem Spezialgericht, das Agnes für die Königin hatte zubereiten lassen.
„Was? Weiß die Königin dies?“, entfuhr es der Frau. Helvis zuckte mit den Schultern.
„Ich weiß es nicht“, erwiderte sie. „Aber stimmt es, dass diese Kräuter für die Leibesfrucht gefährlich sein könnten?“
„Ja, Herrin, das sind sie!“, bestätigte die Hebamme.
Helvis rannte in den Palast zurück, so schnell ihre Füße sie trugen und ließ sich bei Königin Maria melden, die sie auch gleich zu sich bat.
„Helvis, schön, dass Ihr mich besucht, während Euer Gemahl meine Stiefkinder unterrichtet!“, begrüßte die Königin sie.
„Meine Königin, habt Ihr schon gespeist?“, fragte Helvis.
„Nein, aber es müsste bald aufgetragen werden. Wieso?“
„Ich habe erfahren, dass die vom König geschiedene Agnes heute hier ist und für Euch hat kochen lassen!“
„Ja, das ist eine Geste ihrerseits, weil ich ihr im Einverständnis mit meinem Gemahl gestatte, ihre Kinder zu sehen“, erwiderte die Königin.
„Ich flehe Euch an: Esst es nicht!“, warnte Helvis.
„Ach, macht Euch keine Gedanken. Wenn sie versuchen wollte, mich zu vergiften, würde es unser Vorkoster merken“, wehrte Maria ab.
„Meine Königin, es gibt Kräuter, die den weiblichen Körper beeinflussen, aber nicht den eines Mannes. In dem Rezept, das ich in der Küche sehen durfte, sind solche Kräuter enthalten. Eure häufigen Fehlgeburten nutzt Agnes, um dies als Strafe Gottes für die Eheauflösung zu deuten. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie diesen Fehlgeburten nachhilft. Bitte, ich weiß, Ihr seid wieder guter Hoffnung. Tut es für den König und speist heute bei uns“, flehte Helvis. Maria, die gebürtige Byzantinerin, nahm die Warnung ernst und ließ sich von Helvis von Ibelin zum Mittagessen im Stadthaus der Ibelins einladen.
Ab diesem Tag war die Königin an Agnes‘ Besuchstag nicht mehr im Palast und sagte in der Küche für sich ab.
Drei Monate später erfuhr Agnes de Courtenay davon und wies den Koch an, das von ihr veranlasste Mahl für die Königin einen Tag später zuzubereiten, doch sowohl Helvis als auch Maria hatten mit einem solchen Winkelzug gerechnet. Der Koch bekam die Anweisung, von Agnes in Auftrag gegebene Gerichte nicht mehr zu kochen – weder an Agnes‘ Besuchstag noch an irgendeinem anderen Tag. Agnes beschwerte sich deshalb beim König, der sie auch anhörte.
„Amaury, seit einiger Zeit verschmäht dein neues Weib das Essen, das ich für sie in der Küche bereiten lasse, um mich für das Besuchsrecht bei unseren Kindern zu bedanken. Ich finde das undankbar!“
„So, undankbar …“, brummte der König. „Wann habe ich dir erlaubt, für meine Gemahlin speziell kochen zu lassen?“
„Das hatten wir mündlich ausgemacht“, behauptete Agnes.
„Wir hatten mündlich vereinbart, dass du deine Kinder einmal im Monat sehen darfst“, erwiderte Amaury. „Was wir nicht vereinbart hatten, ist, dass du ganz speziell für ihre Stiefmutter ein Gericht zubereiten lässt. Und wir haben ganz gewiss nicht vereinbart, dass du sie gegen aufhetzt. Sibylla, Veronika und Balduin haben mir gesagt, wie schlecht du von Maria sprichst. Agnes, wenn ich etwas bereue, dann dich jemals geheiratet zu haben. Und jetzt ist Schluss! Die Besuchszeit ist ab sofort gestrichen! Verschwinde und lass dich hier nie wieder blicken!“, warf er seine Ex-Frau aus dem Haus.
Agnes ging, doch sie schwor sich, jenen, die sie von ihren Kindern getrennt hatten, Schwierigkeiten zu machen, wo es nur möglich war.
Die nächsten Monate blieben ruhig. Marias Schwangerschaft entwickelte sich dank Helvis‘ Umsicht normal. Zur errechneten Zeit brachte sie im Jahr 1171 ein Mädchen zur Welt, das den Namen Isabella bekam. Maria bat König Amaury, die Ibelins zu Taufpaten der kleinen Prinzessin zu berufen. Amaury ging gerne darauf ein, war ihm doch klar geworden, dass das Königreich Jerusalem keine besseren Diener hatte als die Brüder Ibelin und ihre Familien, die treu zu Königshaus standen.
Kapitel 3
Trauer
Im selben Jahr, als Isabella von Jerusalem geboren wurde, begann Nur ad-Din, der Sultan von Damaskus, von seiner Residenz aus die muslimische Welt um das Heilige Land herum zu einen. Seinen ihm treu ergebenen Neffen Salah ad-Din, auch Saladin oder Salahadin genannt – sandte er nach Ägypten, um die dortigen Emire auf die Linie des Sultans zu bringen.
Weit vom Heiligen Land entfernt, in Oberschwaben, wechselte der junge Rudolf von Steinburg an seinem 14. Geburtstag, dem 17. April 1171, von den Pagen des Kaisers Friedrich I. genannt Barbarossa, zu dessen Knappen und erweiterte seine ritterliche Ausbildung.
Genau ein Jahr später, am 17. April 1172, traf Balian von Ibelin und seine Kinder ein harter Schlag: Helvis von Ibelin starb völlig unerwartet nach schlimmen Magenschmerzen. Harun, Balians muslimischer Leibarzt, mutmaßte, dass sie vergiftet worden war, aber einen handfesten Beweis konnte er nicht führen. Maria von Jerusalem teilte den Verdacht, hatte auch Agnes de Courtenay im Verdacht, sich so an Helvis von Ibelin gerächt zu haben, aber auch sie konnte es nicht beweisen, weshalb König Amaury sich weigerte, Agnes deshalb den Prozess zu machen.
Helvis war gerade zweiunddreißig Jahre alt geworden. Balian war mit ebenfalls zweiunddreißig Jahren trauernder Witwer. Ihm half die Ausbildung der Königskinder in seiner abgrundtiefen Trauer, Balian Roland stürzte sich noch mehr in die Arbeit als Schmied. Wenn er das glühende Eisen verdrosch, schlug er im Geiste auf jene ein, die ihm seine geliebte Mutter genommen hatten. Marie, seine ältere Schwester, fand Trost bei Königin Maria, die Balians Kinder liebgewonnen hatte. Sie lud die Ibelins auf ihr Leibgedinge nach Nablus ein, damit sie auf andere Gedanken kamen.
Nablus und das benachbarte Samaria waren Orte, die schon aus der Bibel bekannt waren. In Nablus, biblisch Sichem, befand sich der Jakobsbrunnen, an dem Jesus mit der Samariterin gesprochen hatte, die als Nichtjüdin zum Glauben an ihn gekommen war. Die Gegend war reich und fruchtbar, bekannt für Zitrusfrüchte, Granatäpfel und Melonen.
Balian konnte jedoch nicht lange bleiben, weil erstens sein Lehen seiner Leitung bedurfte und die Ausbildung der Königskinder auch keine lange Pause duldete und er zweitens keinesfalls wollte, dass die Königin kompromittiert wurde. Roland kehrte mit ihm zurück, um bei Amir seine Sorgen buchstäblich erschlagen zu können.
Die Lehren Balians und die Hilfsbereitschaft seines Sohnes verbesserten die Schwertkampffähigkeit des Prinzen Balduin nachhaltig. Jerusalems Thronfolger wurde ein guter Schwertkämpfer – und ein Freund von Roland von Ibelin. Je älter Roland wurde, desto mehr zeigte sich sein außergewöhnlich gutes Aussehen. Sein Vater war schon ein gut aussehender Mann, doch Roland übertraf ihn deutlich.
Auch Balduin wuchs zu einem hübschen Jungen heran. Roland von Ibelin war sein bevorzugter Partner beim Schwertkampftraining. Die Jungen übten unter der Anleitung Balians ernsthaft und schenkten sich nichts – im Einverständnis mit König Amaury, der unbedingt wollte, dass sein Sohn das Heer Jerusalems ebenso selbst anführen konnte, wie er es tat.
Eines Tages im Jahr 1174 parierte Balduin einen Hieb Rolands nur unvollkommen – und trug eine tiefe Schnittwunde im Unterarm davon. Balians Sohn zuckte zurück und vergaß seinerseits die Deckung, so dass Balduin ihm eine Verletzung an der Schwerthand beibrachte und Roland vor Schmerz das Schwert fallen ließ.
„Oh, Entschuldigung, Roland, das wollte ich nicht“, bat Balduin um Verzeihung. „Wieso hast du zurückgezuckt?“, fragte er erschrocken nach.
„Mein Prinz, Ihr seid verwundet!“, entfuhr es Balian, der Balduins Arm gerade noch zu fassen bekam. „Tut Euch das nicht weh?“, fragte er verblüfft, als er die blutende Wunde untersuchte. Balduin sah verwirrt auf den rechten Unterarm. Blut strömte aus einer tiefen Wunde, die Rolands scharfe Klinge hinterlassen hatte. Er schüttelte den Kopf.
„Nein, ich habe keine Schmerzen“, sagte er. Balian war wie vom Blitz getroffen. Ein herbeigewinkter Diener brachte saubere Leintücher, mit denen Balian die Wunden beider Fechter notdürftig verband.
„Was ist?“, erkundigte sich Raymond von Tripolis, der das rasante Gefecht der Jungen von weiter oben wohlwollend beobachtet hatte und nun herunter gekommen war.
„Sieh es dir an, Raymond: So eine Wunde, und unser Prinz verspürt keinen Schmerz!“, keuchte Balian und öffnete den provisorischen Verband wieder.
„Grundgütiger!“, entfuhr es Raymond, als er das Malheur sah.
„Was … was habt ihr denn?“, fragte Balduin bestürzt. Balian schloss den Verband wieder und sah den Prinzen direkt an.
„Mein Prinz, bei einer solchen Wunde keinen Schmerz zu empfinden kann zweierlei bedeuten: Entweder ist man unglaublich tapfer und verbeißt sich eine Schmerzreaktion oder man hat Lepra. Für unglaubliche Tapferkeit und die Fähigkeit, den Schmerz zu unterdrücken seid ihr beide noch nicht erfahren genug. Ihr habt es beide auch nicht kommen sehen. Das kann auch helfen, sich auf einen Schmerz einzustellen und ihn zu kontrollieren, bedarf aber ebenfalls längerer Erfahrung. Die normale Reaktion auf eine solche Wunde habt Ihr bei meinem Sohn gesehen. Er spürte einen plötzlichen, heftigen Schmerz und ließ das Schwert los. Deshalb … deshalb fürchte ich, dass Euch diese schreckliche Krankheit ereilt hat, die dieses Land schon vor der Geburt unseres Herrn plagte“, erklärte Balian. „Ich werde Euch von meinem Arzt Harun untersuchen lassen. Er wird uns sagen können, ob mein furchtbarer Verdacht zutrifft oder ob Ihr ein wahres Wunder an Selbstbeherrschung seid.“
Der junge Prinz nickte nur, Raymond von Tripolis stimmte gleichfalls zu. Balian ließ Harun kommen, der den Prinzen genau untersuchte – und bleich wurde.
„Ihr habt Recht, Sidi. Es ist Lepra“, stellte er betroffen fest.
„Oh Gott, was tust du deinem eigenen Reich an!“, entfuhr es Balian. Nicht nur er musste sich setzen, auch Raymond bekam wacklige Knie.
„Was … was habt ihr denn?“, wunderte sich Roland. Er und Balduin sahen sich verwirrt an.
„Kommt her, Jungs!“, winkte Balian beide zu sich. Unsicher traten sie zu ihrem Lehrer.
„Balduin, dich hat die Geißel des Heiligen Landes gepackt. Seit undenklichen Zeiten wütet sie hier, die Krankheit, die in der Bibel Aussatz genannt wird. Du weißt aus der Bibel, dass Aussätzige viele Dinge nicht tun dürfen, dass sie auch nicht mit gesunden Menschen zusammen leben dürfen, um diese nicht mit dem Aussatz anzustecken.“
„Aber unser Herr Jesus hat doch Aussätzige geheilt. Und die sind gesund geworden, weil sie an ihn geglaubt haben. Ich glaube an unseren Herrn Jesus. Also kann er mich doch gesund machen“, erwiderte Balduin.
„Du sprichst das Problem an, Balduin. Unser Herr Jesus ist in den Himmel aufgefahren und nicht mehr leiblich auf dieser Erde. Und solange er nicht wiederkommt, ist Aussatz auf der Erde auch nicht heilbar, mein Prinz.“, erklärte Balian mit versagender Stimme. „Es wird bedeuten, dass du bis an dein Lebensende Lepra haben wirst. Und es wird bedeuten, dass du auch nicht heiraten kannst und keine Kinder haben kannst. Wenn … wenn dein Vater mit deiner Stiefmutter nicht noch einen Sohn bekommt, wirst du die Krone erben und König von Jerusalem sein. Doch wenn das so ist, wird mit dir das Haus Anjou auf dem Thron von Jerusalem erlöschen. Dein Nachfolger wird ein Kind einer deiner Schwestern sein und einen anderen Vaternamen tragen. Es tut mir so leid für dich, Balduin!“
Balian von Ibelin hatte Tränen in den Augen, als er mit dem Prinzen sprach. Der Junge begriff die Tragweite dessen, was sein Lehrer ihm sagte. Roland war tief betroffen. Nach allem, was sein Vater gesagt hatte, bedeutete es, dass er nicht mehr mit Balduin trainieren konnte. Balduin war sein Freund …
„Balduin, wenn du König wirst, werde ich dich als einer deiner Ritter beschützen. Das verspreche ich dir!“, sagte Roland ernsthaft.
„So spricht ein wahrer Ritter!“, lobte Raymond.
„Kommt, mein Prinz. Euer Vater muss wissen, was geschehen ist“, sagte Balian.
Weinend sagte Balian dem König, dass sein Sohn ein Aussätziger war. König Amaury war wie vom Blitz getroffen.
„Oh, Gott!“, entfuhr es ihm. „Das wird dieses bösartige Weib gleich wieder nutzen, um an meinem Königtum und meiner Ehe zu rütteln!“
„Nun, dann könnten andere auch der Meinung sein, dies sei die Strafe für eine zu nahe Verwandtschaft mit Eurer ersten Gemahlin, mein Gemahl“, bemerkte Königin Maria, die über die Krankheit ihres Stiefsohnes kaum weniger erschüttert war. Amaury nickte.
„Das ist wahr. Vor allem könnte eine solche Nachricht die Heiden um uns einen. Sie werden es als Gottes Strafe gegen ein christliches Königreich Jerusalem betrachten. Dem wird nur abzuhelfen sein, wenn Ihr mir noch einen Sohn schenkt, Maria.“
Königin Maria war bald darauf erneut schwanger, doch im Juni 1174 hatte sie zum wiederholten Mal eine Fehlgeburt. Es wäre tatsächlich ein Junge gewesen, der im vierten Monat von Marias Schwangerschaft tot von seiner verzweifelten Mutter entbunden wurde. Auf ausdrückliche ärztliche Anordnung zog sie sich vom Hof auf ihr Leibgedinge nach Nablus zurück, um dort zu genesen.
Als dann auch noch am 11. Juli 1174 König Amaury völlig unerwartet starb, war Balduin der einzig mögliche Thronfolger. Raymond von Tripolis und Balian von Ibelin hatten trotz der bekannten Lepraerkrankung Balduins keine Schwierigkeiten, die Haute Court davon zu überzeugen, ihn als den vierten Träger dieses Namens als König von Jerusalem anerkennen zu lassen. Balduin war knapp vierzehn Jahre alt, als er am 15. Juli 1174, am 75. Jahrestag der Eroberung Jerusalems durch die Ritter des Ersten Kreuzzuges, in der Grabeskirche zu Jerusalem zu König Balduin IV. von Jerusalem gekrönt wurde.
Doch mit Amaurys Tod hatten Sibylla, Veronika und Balduin nur noch ihre eigentlich vom Hof ausgeschlossene Mutter Agnes, die ihnen helfen konnte, erwachsen zu werden. Raymond von Tripolis zog sich weitgehend vom Hof zurück. Agnes, die nach der Scheidung wieder ihren Geburtsnamen angenommen hatte, erlangte mit Unterstützung ihres Bruders Joscelin de Courtenay die Erlaubnis der Haute Court, ihren Sohn im Regierungsamt zu unterstützen.
Agnes kehrte also nach Jerusalem zurück. Doch zwei Leute wollte sie auf keinen Fall am Hof haben: Königin Maria und Balian von Ibelin. Da Maria nur durch die Ehe mit Amaury Königin war, wurde ihr auf Agnes‘ Betreiben der Titel entzogen und sie vom Hof verwiesen.
Balian war der Königinmutter in seiner Geradlinigkeit ein Dorn im Auge, dessen Sohn Roland bezichtigte sie, Balduin überhaupt erst mit der Lepra überzogen zu haben. Die Haute Court erklärte, dass alle drei einstweilen Hausverbot im Palast von Jerusalem hatten.
Hugo und Balduin von Ibelin wollten den völlig grundlosen Ausschluss ihres jüngsten Bruders vom Hof nicht hinnehmen, aber Balian bedeutete ihnen, vorläufig keine Schritte zu unternehmen, um ihn an den Hof zurückzuholen. Er und Maria hatten sich schon zu Lebzeiten ihrer verstorbenen Ehepartner nahegestanden und waren beide auf ihre Weise froh, vom Hof ausgeschlossen zu sein. Maria hatte mit Nablus und Samaria ein bedeutendes Leibgedinge, das wesentlich reicher war als das kleine Lehen Balians. Sie warb von sich aus um den gut aussehenden Balian, dessen Wesen auch zum ansprechenden Äußeren passte. Das Trauerjahr war keine ganze Woche abgelaufen, als Balian von Ibelin Maria Komnena heiratete und endgültig nach Nablus übersiedelte.
Kapitel 4
Verweigertes Glück
Agnes de Courtenay war sich bewusst, dass ihre Herrlichkeit am Hof von Jerusalem nur währte, wenn Balduin lebte und König blieb. König konnte er letztlich nur bleiben, wenn seine Nachfolge irgendwie gesichert war. Da er selbst keine Kinder haben würde, wenn nicht ein göttliches Wunder geschah und den Aussatz von ihm nahm, blieben nur Sibylla oder Veronika als „Lieferantin“ eines Thronfolgers. Agnes wollte zunächst Veronika dafür einsetzen.
„Kind, es wird Zeit, dass du heiratest und deinem Bruder einen Nachfolger gibst!“, sagte Agnes, als Balduin gerade sein erstes Thronjubiläum beging.
„Maman, ich bin gerade fünfzehn!“, bemerkte die Prinzessin. „Aber wenn ich unbedingt heiraten muss, kommt für mich nur einer infrage: Balian Roland von Ibelin, Balians Sohn! Er ist nicht nur hübsch, er ist von seinem Vater auch zu einem guten Ritter erzogen worden – und er ist Balduins Freund. Ich mag ihn sehr.“
„Roland? Kommt ja überhaupt nicht infrage! Nicht den, der meinen Sohn, deinen Bruder, als Aussätzigen bloßgestellt hat!“ versetzte Agnes.
„Dafür kann Balian Roland nichts! Es ist in einem Übungskampf geschehen. Ich habe nicht aufgepasst!“, sprang Balduin seiner Schwester zur Seite.
„Ach, halt‘ den Mund, unmündiges Kind! Die Wahl des Ehepartners ist Sache der Eltern! Euer Vater lebt nicht mehr, deshalb muss ich die Entscheidung treffen! Und dieser Emporkömmling kommt mir nicht in die Nähe meiner Töchter! Ich werde in Europa für sie werben lassen. Du hältst dich da raus, verstanden?!“
Balduin schnaufte gereizt.
„Eines weiß ich, Mutter: Dass ich mir von dir nicht sagen lasse, wie ich dieses Reich zu regieren habe! Ich werde die Haute Court um einen Bailli* bitten, der mir dabei hilft!“, versetzte der junge König und sandte Boten aus, die die Haute Court einberiefen.
Zur Haute Court gehörten alle vom König direkt belehnten Barone und Grafen des Reiches, also auch die Ibelins, die Agnes de Courtenay so gar nicht leiden konnte. Sie konnte nicht verhindern, dass ihr Sohn die Haute Court einberief, aber sie wollte nichts zustimmen, was ihr nicht gefiel – und ihr gefiel vieles nicht.
Die Haute Court versammelte sich auf Balduins Ruf im Palast von Jerusalem – einschließlich Balian von Ibelin und Raymond von Tripolis, der auch nicht auf Agnes‘ Wunschliste stand.
„Ihr Grafen und Barone des Königreichs von Jerusalem: Ich habe Euch hergerufen, um zwei wichtige Entscheidungen zu treffen. Zum ersten: Ich bin noch nicht mündig. Mein Vater ist tot und meine Mutter durch Eure Entscheidung nicht mit der Regierung dieses Reiches vertraut. Deshalb bitte ich Euch, mir einen Bailli zur Seite zu stellen, der mir hilft, die richtigen Entscheidungen als König zu treffen. Ich schlage dafür Balian von Ibelin vor, der schon zu Lebzeiten meines Vaters mein Lehrer war“, eröffnete Balduin die Versammlung.
Renaud de Châtillon, der gerade erst aus muslimischer Gefangenschaft entlassene ehemalige Fürst von Antiochia, erhob sich.
„Mein König, Balian hat keinerlei Regierungserfahrung. Wenn Ihr eines Baillis bedürft, dann nehmt mich. Ich bin Fürst und verstehe mich aufs Regieren!“, erklärte er.
„Euch als Bailli? Da sei Gott vor!“, entfuhr es Balduin von Ibelin. „Bevor ich dem zustimme, fließt der Jordan rückwärts! Aber Ihr habt Recht, dass mein Bruder keine Regierungserfahrung hat. Doch er ist mit Maria Komnena verheiratet, die Jerusalems Königin war.“
„Ein Bailli, der den Rat einer Frau braucht, um den König zu beraten? Ihr habt wohl mit blankem Helm in der Sonne gestanden!“, prustete Renaud.
„Die Haute Court – wir – haben Maria die Krone genommen, weil sie nur durch den König Königin sein konnte. Wir werden sie ihr nicht durch diese Hintertür zurückgeben!“, ereiferte sich Joscelin von Edessa, Agnes‘ Bruder.
„Dass Ihr, der so vehement für diese Maßnahme gestritten hat, Maria auch nicht indirekt wieder an der Macht teilhaben lassen wollt, war klar“, bemerkte Hugo von Ibelin bissig. Balian stand auf.
„Mein König, es ist wahr, dass ich keine Regierungserfahrung habe. Ich konnte Euch vieles lehren, Euch manchen Rat geben, doch als Bailli eigne ich mich nicht. Aber Renaud ist als Bailli ebenso wenig geeignet. Er hat Regierungserfahrung, ja, aber er hat auch den Patriarchen von Jerusalem gefangen genommen und wollte Lösegeld von ihm. Er ist eher ein Räuber als ein Ritter und Fürst. Wenn Ihr jemanden benötigt, der Euch rät und als König anleitet, schlage ich Raymond von Tripolis vor. Er ist regierungserfahrener Graf und hat Euch ebenfalls schon gelehrt.“
„Wenn Raymond Bailli wird, dann nur unter der Bedingung, dass meine Schwester bei ihren Kindern am Hof bleiben kann und nie wieder von dort verwiesen wird!“, schaltete sich Joscelin erneut ein.
Nach einiger Diskussion stimmte die Haute Court zu, Raymond von Tripolis zum Bailli zu bestellten, der den verantwortungsvollen Posten auch übernehmen wollte.
„Ihr hattet noch ein weiteres Anliegen, mein König“, bat Joscelin seinen Neffen um den weiteren Punkt der Tagesordnung.
„So ist es. Mir wurde verdeutlicht, dass ich wegen meiner Krankheit keine Ehefrau und damit auch keine Kinder haben kann. Meine Schwester Veronika soll an meiner Statt für die Thronfolge sorgen. Meine Mutter ist der Ansicht, dass es allein ihr obliegt, einen Gemahl für meine Schwester auszuwählen. Da es in diesem Fall aber um die Thronfolge gehen soll, ist davon auch das Amt des Königs betroffen. Deshalb bitte ich die Haute Court um die Zustimmung, dass mein Bailli und die Haute Court in diese Entscheidung mit einbezogen werden. Meine Schwester selbst möchte Balian Roland von Ibelin ehelichen. Mir wäre es recht, denn sein Vater war mein Lehrer, ihn selbst betrachte ich als meinen Freund. Deshalb wäre es mein Wunsch, wenn mein Bailli und die Haute Court Balian Roland von Ibelin als Gemahl meiner Schwester akzeptieren wollten“, erklärte der junge König.
Joscelin de Courtenay erhob sich.
„Das ist eine Familienangelegenheit, in die die Haute Court sich nicht einmischen sollte. Ich gebe zudem zu bedenken, dass die Ehe Balduins von Ibelin mit Richhilde von Beisan erst vor einem knappen Jahr wegen zu naher Verwandtschaft aufgelöst wurde. Balian von Ibelin war mit Richhildes Schwester Helvis vermählt. Das Verwandtschaftsverhältnis war folglich dasselbe. Balian Roland ist der Abkömmling einer Verwandtenehe. Dem sollte die Haute Court – wenn sie sich denn in das Verfahren doch einmischen wollte – nicht als Gemahl der Prinzessin Veronika zustimmen“, sagte er.
Balian stand auf.
„Ich bin die Ehe mit Helvis eingegangen, weil ich sie geliebt habe. Und wäre meine Gemahlin nicht lange vor ihrer Zeit zum Herrn gerufen worden, hätte ich diese Ehe auch nicht auflösen lassen. Die Entscheidung meines Bruders, sich von Richhilde zu trennen, sollte meinem Sohn nicht als Nachteil ausgelegt werden. Wenn Ihr von einer verbotenen Verwandtenehe sprecht, Joscelin, könnte ich verstehen, wenn eine solche Verwandtschaft zwischen der königlichen Familie und der meinen bestehen sollte, doch das ist nicht der Fall. Balian Roland ist mein ehelicher, legitimer Sohn. Es gibt keinen Grund, ihn als Bewerber um die Hand der Prinzessin abzulehnen“, versetzte er.
„Wie alt ist Euer Sohn, Balian?“, fragte Joscelin.
„Er ist jetzt sechzehn Jahre alt. Die Prinzessin ist fünfzehn. Wenn sie heiratsfähig ist, ist mein Sohn es auch.“
„Nein. Euer Vater wurde vor wenig mehr als vierzig Jahren in den Rang eines Barons erhoben. Ihr wollt doch nicht ernsthaft behaupten, dass eine so knapp aus dem untitulierten Adel aufgestiegene Familie in das Königshaus einheiraten könne!“, entgegnete Joscelin bestimmt.
„Ich bin adlig geboren, mein Sohn ist es auch. Der erste König Jerusalems Balduin von Bouillon hatte als nachgeborener Sohn kein Anrecht, das Lehen seines Vaters zu übernehmen, weshalb er – wie die meisten Ritter des Ersten Kreuzzuges – überhaupt hier sein Glück suchen wollte. Wenn ich recht unterrichtet bin, war Euer Ahn Joscelin I. auch nicht mehr als ein Baron, als er herkam – als Sohn eines Mannes, der lediglich Kastellan war, also keinen eigenen Titel trug. Deshalb ist es kein Argument gegen meinen Sohn, darauf zu verweisen, dass der Titel, den er erben wird, erst gute vierzig Jahre alt ist.“
„Mag sein“, räumte de Courtenay ein. „Aber Balduin von Bouillon hatte bei der Eroberung Jerusalems seinen Anteil, weshalb er nach dem Tod seines Bruders Gottfried als König von Jerusalem anerkannt wurde. Euer Sohn, Balian, hat mit seinen sechzehn Jahren noch nicht einmal den Ritterschlag erhalten und sich um den Erhalt von Gottes eigenem Königreich nicht hervorgetan. Abgesehen davon dass durch seine Schuld die Krankheit meines Neffen offenbar wurde.“
„Für die Krankheit unseres Königs kann mein Sohn nichts“, entgegnete Balian.
„Aber er hat auch nichts geleistet, was ihn als Vater eines künftigen Königs empfehlen würde“, beharrte der Onkel des Königs. „Nein, ich kann der Werbung nicht zustimmen!“
„Wenn Ihr nur einen erfahrenen Ritter als Gemahl der Prinzessin akzeptieren wollt, muss ein solcher Kandidat wohl mindestens doppelt so alt sein wie sie. Wollt Ihr wirklich eine Fünfzehnjährige mit einem wenigstens Dreißigjährigen verkuppeln?“, versetzte Balian bitter. „Arme Veronika. Nicht nur, dass sie überhaupt nicht gefragt werden soll, nein, sie soll auch noch mit jemandem verheiratet werden, der beinahe ihr Vater sein könnte.“
„Das wird sich dann zeigen, wenn entsprechende Bewerber hier sind“, entgegnete Joscelin kühl.
„Wenn Ihr für Veronika nur einen deutlich älteren Mann als Gemahl akzeptieren wollt, werde ich mir diese Argumentation für künftige Fälle merken und entsprechende Heiratskandidaten dann ablehnen“, grollte Balian.
Joscelin hatte genügend Überredungskunst, um die Haute Court auf seine Linie zu bringen, Balian Roland als zu jung und zu unerfahren als Gemahl der Prinzessin abzulehnen.
„Gut. Wir werden also in Europa um einen Heiratskandidaten für meine Nichte werben“, fasste Joscelin de Courtenay zusammen. „Aber da ist noch etwas: Veronika ist in Balian Roland ganz vernarrt. Deshalb sollte es ihm unmöglich gemacht werden, sie nach ihrer Hochzeit zum Ehebruch zu verführen. Um das zu verhindern, sollte der junge Mann vor die Wahl gestellt werden, in einen Ritterorden einzutreten oder das Heilige Land zu verlassen.“
„Es gibt keinen Grund, meinen Neffen gleich zum Geistlichen zu machen oder ihn des Landes zu verweisen. Er hat nichts verbrochen!“, protestierte Balduin von Ibelin.
„Noch nicht, Baron Balduin, das ist richtig“, räumte Joscelin ein. „Aber er liebt Veronika und sie liebt ihn. Ein Ehemann der Prinzessin hätte es zu schwer, sich seine Gemahlin gefügig zu machen, wenn sie die Möglichkeit hätte, zu ihrem Geliebten auszureißen!“
„Das wird ja immer besser! Nicht nur, dass meinem Sohn die Ehe mit der Prinzessin aus fadenscheinigen Gründen verweigert wird; nein, er soll auch verbannt werden, obwohl er sich nicht das Geringste hat zuschulden kommen lassen!“, wetterte Balian.
„Das wäre eine Vorsichtsmaßnahme, Balian. Noch hat er nichts angestellt. Aber er sollte auch nicht in entsprechende Versuchung geführt werden. Er kann bleiben, wenn er in einen Ritterorden eintritt!“, beharrte Joscelin.
„Kommt nicht infrage! Balian ist mein Sohn und soll mein Lehen erben und es an seine Kinder weitergeben können!“, entschied Balian.
„Dann verlange ich, dass Balian Roland das Königreich Jerusalem verlässt – und zwar weit genug, damit er nicht so schnell zurückkehren kann, um mit Veronika oder Sibylla durchzubrennen!“, forderte Joscelin.
„Weil Ihr Eurer Nichte den Mann nicht gönnt, den sie selbst will, soll mein Neffe verbannt werden? Joscelin, Ihr seid nicht bei Trost!“, versetzte Hugo von Ibelin.
Humfried von Toron erhob sich.
„Die Wahl eines Ehepartners ist – wie unser König korrekt anmerkt – Sache der Eltern. Wenn Agnes de Courtenay, vertreten durch ihren Bruder Joscelin, Balian Roland von Ibelin nicht als Ehemann ihrer Tochter haben will, ist dem von uns nichts entgegenzuhalten. Aber zu verlangen, dass ein abgelehnter Bewerber um die Hand einer Tochter entweder Ehelosigkeit und Enthaltsamkeit gelobt, indem er zwangsweise Mönch oder Ordensritter wird oder seine Verbannung aus dem Königreich Jerusalem zu verlangen, übersteigt die Befugnisse des Vormundes. Einer solchen Entscheidung widerspreche ich!“, sagte er.
Die Worte des alten Konstablers von Jerusalem zeigten Wirkung. Die Haute Court erkannte das Recht der Mutter an, über den Gemahl ihrer Tochter zu entscheiden, verwahrte sich aber gegen eine Zwangsvergeistlichung oder Verbannung des abgelehnten Bewerbers.
Balian kehrte mit der für seinen Sohn fürchterlichen Nachricht zurück, dass die Haute Court auf Betreiben von Joscelin de Courtenay die Ehe der Prinzessin mit ihm verhindert hatte – und dass er auch von einer Ehe mit Sibylla ausgeschlossen war.
„Das hätte ich dir vorher sagen können“, bemerkte Maria, als ihr Stiefsohn kreidebleich aus dem Wohnraum rannte.
„Was meinst du, Liebste? Dass Balian das nicht verkraftet oder dass die Haute Court Veronika eine Liebesheirat verweigern würde?“, fragte Barisans Sohn.
„Beides“, seufzte Maria. „Die Haute Court kann Agnes de Courtenay zwar nicht leiden, aber ihr Bruder ist mehr als nur beredt. Ich betrachte es als unfassbares Glück, dass es dir, deinen Brüdern und Humfried gelungen ist, Roland vor Zwangsvergeistlichung oder Exil zu bewahren.“
„Er hat ja auch nichts verbrochen, was eine Verbannung rechtfertigen würde“, gab Balian zu bedenken.
„Nein. Sein einziges Vergehen ist, der Sohn eines wahren Ritters zu sein und in die gleiche Richtung zu schlagen“ erwiderte sie. „Aber wenn Veronika nur einen Funken Tochter ihrer Mutter ist, würde ich keine Garantie dafür geben, dass sie sich nicht aus einer Zwangsehe davonstiehlt und mit deinem Sohn die Ehe bricht. Ihr selbst wird nichts geschehen; schließlich soll sie einen Thronfolger gebären. Ohne sie wären Agnes‘ Bemühungen, die Königinmutter zu geben, fruchtlos. Nein, Agnes würde nie zulassen, dass Veronika wegen Ehebruchs angeklagt wird. Sie würde sich an Balian halten und ihm die alleinige Schuld zuschieben. Sie würde alles tun, um deinen Sohn aus dem Weg zu räumen.“
„Du rätst mir, ihn ins Exil zu schicken?“, fragte er verblüfft.
„Nein. Aber du solltest ihn nicht daran hindern, wenn er von sich aus fortgehen will. Balian, Roland ist für mich wie ein Sohn, wie auch Marie für mich wie eine Tochter ist. Ich will nicht, dass Agnes de Courtenay Ränke schmiedet, die ihn irgendwann aufs Schafott brächten.“
Balian von Ibelin begann eine unruhige Wanderung durch den Raum.
„Na gut. Sollte er das wirklich wollen, schicke ich ihn nach Frankreich. Ich habe Verwandte in der Nähe von Chartres, bei denen er gut aufgehoben wäre, wenn er hier nicht bleiben will“, brummte er schließlich.
Balian Roland war vor Wut in Amirs Schmiede gerannt und hatte sich ein Schmiedestück geschnappt, das er in der Esse vorgefunden hatte. Mit allem Zorn, der ihn über die Ablehnung seiner Werbung um Veronika gepackt hatte, hämmerte er auf das glühende Eisen ein, bis es zu einem Beil geworden war.
„Holla! Was treibst du da, junger Sidi?!“, keuchte Amir, der eine Bestellung ausgeliefert hatte, als er in die Werkstatt zurückkehrte und Roland auf den Amboss eindreschen sah.
„Ich muss mich abreagieren, sonst bringe ich vor Wut noch jemanden um!“, schnaufte der Junge. Amir warf einen Blick auf das Beil, das noch leicht glühte.
„Also … damit kannst du jemanden umbringen“, bemerkte er grinsend. „In Damaskus benutzt der Henker so etwas, um Köpfe von Hälsen zu trennen. Was ist los?“
Roland erklärte ihm den Grund seines Zorns. Der kurdische Schmied nickte.
„Inschallah! Aber … wer weiß, wozu es gut ist? Wenn Gott eine Ehe mit der Prinzessin für dich gewollt hätte, er Wege gefunden, sie möglich zu machen“, sagte Amir.
„Es waren Menschen, die diese Ehe nicht wollten!“, verwahrte sich Roland gegen göttlichen Einfluss.
„Gewiss, junger Sidi. Aber Gott lenkt uns. Vielleicht will er dich prüfen, ob du würdig bist, die künftige Königin eines Reiches zu ehelichen, von dem ihr Christen glaubt, es sei Gottes eigenes Reich“, mutmaßte Amir.
„Wir glauben auch, dass Gott die Liebe selbst ist. Was kann er dann gegen unsere Liebe haben, Amir?“, fragte Roland.
Der Schmied zuckte mit den Schultern.
„Ich kenne deinen Gott nicht so gut wie du, Roland. Deshalb kann ich dir die Frage nicht beantworten.“
„Kannst du mir einen Rat geben, was ich jetzt tun sollte?“
„Ja: Vergiss sie!“
„Das kann ich nicht, Amir.“
„Dann wäre es besser, wenn du weit weg wärst, junger Sidi. Wenn sie heiratet, ist sie für dich tabu. Wenn du nicht in Gefahr geraten willst, als Ehebrecher gesteinigt zu werden, solltest du dich damit befassen, fortzugehen.“
„Und wohin? Ich kenne nur dieses Land.“
„Oh, Reisen können bilden, junger Sidi. Ich würde dir eine Reise nach Damaskus oder nach Bagdad empfehlen, wäre es für dich als Ungläubigen nicht so gefährlich“, erwiderte Amir. Roland nickte.
In der Nacht schmiedete Balian Roland Reisepläne. Bagdad, Mossul oder Damaskus konnte er sich vorstellen. Amir hatte ihm viel von seiner Heimat erzählt. Vielleicht auch Konstantinopel, von wo seine Stiefmutter stammte, die er wirklich liebte. Als er am nächsten Morgen noch recht verschlafen davon erzählte, fiel seinem Vater glatt das Tafelmesser aus der Hand.
„Da… Damaskus? Bagdad? Balian Roland, hast du den Verstand verloren?“, keuchte er.
„Nein. Amir hat mir schon so viel erzählt. Ich spreche arabisch. Vielleicht wäre es gut, wenn ich mehr über die Muslime erfahre.“
„Und wirst am Ende selbst einer! Nein, mein Junge. Das lasse ich nicht zu. Wenn du unbedingt fort willst, um dein gebrochenes Herz zu heilen, dann reist du nach Frankreich zum Haus du Puiset!“
„Haus du Puiset?“, wunderte sich Roland. „Was ist das?“
„Unsere in Frankreich verbliebene Familie. Dein Großvater kam – wie viele Kreuzfahrer – als jüngerer Sohn, der nichts zu erben hatte, ins Heilige Land. Sein Onkel erbte den Vizegrafentitel von Chartres, und er und sein ebenfalls nachgeborener Onkel suchten ihr Glück hier. Er hat hier ein wesentlich besseres Leben gefunden, wie er mir oft gesagt hat.“
„Wie weit ist Frankreich entfernt, Vater?“
„Einige tausend Meilen, mein Sohn. Es wird eine lange Reise“, antwortete Balian.
„Und wenn ich stattdessen nach Konstantinopel reiste? Das ein christliches Land, und es ist nicht gar so weit“, gab Roland zu bedenken.
„Ja – und die Heimstatt der Intrige!“, versetzte sein Vater. Maria sah ihn böse an.
„Anwesende ausgenommen“, ergänzte er mit liebevollem Lächeln, das Marias aufkommende Wut bremste. „Liebling, du musst zugeben, dass der Hof in Konstantinopel eine Schlangengrube ist, oder? Das waren mal deine eigenen Worte“, erinnerte er. Maria fand ihr Lächeln wieder.
„Ja, das ist wahr“, bestätigte sie. „Aber wenn ich die Ränke betrachte, mit denen Agnes gegen dich und deinen Sohn agiert, sieht es hier nicht viel besser aus.“
„Nein, da hast du Recht“, erwiderte Balian lächelnd. „Also, Roland, wenn du fort willst, bis die Haute Court vergessen hat, dass Veronika dich liebt und du ihre Liebe erwiderst, dann reise zu unseren Verwandten nach Frankreich. Mein Großcousin, der jetzt dort Vizegraf ist, kann dir gewiss eine zusätzliche Ausbildung in den ritterlichen Tugenden geben“, sagte der Vater.
Kapitel 5
Alte Welt
Das Königreich Jerusalem und die anderen Kreuzfahrerlande – die 1144 untergegangene Grafschaft Edessa, deren Erbe Joscelin von Edessa war, weshalb er sich Titulargraf von Edessa nannte, das Fürstentum Antiochia, das Fürstentum Kleinarmenien und die Grafschaft Tripolis – galten den Europäern als eine neue Welt; Eine Welt der schier unbegrenzten Möglichkeiten, in der es möglich war, vom einfachen Bauern zum König zu werden. In dieser Spanne galt es realiter nicht, aber Söhne ohne Erbrecht konnten sich dort eine eigene Existenz aufbauen.
Hugo und Barisan du Puiset, nachgeborene Söhne des Hauses du Puiset, die in Frankreich kein Anrecht auf ein eigenes Erbe gehabt hatten, waren die besten Beispiele dafür. Hugo war Graf von Jaffa geworden, sein Sohn war nur haarscharf am Königsthron vorbeigerutscht, und Barisan war durch seine Königstreue zu einem bedeutenden Vasallen des Königs von Jerusalem geworden.
In Europa waren die gesellschaftlichen Strukturen seit dem Untergang des Weströmischen Reiches 476 n. Chr. langsam zu Stein erstarrt. War es im Reich Karls des Großen um 800 n. Chr. noch möglich gewesen, vom einfachen Landedelmann bis zum Herzog aufzusteigen, hatten sich diese Möglichkeiten im letzten Viertel des zwölften Jahrhunderts geradezu in Luft aufgelöst. Nur der älteste Sohn einer Familie erbte überhaupt etwas. So blieb vorhandener Reichtum zwar ungeschmälert in der Hand eines Erben, aber alle anderen Kinder mussten zusehen, dass sie irgendwelche Pfründe bekamen oder wenigstens reich heiraten. Erstere Möglichkeiten bestanden in Vasallenstellen beim höheren Adel oder einer geistliche Karriere. Die letztere Möglichkeit war nicht ohne Probleme, denn reiche Väter mit Töchtern betrachteten ärmere Bewerber um die Hand besagter Tochter gerne als Erbschleicher, was auch nicht völlig falsch war, hatte der Ehemann doch die Verfügungsgewalt über das Vermögen seiner Frau.
Doch reich zu sein, bedeutete in Europa keineswegs, dass man sich solchen Luxus wie im Orient leisten konnte oder derart bequem lebte – von den Temperaturen ganz zu schweigen.
Balian von Ibelin war im Heiligen Land geboren worden und aufgewachsen. Er kannte ebenso wie sein Sohn nichts anderes. Aber er hatte genügend Bekannte, die aus Europa gekommen waren. Einer von ihnen war Jean de Grandvilliers, ein Johanniterritter, der im Auftrag des Ordens nach Europa reisen sollte, um neue Ritter für den Orden, aber auch für die Ritter des Königs von Jerusalem anzuwerben. Jean war dreiundzwanzig Jahre alt und sowohl in den ritterlichen Fertigkeiten als auch in orientalischer Medizin ausgebildet. Balian bat ihn zu sich, als er von dessen geplanter Reise erfuhr.
„Jean, ich vertraue Euch meinen Sohn Balian an, der zu unseren Verwandten nach Frankreich reisen will. Bringt ihn sicher nach Chartres, wo mein Großcousin Vizegraf ist“, bat er den Johanniter. Jean lächelte verbindlich.
„Das werde ich, Mylord Balian. Ich bringe ihn auch sicher wieder zurück“, versprach er.
„Nein, Ihr werdet ohne ihn zurückkehren“, entgegnete der Baron. „Der König bedarf der Ritter, die Ihr anwerben könnt. Balian wird mindestens ein Jahr bei unseren Verwandten bleiben und dort weiter zum Ritter ausgebildet werden.“
„Wie Ihr wünscht, Mylord“, bestätigte Jean.
Zwei Tage darauf hatte Balian Roland seine Sachen gepackt. Dank Jeans Empfehlungen hatte er auch warme Kleidung bei sich, denn die Reise würde lange dauern und sich bis in den Herbst hineinziehen. Die Grafschaft Blois, zu der die Vizegrafschaft Chartres gehörte, lag auch im nördlichen Frankreich, das ein raueres Klima als der Süden des Landes am Mittelmeer hatte.
Jean de Grandvilliers hatte noch zehn weitere Johanniterritter unter seinem Kommando, mit deren Hilfe er weitere Kämpfer für das Königreich Jerusalem anwerben wollte. Die Männer und ihr jugendlicher Mitreisender ritten zunächst nach Jaffa, wo gerade ein Schiff aus den italienischen Landen des Heiligen Römischen Reiches eintraf.
Unter den Reisenden aus Europa war ein hochgewachsener, blonder Mann, der einen blauen Schild trug, der schrägrechts von einem weißen Balken geteilt war, der noch von zwei gelben Fäden begleitet war, die mit einem dünnen, blauen Mäanderband belegt waren. Es war das Wappen des Hauses Blois. Im Schildhaupt war das Wappenbild jedoch von einem dreilätzigen, roten Turnierkragen überlagert, Zeichen dafür, dass er einen nachgeordneten Rang gegenüber dem eigentlichen Wappeninhaber hatte. Er bemerkte die Johanniter und ging zielsicher auf sie zu.
„Seid gegrüßt, Ihr Ritter vom Orden des Heiligen Johannes!“, rief er. „Sagt mir doch, wie ich nach Jerusalem komme!“
„Willkommen im Königreich Jerusalem, Mylord“, erwiderte Jean den Gruß mit einer leichten Verbeugung. „Wer seid Ihr, woher kommt Ihr und was wünscht Ihr in Jerusalem?“, bat er seinerseits um Auskunft.
„Ich bin Etienne de Sancerre, Graf von Sancerre aus dem Hause Blois. Ich komme aus Frankreich. Mich hat eine Botschaft des Königs von Jerusalem erreicht, der einen Gemahl für seine Schwester sucht. Ich möchte um sie werben“, erklärte der blonde Ritter. Balian Roland maß ihn mit Blicken von oben bis unten.
„Oh, gütiger Himmel!“, schnaufte er. „Das darfst du nicht zulassen, O Herr!“
Etienne zuckte herum und sah Balian Roland strafend an.
„Wie meinst du das, Novize?“, fuhr er ihn an.
„Wenn ich Euch so betrachte, Mylord, könntet Ihr der Vater der königlichen Prinzessin sein“, entgegnete Balian junior.
„Noch ein Wort und ich stopfe dir das Schandmaul!“, drohte der französische Ritter finster.
„Mylord, vergebt mein Eingreifen“, wehrte Jean ab und stellte sich zwischen den Franzosen und seinen Schutzbefohlenen. „Mir scheint, Ihr habt das vierte Lebensjahrzehnt erreicht. Die Maid, die Ihr freien wollt, ist gerade fünfzehn Jahre alt. Wenn dem so ist, ist mein junger Freund hier jedenfalls nicht völlig auf dem Holzweg, was den Altersunterschied betrifft.“
„Es hat diesen frechen Bengel und auch Euch nicht zu interessieren, wie alt ich bin. Er ist doch viel zu grün, um schon zu heiraten – und Ihr habt der Ehe ohnehin abgeschworen!“, versetzte Etienne.
„Ja, dem Trugschluss unterliegt auch die Königinmutter, die Euch im Namen ihres Sohnes die Botschaft sandte, Mylord“, lächelte Jean verbindlich. „Dieser junge Mann hier hat um jene gefreit, die Ihr ehelichen wollt. Seine Werbung wurde abgelehnt, was ich für einen Fehler halte. Aber macht Euch keine Sorgen. Er geht mit uns nach Frankreich und wird Euch nicht in die Quere kommen, solltet Ihr die Prinzessin tatsächlich heiraten.“
„Das will ich ihm auch geraten haben!“, grollte de Sancerre. „Anderenfalls ist er seinen Strohkopf los!“
Balian wollte auf den französischen Ritter losgehen, aber die Ritterbrüder George und Matteo fingen ihn rechtzeitig ab.
„Lass das! Du handelst dir nur unnötigen Ärger ein!“, warnte Matteo, der Balian festhielt und auch dessen Schwerthand blockierte.
Jean wies auf die Straße, die vom Hafen zum Pilgerpfad nach Jerusalem führte.
„Nach Jerusalem führt dieser Weg, Mylord“, sagte er. Etienne de Sancerre nickte nur, stieg auf sein inzwischen ausgeladenes Pferd und ritt davon. De Grandvilliers sah ihm einen Moment nach, dann winkte er Balian Roland zu sich.
„Ritterliche Wahrheitstreue bedeutet, eigene Verfehlungen im Sinne einer Beichte auszusprechen und dafür auch Strafe in Kauf zu nehmen“, sagte er. „Sie bedeutet nicht, andere ungestraft zu beleidigen. Tu so etwas nie wieder!“
Balian wollte etwas einwenden, aber Jeans Handbewegung ließ ihn schweigen.
„Lass es einfach!“, versetzte Matteo und klopfte ihm auf die Schulter.
Das Schiff, mit dem Etienne de Sancerre gekommen war, hatte Marseille im Königreich Arelat zum Ziel der Rückfahrt. Nachdem Gewürze und Seide verladen waren, gingen auch die Johanniter und ihr junger Begleiter mit ihren Pferden an Bord. Das Schiff hatte die Hafengrenze von Jaffa knapp passiert, als Jean Balian zu sich an den Bug holen ließ.
„Ihr habt ich rufen lassen, Mylord“, sprach der Junge ihn an. Jean drehte sich um.
„Weißt du eigentlich, was dich erwartet?“, fragte er.
„Ich soll wenigstens ein Jahr bei meinen Verwandten in Chartres bleiben und mich als Ritter fortbilden. Mehr weiß ich nicht – außer dass es in Europa wohl oft kälter ist als bei uns zu Hause. Deshalb habt Ihr mir geraten, warme Kleidung mitzunehmen“, erwiderte Balian Roland. Jean nickte.
„Du wirst entsetzt sein, wie primitiv Europa ist, mein Junge. Du kennst tägliche Bäder. Deine Nase wird dir eine Plage sein, wenn du in Gesellschaft dieser ungewaschenen Leute leben wirst. Ihre Medizin ist der im Heiligen Land weit unterlegen. Sie lassen viel zur Ader, aber ein Aderlass hilft nur gegen wenige Dinge. Verletzungen im Kampf lassen sich damit nicht kurieren, dennoch versuchen sie es. Ihre Burgen sind kalt, Früchte wie Orangen oder Zitronen, die für dich selbstverständlich sind, sind für sie im besten Fall Fata Morganas, im schlimmsten Fall Teufelswerk, das dich in Teufels Küche bringen kann. Du bist in einem gesegneten Land aufgewachsen, in dem allein Wasser der Schlüssel zu einer reichlichen Ernte ist. In Europa gibt es keinen Mangel an Wasser, aber an Wärme. Kälte und Regen zur falschen Zeit können Ernten vernichten und zu Hunger führen.
Du wirst Vieles besser wissen als sie, aber wenn du es äußerst, werden sie dir nicht glauben. Ich kann dir nur raten, dein Wissen nicht hervorzukehren oder es nur vorsichtig anzubringen, wenn du unnötigen Ärger vermeiden willst.
Und sie sind neidisch auf das, was ihre Verwandten im Orient erreicht haben. Deine Vorfahren, die als Kreuzritter nach Jerusalem zogen, hatten kein Erbe zu erwarten, weil sie jüngere Brüder oder Neffen deines Großonkels waren. Deine Vorfahren haben höhere Ränge im Adel erreicht als die Daheimgebliebenen. Es gibt Leute, die das gar nicht gut vertragen können. Brüste dich also nicht mit dem Titel deines Vaters.
Sei zufrieden mit dem, was man dir freiwillig gibt, biete deine Dienste an, aber dränge dich nicht auf. Du wirst auf dich allein gestellt sein, denn wir werden dich nur deinen Verwandten in Chartres übergeben und weiterziehen, um unseren Auftrag zu erfüllen, neue Ritter anzuwerben. Es ist eine gefährliche Zeit, denn die Muslime werden es auszunutzen wissen, dass unser König mit Lepra geschlagen ist. Wir brauchen Ritter, um Jerusalem christlich zu erhalten. Deshalb werden wir ohne dich nach Jerusalem zurückkehren“, erklärte er. Balian Roland nickte nur.
Das Mittelmeer machte es den Schiffsführern nicht unbedingt leicht. Widrige Winde zwangen die Schiffe immer wieder zum Kreuzen, in extremen Fällen auch zum Einsatz von Riemen, um in westliche Richtung zu fahren. Drei Wochen nach dem Ablegen in Jaffa traf das Schiff in Marseille ein. Balian Roland, der in diesen drei Wochen mehr über der Reling gehangen hatte als dass er gerade an Deck gestanden hatte, war froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Der Hafen von Marseille hatte schon in römischer Zeit bestanden, als die Stadt als Massilia zum Römischen Reich gehört hatte. Doch von seinem römischen Glanz war kaum etwas geblieben. Zwar entstanden gerade zahlreiche neue Kirchenbauten, die in einem völlig neuen Stil errichtet wurden und aus Stein bestanden, doch gerade diese neuen Bauten banden die Kapazitäten der vorhandenen Steinmetze. Die Kais verfielen, weil es für solche Profanbauten zu wenige Steinmetze gab, die entsprechende Steine bearbeiten konnten. Wo Häuser aus Stein verfielen, wuchsen solche aus Holz nach. Die Holzbauten, die sich zwischen verfallenden Steinhäusern fanden, fielen Balian Roland auf, weil sie meist neuer aussahen als die Steingebäude.
„Hier wird viel mit Holz gebaut, Bruder Jean“, sagte er. „Sind die Leute hier so reich, dass man sich Holzhäuser leisten kann?“, fragte er. Jean schüttelte den Kopf.
„Nein, Holzbauten sind hier ein Ausdruck von Armut und Mangel. Bei uns in Jerusalem ist Holz kostbar, weil bei uns wenige Bäume wachsen – sieht man von Palmen ab. Hier ist Stein kostbar. Nur sehr reiche Leute wie Adlige und die Kirchenfürsten können sich steinerne Gebäude leisten. Hier, in der Nähe des Mittelmeeres im früheren Römischen Reich, ist bearbeiteter Stein noch aus dieser römischen Zeit vorhanden. Alte Tempel der Heiden, ihre Amphitheater und Villen werden quasi als Steinbrüche genutzt. Je weiter wir nach Norden kommen, desto weniger Steinbauten wirst du sehen“, sagte er.
Wie Recht Jean hatte, zeigte sich schnell. In der Tat: Je weiter sie nach Norden kamen, desto dünner wurde die Dichte der Steinbauten, desto größer der Anteil an Holzhäusern – von durchaus markanten Hallen mit allerlei Schnitzwerk als Verzierung bis zu windschiefen Hütten mit Strohdächern, durch die der Rauch der Feuerstellen abzog.
Es war inzwischen September, die Tag- und Nachtgleiche zeigte den Beginn des Herbstes an. Von nun an würden die Tage kürzer sein als die Nächte. Schon seit die Reisegruppe Lyon passiert hatte, hatte es öfter geregnet als dass die Sonne geschienen hatte.
„Jetzt weiß ich, weshalb unsere Vorfahren ins Heilige Land gezogen sind und auch dort blieben“, bemerkte Balian Roland, der seit Tagen mit Schnupfen und Husten kämpfte.
„Wegen Wärme und Sonnenschein, meinst du?“, hakte Jean nach. Balian Roland nickte.
„Ich sage dir: Die Allermeisten, die sich einst nach Jerusalem aufmachten, hatten keine Ahnung, dass dort ein so anderes Klima herrscht. Sie waren durchaus angenehm überrascht, wie warm es dort ist. Wer blieb, blieb auch nicht nur wegen des Wetters, sondern hauptsächlich wegen der Möglichkeit, sich dort ein gutes Leben aufzubauen.“
Er sah den jungen Überseefranzosen eine Weile an.
„Du solltest noch von dem Kräutertee trinken, mein Junge. Das lindert den Hustenreiz und macht die Nase etwas freier“, empfahl er. Er hatte eine Mischung aus Fenchelsamen, Salbeiblättern und Weidenrinde mit Wasser als Tee aufgekocht und Balian Roland und noch zwei weiteren seiner Männer als Medizin gegeben.
Am Tag darauf, es war der 25. September 1176, erreichten sie Chartres und wurden von Vizegraf Ebrard du Puiset von Chartres empfangen. Der Vizegraf nahm die Ankunft seines Neffen zweiten Grades zur Kenntnis – und bot ihm und den Johannitern an, nach Saint-Martin-au-Bois weiterzuziehen, das wenige Meilen nordwestlich von Chartres im Hügelland lag. Sein Bruder Henri, der dort Baron war, habe bessere Möglichkeiten, die Johanniter während ihrer Anwerbungsreise zu unterstützen und könne besser für die weitergehende Ausbildung und Erziehung Balian Rolands sorgen, als das an seinem Hof möglich wäre.
Bruder Jean, seine Leute und Balian Roland zogen nach einem eher einfachen Mahl weiter nach Nordwesten in die Hügel, die das Tal des Flusses Eure umrahmten, an dem Chartres lag. Der Weg führte über ein Dorf namens Brechignon, in dem sich der Weg gabelte, rechts herum nach Saint-Martin-au-Bois führte und links nach Monbartier. Beide Wege führten in einen dichten Wald. Jean de Grandvilliers und seine Begleiter folgten dem rechten Weg, der nach einigen Biegungen an eine Einmündung kam. Der nach rechts abzweigende Weg führte nach Cambery, der Hauptweg, der bald darauf wieder nach links abbog, nach Saint-Martin-au-Bois. Wieder einige Biegungen weiter folgte eine weitere Weggabelung, an der der von Monbartier heraufkommende Weg sich wieder mit dem Weg nach Saint-Martin-au-Bois vereinte. Ab jetzt wurde der Weg steiler, die Kurven weiter, um die Steigung abzufangen. Zwei Kehren weiter stieß wieder ein Weg auf den Hauptweg, der von Cambery heraufkam. In der letzten Kehre vor dem direkten Weg in das Dorf Saint-Martin-au-Bois zweigte wieder ein Weg ab, der nach dem dortigen Wegweiser nach Chaumur führte.
Saint-Martin-au-Bois war ein Dorf, das kaum größer war als Brechignon, doch wurde es von einer beeindruckend großen Burg überragt. Über der Burg wehte eine schwarze Flagge, die schräglinks mit einem gelben Balken geteilt war. In der Oberecke* oberhalb und unter dem Balken an der Flugseite* waren je drei gelbe fünfzackige Sterne.
Beide Dörfer wirkten ärmlich und wenig einladend. Balian Roland schauderte es, als ihm endgültig klar wurde, dass er in dieser Armseligkeit wenigstens ein ganzes Jahr verbringen sollte.
„Und Mirabel gilt als armselig!“, entfuhr es ihm. „Was ist dies dann?“
„Ein Dorf in Frankreich!“, seufzte Jean. „Und der Ort, an dem deine Verwandten leben, die dir eine weitere Ausbildung geben sollen.“
Er sah den Jugendlichen an.
„Denk an das, was ich dir gesagt habe: Vermeide jede Prahlerei; nimm, was man dir freiwillig gibt und sei bescheiden. Sonst forderst du Neid und Missgunst geradezu heraus“, ergänzte er.
„Ich werde es bedenken, Bruder Jean“, versprach Balian Roland. Jean sandte einen seiner Sergeanten* voraus, der sie in der Burg des Barons von Saint-Martin-au-Bois anmeldete.
Wenig später empfing Henri du Puiset, Baron von Saint-Martin-au-Bois, die Johanniterritter und seinen Neffen zweiten Grades:
„Seid gegrüßt, tapfere Ritter des Johanniterordens, die Ihr im Heiligen Land für die Christenheit streitet. Wer seid Ihr und was ist Euer Begehr?“
„Habt Dank, edler Baron. Ich bin Jean de Grandvilliers vom Ritter- und Hospitalorden des Heiligen Johannes von Jerusalem. Meine Brüder und ich sind nach Frankreich gekommen, um im Auftrag des Papstes und des Königs von Jerusalem weitere Kämpfer für das Kreuz Christi aufzurufen, uns ins Heilige Land zu folgen, um dort unsere Truppen zu verstärken. Dafür brauchen wir gewiss einige Tage und bitten um Eure Gastfreundschaft und Aufenthalt in Eurer Burg“, erklärte Jean.
„Die Gastfreundschaft sei Euch und Euren Begleitern gewährt“, erwiderte Henri. „Sagt, Bruder Jean, nehmen die Johanniter auch Novizen mit auf ihre Werbereisen oder ist der Junge an Eurer Seite bereits ein Neuzugang zu Eurem Orden, der Euch in Frankreich zukam?“
Jean lächelte verbindlich.
„Weder noch, Mylord. Dieser junge Mann ist der zweite Grund, weshalb wir gerade hierher kamen. Euer Großonkel Hugo und Euer Onkel Barisan du Puiset verließen vor gut sechzig Jahren Frankreich, um im Heiligen Land für Christus einzustehen. Sie blieben und gründeten Familien, die Gottes eigenes Reich mit ritterlichem Nachwuchs wachsen lassen. Dieser junge Mann hier ist Balian Roland von Ibelin, der Enkel von Barisan du Puiset. Sein Vater, Euer Cousin Balian von Ibelin, bittet Euch, Baron Henri du Puiset, seinen Sohn für ein oder zwei Jahre an Eurem Hof zu erziehen und ihm eine ergänzende Ausbildung in den ritterlichen Tugenden zu geben.“
„Aha. Komm her, Balian Roland!“, winkte Henri den Jungen zu sich. Er trat zu seinem Großonkel und verbeugte sich.
„Mein Herr Onkel?“
„Wie alt bist du?“
„Sechzehn Jahre, Mylord.“
„Du kannst reiten?“
„Ja, Mylord.“
„Mit dem Schwert kämpfen?“
„Ja, Mylord.“
„Kannst du lesen und schreiben?“
„Ja, Mylord.“
„Auch rechnen?“
„Ja, Mylord.“
„Da du reiten und mit dem Schwert kämpfen kannst, benötigst du wohl keine weitere Ausbildung in diesen Fähigkeiten. Aber du kannst mir als Schreiber dienen“, beschloss Henri.
„Wie Ihr wünscht, Mylord“, erwiderte Balian Roland mit einer erneuten Verbeugung.
„Wenn du das so hinnimmst, bist du wohl eher ein Schreiberling als ein Ritter!“, mutmaßte ein junger Mann neben Henri. Er war hochgewachsen, hatte hellbraunes Haar, hellbraunen Bartflaum an Wangen, Oberlippe und Kinn sowie blaue Augen. Er trug eine hellbraune Samttunika mit gewebter Borte in dunklerem Braun an den Ärmelkanten und dem Halsausschnitt, darüber einen schwarzen Wappenrock mit einem gelben Balken, der von der linken Schulter bis zur rechten Hüfte reichte. Auf der Brust zierten je drei gelbe Sterne den Bereich ober- und unterhalb des gelben Schrägbalkens. Um die Hüfte hatte er einen schwarzen Schwertgürtel geschlungen, an dem ein einhändiges Schwert mit breiter Parierstange hing.
„Armand, du bist nicht gefragt!“, wies Henri ihn zurecht. „Neffe, dies ist dein Cousin Armand, mein Sohn. Er würde freiwillig nie einen Federkiel anfassen, weil er meint, dies sei unter seiner Würde als Ritter. Er ist jetzt zwanzig Jahre alt und wird im nächsten Sommer den Ritterschlag erhalten. Ob du es wert wärest, mit einundzwanzig Jahren den Ritterschlag zu erhalten, wenn du dich zum Schreiber machen lässt, bezweifle ich.“
„Darf ich sprechen, Mylord?“, bat Balian Roland.
„Sprich!“, forderte Henri ihn auf.
„Mylord Onkel, im Königreich Jerusalem ist es keine Schande lesen und schreiben zu können. Wenn Ihr meint, dass ich keine weitere Ausbildung als Ritter benötige, weil Ihr meinem Wort vertraut, dass ich diese Fähigkeiten habe und Euch als Schreiber dienen soll, werde ich das tun. Mein Vater hieß mich, Euch gehorsam zu sein. Und wenn ich Euch mit meinen Fähigkeiten helfen kann, will ich das tun“, erwiderte Balian Roland. Henri maß seinen Großneffen von oben bis unten.
„Dein Vater tat gut daran, dir diese Weisung zu geben, denn sein Vater war der jüngere Bruder meines Vaters. Dein Vater ist als dessen Sohn von geringerem Rang als mein Vater oder ich. Ich habe da noch eine Frage: Du nennst dich von Ibelin. Wieso nicht du Puiset?“
„Mein seliger Großvater wurde vom König von Jerusalem für seine Treue mit der Herrschaft Ibelin belehnt und war Baron von Ibelin. Er hinterließ diesen Namen seinen Söhnen, die sich nach ihrem Lehen nennen sollten, Mylord“, antwortete Balian Roland.
„Baron? Was für ein glückliches Schicksal für einen Mann, der hier kein Erbe zu erwarten hatte. In der Neuen Welt jenseits des Meeres scheint ja einiges möglich zu sein“, bemerkte Henri mit leisem Spott. „Bist du der einzige Sohn deines Vaters?“
„Ja, Mylord.“
„Dann ist er sehr unvorsichtig, seinen einzigen Erben in die Fremde zu senden“, grinste Armand. Der schräge Blick seines Cousins warnte den Jungen aus dem Heiligen Land. Armand schien ihn nicht zu mögen, das spürte er.
„Im Moment bin ich der einzige Sohn, mein Cousin“, erwiderte er an ihn gewandt. „Mein Vater hat nach dem viel zu frühen Tod meiner Mutter aber erneut geheiratet. Es ist möglich, dass meine liebe Stiefmutter ihm weitere Kinder schenkt.“
Henri schlug ihm heftig auf die Schulter.
„Gut gekontert, mein Junge!“, sagte er anerkennend. „Ich würde unsere Familienchronik gern um die Verwandten im Königreich Jerusalem erweitern. Du wirst mir – das ist meine erste Aufgabe für dich – einen Stammbaum unserer Vorfahren und deiner Familie machen.“
„Wie Ihr wünscht, Mylord“, bestätigte Balian Roland den Auftrag mit einer Verbeugung.
Kapitel 6
Rauswurf
Henri gab seinem Neffen das Schreibmaterial – Pergament, Tinte und Feder.
„Vergebt, Mylord, Habt Ihr auch Papier und Schreibkohle, damit ich das vor einer Reinschrift notieren kann?“, bat Balian Roland.
„Pa… was bitte?“, fragte Henri verständnislos.
„Papier, Mylord. Im Königreich Jerusalem benutzen wird dies, um Dinge zu notieren. Es ist viel günstiger als Pergament. Kennt Ihr das nicht?“, erklärte Balian Roland.
„Nein. Wir haben ausschließlich Pergament. Es ist teuer, also geh sparsam damit um!“, versetzte der Baron. Er lotste seinen Großneffen im Donjon* zwei Stockwerke höher, wo die Wohnräume der Familie lagen. Dort öffnete er eine Tür, hinter der sich ein kleiner Raum erstreckte, der vielleicht zwei Klafter* im Quadrat maß und etwa eineinhalb Klafter hoch war. Ein Bett mit Strohmatratze, auf dem ein mit Leinen bezogenes Federbett und ein ebenfalls mit Leinen bezogenes Federkissen lagen, ein Scherenstuhl mit einem strohgefüllten Sitzkissen, ein Tisch mit einem Kienspanhalter, eine kleine Truhe zwischen der Tür und dem Bett sowie eine kleine Truhe unter dem Fenster waren die einzigen Einrichtungsgegenstände. Das Fenster war etwa vier Spannen* hoch und breit und war mit einem pergamentbespannten Rahmen verschlossen.
Henri wies auf die Truhe zwischen Tür und Bett.
„Hier findest du Kienspäne, Feuerstein und Zünder“, sagte er. „In der Truhe unter dem Fenster kannst du dein Gepäck lassen.“
„Es ist kalt hier“, bemerkte Balian Roland. „Wie bekommt man hier Wärme, Mylord?“
„Europa ist im Winter kalt, mein Junge. Daran wirst du dich gewöhnen müssen. Zieh dich warm genug an! Feuerstellen gibt es nur im Rittersaal, in der Küche und in der Kemenate. Die Kemenate ist für die Frauen bestimmt. Dort hast du nichts zu suchen, verstanden?“, versetzte Henri.
„Wie Ihr wünscht, Mylord“, bestätigte der Junge.
„Schon gut. Und jetzt mach dich an die Arbeit!“, befahl der Baron. Sein Neffe verbeugte sich abermals, Henri schloss die Tür von außen und ließ ihn allein.
Einige Stunden später hatte er den Stammbaum fertig. Darin hatte er auch die Ehefrauen seines Vaters und seiner Onkel aufgeführt – einschließlich deren Geburtsnamen. Henri betrachtete den Stammbaum.
„Sag mal, Balian, haben eigentlich alle, die mit den ersten Rittern des Kreuzes nach Jerusalem kamen, eigene Lehen bekommen und die Namen ihrer Vorfahren abgelegt?“, fragte er nach einer Weile. Ihm sagte kaum einer der Orte etwas – sah man von Jerusalem ab.
„Nun, soviel Vater mir sagte, hat der König von Jerusalem sein Reich nach der Befreiung von den Heiden ebenso in Lehen aufgeteilt wie es wohl der König von Frankreich auch getan hat. Es sind alle Lehen an Ritter vergeben worden, die dorthin kamen und sich bewährten. Ob es für jeden gilt, der ins Heilige Land kam, das weiß ich nicht. Aber es leben mehr Christen im Königreich Jerusalem und den anderen Kreuzfahrerlanden, als es dort Lehen gibt“, erwiderte Balian.
„Kennst du die ursprünglichen Namen der Familien, die du im Stammbaum aufgeführt hast?“
„Bei der Familie meines Großvaters und meiner Mutter schon, bei seinem Onkel und den direkt aus Frankreich stammenden Vorfahren weiß ich es nicht“, antwortete der Junge.
„Dann ändere den Namen deiner Mutter auf deren Geburtsnamen“, wies er Balian an. „Äh … was ist das denn? Dein Onkel Balduin hat seine Ehe auflösen lassen? Wie geht das denn? Eine Ehe ist doch unauflöslich!“, hakte er nach, als er die Notiz dazu las.
„Ich muss bekennen, Mylord, dass ich den Grund nicht kenne. Ich weiß nur, dass es so ist“, erwiderte Balian Roland.
„Was für ein Sündenpfuhl! Und das ist Gottes eigenes Königreich!“, entfuhr es Henri. „Na gut“, seufzte er dann, „schreib die ursprünglichen Namen dazu, soweit sie dir bekannt sind.“
„Wie Ihr wünscht, Mylord.“
„Für den Sohn eines wahrhaftigen Barons bist du sehr unterwürfig“, bemerkte Henri mit leisem Spott.
„Wie gesagt: Ich soll Euch gehorsam sein und möchte Euch nicht verärgern.“
„Aha. Und nun mach dich an die Arbeit!“
Einige Zeit später hatte Balian Roland die alten Namen der Familien in seiner Verwandtschaft ergänzt, soweit er sie kannte. Henri prüfte den Stammbaum erneut, als sein Neffe ihm das Ergebnis vorlegte.
„Holla, dein Vater und dein Onkel haben jeweils eine Tochter von Guermont von Bethune geheiratet. Und der war mit Adele aus dem Hause Brisebarre verheiratet. Jetzt wundert mich die Eheauflösung nicht mehr! Junge, die Bethunes und die Brisebarres von Meaux sind mit uns Puisets so nahe verwandt, dass beides Blutsverwandtenehen waren!“, stieß Henri hervor. „Solche Ehen sind von der Kirche ausdrücklich verboten und hätten nie geschlossen werden dürfen. Eine Ehe, die gar nicht geschlossen werden darf, ist ungültig – mit der Folge, dass Kinder, die aus einer solchen Ehe stammen, nicht als eheliche Kinder gelten. Du bist durch deinen Vater zwar mein Großneffe, aber nach französischem Recht bist du ein Bastard; schließlich herrschen hier zivilisierte Verhältnisse. Ein Bastard kann nach unseren Regeln kein Ritter werden, jedenfalls nicht ohne außergewöhnliche Leistungen und Verdienste. Deshalb werde ich keinesfalls zulassen, dass du weiter zum Ritter ausgebildet wirst! Und ich werde dich nicht länger unter meinem Dach dulden! Du wirst – solange du hier bist – für deinen Lebensunterhalt arbeiten. Kannst du noch was anderes außer lesen und schreiben?“
Balian Roland war geschockt, das war ihm anzusehen. Die Worte seines Onkels verschlugen ihm die Sprache.
„Ich habe dich was gefragt! Antworte!“, forderte Henri ihn nachdrücklich auf.
„Ja, ich … ich habe schon mal … ge… geschmiedet“, presste er mit schwacher Stimme heraus. „Vater meinte, dass es besser wäre, wenn ich auch was Praktisches lerne“, erwiderte er.
„Dann pack deine Sachen! Auf der Stelle! Du gehst zu Meister Balian in die Schmiede!“
Wortlos nickt der Junge, verbeugte sich und verließ zutiefst getroffen den Rittersaal.
Wenig später kehrte er in den Rittersaal zurück, wo vor seinem Onkel ein kräftiger Mann stand, der mit einer fleckigen braunen Lederschürze über einer ursprünglich schwarzen Gugel, grauem Hemd und grauer Hose bekleidet war. Er war groß und breit, hatte dunkles Haar, in das sich die ersten grauen Sprenkel mischten, trug einen kurzen dunklen Bart, der eher durch seltene Gelegenheit zur Rasur entstanden zu sein schien, als dass er gezielt gezüchtet war. Der Mann hatte ebenso kräftige wie schmutzige Hände. Baron Henri präsentierte mit der rechten Hand zu seinem Neffen.
„Balian, das ist dein neuer Lehrling: Mein unehelicher Neffe Balian Roland, der einige Zeit hier ist, um die Lande seiner Vorfahren zu besuchen. Als Bastard kann ich ihn nicht in meiner Burg dulden. Er wird bei dir Schmied lernen. Bring ihm bei, was du weißt!“
„Wie Ihr wünscht, Mylord“, erwiderte Balian. Er sah den Jungen an.
„Wie alt bist du?“, fragte er.
„Sechzehn.“
„Schon mal geschmiedet?“
„Ja.“
„Komm mit!“
Mit dem Schmied verließ der Junge die Burg.
„Woher kommst du?“, fragte der Ältere.
„Aus dem Königreich Jerusalem“, erwiderte Roland.
„Was? Von dort kommt jemand hierher? Sonst verschwinden alle dorthin!“, wunderte sich Balian. Der jugendliche Überseefranzose zuckte mit den Schultern.
„Vielleicht bin ich eine Ausnahme“, sagte er. Der Schmied lächelte.
„Das hoffe ich! Ich brauche nämlich einen Gesellen“, sagte er. „Was hast du schon geschmiedet und wer hat es dich gelehrt?“
„Ich habe Messer und Schwertklingen gemacht, auch ein Beil, als ich sehr wütend war. Gelernt habe ich bei Amir, einem muslimischen Gefangenen, den mein Vater freikaufte und der bei uns blieb, obwohl er hätte gehen können“, erwiderte der Junge.
„Wer ist dein Vater?“
„Balian von Ibelin.“
„Nie gehört. Äh … von? Bist du etwa adlig?“, wunderte sich der Schmied. Sein neuer Lehrling zuckte erneut mit den Schultern.
„Ja. Das heißt: Das dachte ich jedenfalls bis heute Mittag.“
„Wieso?“
„Mein Vater schickte mich her, weil mein Onkel, der Baron, mich weiter zum Ritter ausbilden sollte. Er war wohl anfangs auch einverstanden, aber dann wollte er unseren Stammbaum sehen. Ich habe ihm das auch aufgeschrieben. Dann meinte er, mein Vater sei mit meiner Mutter nicht richtig verheiratet gewesen. Es sei eine Verwandtenehe gewesen. Dann hat er mich als unehelich bezeichnet und mich aus dem Haus gewiesen“, erklärte Roland. Balian blieb abrupt stehen.
„Wie bitte?“, fragte er verstört.
„Soll ich es nochmal erklären?“
„Fast würde ich dich darum bitten“, schnaufte Balian. „Sag mal, wenn Henri du Puiset dein Onkel ist, bist du dann ein du Puiset?“
„Eigentlich schon, auch wenn mein Großvater Barisan diesen Namen abgelegt hat und sich nach seinem Lehen Ibelin im Königreich Jerusalem genannt hat“, erwiderte Roland.
„Wenn dein Onkel dich da oben in der Burg nicht haben will: Wieso gehst du dann nicht nach Jerusalem zurück?“
Erneutes Schulterzucken des Jungen.
„Wovon? Von dem Geld, das mein Vater mir mitgab, habe ich mehr als die Hälfte für die Reise hierher ausgeben müssen. Was ich noch habe, würde nicht genügen, um die Rückreise zu bezahlen“, sagte er. „Außerdem … es gibt noch einen anderen Grund, weshalb ich erst einmal nicht zurück kann.“
„Und der wäre?“, hakte der Schmied nach. Balian Roland erzählte ihm, weshalb er das Heilige Land verlassen hatte und auch nicht zurückkehren konnte. Schmied Balian seufzte.
„Und ich habe solchen Unfug für Märchen gehalten! Das gibt’s ja wirklich!“, entfuhr es ihm. „Äh, da wäre noch was: Du heißt ja auch Balian, aber es gäbe Verwechslungen. Bist du einverstanden, wenn meine Familie und ich dich Roland nennen?“
„Ja, gerne. Zuhause werde ich auch so genannt, weil mein Vater ebenfalls Balian heißt.“
Sie kamen an der Schmiede an. In der Esse brannte ein Feuer, aber es war kurz davor, auszugehen.
„Also, Roland. Du sagst, du hast schon mal geschmiedet. Dann kannst du ja mit der Esse umgehen. Was musst du tun, um jetzt zu schmieden?“, fragte Balian.
„Wenn Ihr mir sagt, was ich schmieden soll, muss ich mir aus Euren Rohlingen einen passenden heraussuchen, die nötigen Zangen zur Hand nehmen, das Feuer mit Luftzufuhr heißer machen und das Schmiedestück in die Esse legen, bis es warm genug ist, um bearbeitet zu werden“, antwortete Roland.
„Das ist richtig. Was ist ein Hammerkuss?“
„Das ist eine Prüfung, ob ein neuer Arbeiter oder Lehrling genug Kraft hat, um das Schmiedehandwerk auszuüben.“
„Wie wird der Hammerkuss gemacht?“
„Der Prüfling nimmt einen schweren Hammer, hält ihn am ausgestreckten Arm und lässt ihn mit geradem Arm auf den Amboss herunter, berührt den Amboss nur ganz sanft und hebt ihn wieder am ausgestreckten Arm hoch“, gab Roland sein Wissen wieder.
„Ja, sehr gut“, lobte Balian. „Nimm den Hammer da und gib dem Amboss den Hammerkuss!“
Roland griff zu dem bezeichneten Hammer, einem wenigstens zwanzig Pfund schweren Werkzeug, hob ihn mit ausgestreckten rechtem Arm hoch und ließ ihn langsam am ausgestreckten Arm herunter, bis er den Amboss erreicht hatte, berührte ihn kurz und hob ihn wieder in die Waagerechte.
„Sehr gut! Du hast nicht geschwindelt. Und Kraft hast du auch. Hast du schon mal ein Mauereisen geschmiedet?“, sagte Balian anerkennend.
„Nein, aber wenn Ihr mir sagt, wie es aussehen soll, mache ich das.“
Balian griff in eine hölzerne Tonne und holte ein fertiges Mauereisen heraus. Es handelte sich um ein etwa zwei Finger breites Metallstück mit einer Gesamtlänge von etwa zwei Ellen*, das an beiden Enden jeweils um neunzig Grad gebogen war – auf einer Seite nach oben, auf der anderen nach unten. Beide umgebogenen Teile hatten etwa eine Spanne Länge. Solche Eisen dienten dazu, eine Mauer zu stabilisieren.
„So sieht es aus. Nimm dir einen Rohling und schmiede ihn so!“, wies er seinen neuen Lehrling an. Roland nahm seinem Lehrmeister das Stück ab, maß die Länge mit seinen eigenen Händen und der linken Elle – gemessen zwischen der Handwurzel und dem Ellenbogen – nahm sich einen Rohling, markierte mit einem Dorn die Stelle, die später die Biegung sein sollte und schob ihn in die Esse, heizte diese mit dem Blasebalg an, bis das Ende rotglühend war. Dann nahm er es heraus und schlug ab der markierten Stelle das Eisen um die rechteckige Seite des Ambosses. Dann kühlte er das glühende Eisen in einem Wasserbottich, legte ihn wieder auf den Amboss, nahm das bereits umgebogene Ende mit der passenden Zange, schob das Eisen wieder in die Esse, heizte sie nochmals hoch und schmiedete das andere Ende in der entgegengesetzten Richtung. Als er es abgeschreckt hatte, nahm Balian das Eisen in Augenschein.
„So, so … Lehrling …“, brummte er. „Du wirst nicht lange brauchen, bis ich dich zum Gesellen freisprechen kann“, sagte er mit einem Augenzwinkern. Einen größeren Gefallen, als ihm diesen talentierten Jungen zur Seite zu stellen, hatte sein Herr ihm gar nicht tun können.
Kurz vor Einbruch der Dunkelheit löschten Meister und Lehrling das Schmiedefeuer und verließen die Schmiede, die weitgehend offen war. Der ganze Bau war etwa vier bis fünf Klafter lang und zwei Klafter breit. Nur an den beiden Schmalseiten waren Fachwerkmauern – Holzfachwerk, das mit Lehm ausgekleidet war, das mit Stroh vermischt worden war – die von hölzernen Windschutzwänden von etwa einem Klafter Länge ergänzt wurden. Die übrigen Längsseitenteile waren offen, nur mit starken Balken gestützt, zwischen denen Holzstangen ermöglichten, etwas abzulegen oder Pferde für den Ersatz von Hufeisen anzubinden.
Meister und Lehrling verließen die Schmiede, überquerten einen breiten Weg und durchquerten gegenüber ein fast baugleiches Haus, doch waren die Seitenwände bis auf einen Durchgang von etwa einem Klafter Breite ebenfalls aus Fachwerk. Hier befand sich links vom Durchgang ein Hühnerstall, rechts grunzten drei Schweine in ihrem Koben. Als sie den Durchgang hinter sich gelassen hatten, erwies sich, dass es sich bei dem Bau um einen Dreiseithof handelte, einen Hof, der an drei Seiten von Gebäuden umschlossen wurde. Rechts vom Durchgangshaus lag ein mit dem Haupthaus verbundenes Fachwerkhaus, das wie das Durchgangshaus und die Schmiede einstöckig war. Das Haupthaus war ein praktisch doppelt so hohes Haus, das in der unteren Hälfte gleichfalls aus Fachwerk gebaut war, in der oberen Hälfte aber aus Holz. Gedeckt war es – wie alle anderen Häuser in Saint-Martin-au-Bois – mit Stroh.
Für die eher ärmlichen Verhältnisse des Dorfes war es ein großzügiges Anwesen, das verriet, dass Meister Balian jedenfalls innerhalb des Dorfes nicht als armer Mann zu gelten hatte. Balian ging voraus und öffnete die hölzerne Tür.
„Julie! Natalie! Michel!“, rief er in das Haus und trat ein. „Kommt her! Wir haben ein neues Familienmitglied!“
Während im Haus Bewegung entstand und die Familienmitglieder zur Tür kamen, hatte Roland Gelegenheit, sich umzusehen. In der Tat: Für die ärmlichen Verhältnisse des Dorfes war es ein großes Haus, das etwa drei Klafter breit und fünf Klafter lang war. Die Höhe schätzte Roland mit etwa zwei Klaftern ein. Ein halbes Stockwerk unter dem Dach vergrößerte die Wohnfläche um die Hälfte. Unten im Haus war der Wohn- und Arbeitsbereich, oben befanden sich die Schlafplätze, die um den Schornstein des Hauses verteilt waren. Tatsächlich gehörte dieses Haus zu den wenigen, die überhaupt einen solchen Rauchabzug hatten. In der Regel zog der Rauch der Feuerstelle durch das nie ganz dichte Strohdach ab. Da die Feuerstelle vom Kochbereich des Erdgeschosses fast den ganzen Tag befeuert war, war der Bereich um den Kamin oben angenehm warm, was besonders in der kalten Jahreszeit wertvoll war.
Die Familie kam zusammen. Es war eine Frau, die etwa im selben Alter wie Balian war, ein Junge, der etwa ebenso alt war wie Roland und eine Tochter, die etwas jünger sein mochte als er.
„Dieser junge Mann hier ist Roland. Er wird bei mir als Geselle arbeiten“, verkündete der Schmiedemeister. „Roland, das ist meine Familie: Julie, mein geliebtes Weib; Michel, mein Sohn und Natalie, mein liebes Töchterlein. Meine Schmiede ist die einzige in allen sechs Dörfern. Das heißt, dass uns die Arbeit nicht ausgeht. Alle Metallarbeiten, die in diesen Dörfern anfallen, mache ich. Ich danke dem Herrn, unserem Gott, dass ich das ab heute nicht mehr allein bewerkstelligen muss, sondern dich hier als meinen Gesellen habe“, präsentierte der Meister. Roland verbeugte sich vor der Familie.
„Verzeiht, Meister Balian: Ihr habt einen Sohn. Habt Ihr ihn noch nicht in die Schmiedekunst eingeführt“, wunderte er sich. Balian machte ein trauriges Gesicht.
„Weißt du, Roland, Handwerk – und das ist die Schmiedekunst – erfordert dreierlei: Talent, Kraft und Interesse“, sagte er mit einem Seufzen. „Meinem Sohn geht alles davon ab. Er hat weder Interesse noch Talent oder Kraft. Deshalb wird er unserem Bischof als Priester dienen. Und eine Frau bringt leider nicht die nötige Kraft auf. Natalie hat es versucht. Sie hat Interesse, aber sie ist nicht stark genug, um den Hammer zu schwingen. Deshalb bin ich unserem Herrn geradezu dankbar, dass er dich nicht in seiner Burg behalten wollte – auch wenn ich es schrecklich finde, was dir widerfahren ist. Der Tag fängt hier früh an, denn wir haben viel zu tun. Geh also rechtzeitig schlafen.“
„So, du bist also Roland“, bemerkte Natalie. Sie war ebenso blond wie ihre Mutter und hatte auch deren blaue Augen. „Ich habe dich hier noch nie gesehen. Woher kommst du? Bist du aus Chartres?“
Roland lächelte sanft.
„Nein, Frau Natalie. Ich komme von sehr weit her“, erwiderte er.
„Dann bist du aus Paris oder gar Marseille?“
„Nein, noch etwas weiter. Aus Jerusalem.“
„Aus Je… Nein, das glaube ich nicht! Da mag unser Herr Jesus gewirkt haben; aber das ist doch nur eine fromme Legende!“, wehrte das Mädchen ab.
„Natürlich gibt es Jerusalem!“, widersprach Michel heftig. „Unser Herr Jesus ist keine Legende, Natalie! Er hat gelebt, ist für uns gestorben und auferstanden! Was faselst du da?“
Rolands Lächeln verstärkte sich, dass Natalie schon weiche Knie bekam.
„Euer Bruder hat Recht, Frau Natalie …“
„Roland: Wir sind einfache Menschen“, bremste Balian den höflichen Ton. „Unter uns einfachen Leuten sagt man du zueinander!“
Roland sah ihn verblüfft an.
„Ich soll Euch und die Euren duzen? Darf ich das?“, hakte er nach.
„Du magst adlig geboren sein, mein Junge, auch wenn unser Herr Henri das in seiner Hoffärtigkeit nicht akzeptieren will. Unter Adligen mag es üblich sein, sich so distanziert anzureden, unter uns einfachen Leuten ist es das nicht. Also: Ich bin Balian, meine liebe Frau ist Julie, mein Sohn Michel und meine Tochter Natalie – ohne irgendwelche hochgestochenen Zusätze“, präzisierte der Meister. Roland verbeugte sich.
„Ja, Meister“, erwiderte er. Balian rollte die Augen, bemerkte aber ein schalkhaftes Blitzen in den braunen Augen seines neuen Gesellen.
„Schlingel!“, grinste er. „Sag mal: Hast du schon mal Damaszenerklingen geschmiedet?“, fragte er.
„Ja, Meister. Amir hat es mich gelehrt.“
„Na, das will ich sehen!“
Kapitel 7
Meister Balians Geselle
Balian Roland von Ibelin nahm bei seinem Namensvetter die Arbeit auf. Dass er bezüglich der Damaszenerklingen nicht geschwindelt hatte, durfte der Meister schon am folgenden Tag feststellen. Mit vorhandenen Materialien fertigte Roland einen Dolch mit damaszierter Klinge, wie Meister Balian sie noch nicht gesehen hatte.
„Alle Achtung, Junge!“, platzte er heraus, als Roland ihm nach ungezählten Faltungen der aus unterschiedlich harten Eisenlegierungen zusammengeschweißten Lagen eine ebenso scharfe wie schöne Klinge präsentierte. „Du hast alles, was mein Sohn nicht hat: Interesse, Kraft und Talent. Ich danke Gott und meinem weltlichen Herrn, dass sie dich zu mir geführt haben! Wenn du es möchtest, dann werde ich den Zunftmeistern diesen Dolch als dein Gesellenstück vorlegen und dich freisprechen.“
„Es wäre mir eine Ehre, Meister“, erwiderte Roland mit einer Verbeugung.
Schon eine Woche später hatte Balian die Klinge bei der Schmiedezunft in Chartres zur Prüfung eingereicht, die Zunftmeister befanden sie für würdig, ein Gesellenstück zu sein und gaben ihm die Erlaubnis, Roland von Ibelin als seinen Gesellen freizusprechen. Mit ihm als Gesellen schaffte der Schmiedemeister die anfallenden Arbeiten viel besser, als er je gehofft hatte. Roland seinerseits fühlte sich in seiner Gastfamilie wohl – sah er von Michel ab, der ihn seine Ablehnung deutlich spüren ließ und sich lieber in der Kirche aufhielt als im Haus der Familie.
Der harte europäische Winter, der ab November einsetzte, machte nicht nur dem mit diesen Temperaturen unerfahrenen Roland zu schaffen. Auch die Familie des Schmieds litt unter der Kälte des Winters. Roland beglückwünschte sich durchaus, dass sein Onkel ihn nicht in der Burg hatte haben wollen. Bei der Schmiedefamilie gab es wenigstens einen geheizten Schlafraum, den er in der Burg nicht gehabt hätte. Doch die hauptsächlich offene Schmiede machte ihm trotz des Feuers arg zu schaffen. So etwas wie Schnee kannte der Junge bisher nur aus Erzählungen seines Vaters, der schon das Taurus-Gebirge gesehen hatte, dessen Spitzen schneebedeckt waren. Doch Schnee so tief unten, das war für den jungen Überseefranzosen eher etwas aus der Märchenwelt.
Die Fastenzeit im Advent war für ihn besonders hart. Er kannte Orangen, Feigen, Datteln, Zitronen, Zimt und andere Gewürze, mit denen im Orient Speisen bereichert wurden. Der einfach europäische Speisezettel, der wenig mehr als Brot, Getreidebrei mit ein paar getrockneten Früchten wie Erdbeeren oder Himbeeren sowie Pilze beinhaltete, war ihm gänzlich fremd. Auch im Orient verzichtete der gläubige Christ in der Fastenzeit auf Fleisch, aber die europäische Kost war extrem einseitig.
Als er sich noch vor dem Advent erbot, auf die Jagd zu gehen, um den Speisezettel zu bereichern, schüttelte Balian den Kopf.
„Das dürfen wir nicht, Roland“, sagte er. „Die Jagd ist ein Vorrecht des Adels. Wir einfachen Menschen dürfen nicht mal die Kaninchen jagen, die unsere Gemüsegärten abfressen, geschweige denn Rehe oder gar Hirsche jagen.“
„Nun, eigentlich bin ich ja adlig und müsste jagen dürfen. Aber wenn du darauf bestehst, frage ich zunächst meinen Onkel“, erwiderte Roland. Der Schmiedemeister seufzte.
„Das kannst du natürlich tun. Aber ich glaube nicht, dass er es dir erlaubt“, entgegnete er.
Noch am selben Tag ging er zur Burg und bat darum, seinen Onkel zu sprechen. Er bekam sogar umgehend Audienz.
„Was willst du? Jagen? Du bist wohl von allen guten Geistern verlassen!“, fuhr Henri ihn an.
„Nun, Ihr mögt mich als illegitimen Sohn meines Vaters betrachten, aber das ändert doch erst einmal nichts daran, dass ich in eine adlige Familie geboren wurde. Ich habe sechzehn Jahre meines Lebens als Adliger gelebt und auch die Jagdkunst erlernt. Warum sollte ich der Familie, bei der ich lebe, nicht mit dieser Kunst helfen dürfen?“, fragte Roland.
„Da fragst du noch? Du bist nach französischem Recht ein Bastard. Du hast hier keinerlei Rechte, schon gar kein Jagdrecht, das hierzulande allein dem Adel vorbehalten ist. Pack dich fort!“, donnerte Henri.
„Ihr mögt meine eheliche Abkunft nicht akzeptieren. Aber das ändert doch nichts daran, dass mein Vater und meine Mutter von Adel sind und ich entsprechend erzogen wurde. Ich habe die Jagd erlernt, Onkel Henri!“
„Es ist nicht die Frage, ob du etwas erlernt hast, sondern ob es dir gestattet ist! Und es ist auch nicht die Frage, ob du in einem anderen Land gewisse Rechte hast. Hier hast du diese Rechte nicht, und ich gestatte die Jagd in meiner Baronie nur Adligen, die nach französischem Recht ehelich geboren sind. Mache ich bei dir eine Ausnahme, habe ich morgen das ganze Bauernpack mit einer solchen Forderung am Hals! Kommt nicht infrage! Raus mit dir!“, wetterte der Baron.
Es blieb also bei der kargen europäischen Winterkost.
Kurz vor Weihnachten kam Michel von einer Reise mit dem Bischof mit einer üblen Erkältung nach Saint-Martin-au-Bois zurück. Er nieste und hustete fürchterlich und gab sich auch keine Mühe, das, was er ausschnupfte oder –hustete von seiner Familie fernzuhalten.
„Du solltest dich besser umdrehen, wenn du niesen oder husten musst“, bemerkte Roland kopfschüttelnd, als Michel beim Essen husten musste und Natalie den Brei, den er gerade vom Löffel zu sich genommen hatte, auf dem Kleid hatte.
„Halt den Mund, Bastard!“, schnauzte Michel und bekam von seinem Vater eine schallende Ohrfeige.
„Roland hat Recht, du Rotzlöffel!“, fuhr er ihn an. „Man prustet sein Essen nicht auf sein Gegenüber! Wir sind einfache Menschen, wir schwimmen nicht im Geld! Wir besitzen nicht so viel Kleidung, dass wir sie außer der Reihe waschen können! Also, halte an dich!“
„Ich bin krank, Vater!“, jammerte Michel. Balian holte aus und wollte ihn erneut schlagen, aber Julie stoppte ihren Mann.
„Balian! Lass das! Er hat Recht. Er ist krank! Mit Schlägen ist noch keiner gesund geworden!“, mahnte sie. Grummelnd ließ der Schmiedemeister die erhobene Hand sinken.
„Gibt es hier Weiden, Fenchelsamen und Salbei?“, fragte Roland.
„Wozu?“, fragte Julie.
„Als wir herkamen, habe ich mich auch schlimm erkältet. Bruder Jean, der die Johanniter führte, hat mir aus Weidenrinde, Fenchelsamen und Salbei eine Suppe gemacht. Das hat mir sehr geholfen, und ich war drei Tage später wieder fast gesund. Sie schmeckt nicht besonders gut, aber mit etwas Honig könnte sie besser werden“, erklärte der Junge.
„Weiden gibt es hier – unten an der Eure. Aber von den anderen Dingen habe ich noch nie etwas gehört, Roland“, erwiderte Julie.
„Gibt es denn hier niemand, der etwas von Kräutern versteht“, wunderte er sich.
„Doch, die alte Madeleine“, erwiderte Natalie. „Sie lebt in Bonville am Waldrand.“
„Wenn du erlaubst, Meister, werde ich zu ihr gehen und sie nach solchen Kräutern fragen“, wandte Roland sich an den Schmied.
„Ich traue der alten Hexe nicht, mein Junge. Außerdem verlangt sie Geld – viel Geld“, warnte der.
„Was heißt viel Geld, Meister?“
Balian zuckte mit den Schultern.
„Ich weiß nicht, woher du zehn Deniers* bekommen willst“, brummte der Schmied. Roland lächelte sanft.
„Ich kann die Rückfahrt nach Jerusalem nicht bezahlen, Meister, weil ich für die Reise hierher fünfhundert Besant* bezahlen musste und mein Vater mir insgesamt achthundert Besant mitgegeben hat. Aber von dem verbleibenden Geld kann ich die Kräuter bezahlen“, sagte er. Balian bekam große Augen.
„Wie viel? Junge, was ist ein Besant?“, fragte er. Roland stand auf und holte aus seiner persönlichen Truhe, die Julie ihm gegeben hatte, einen ziemlich schweren Sack, aus dem er eine Besant-Münze herausnahm. Sie glänzte golden.
„Ist … ist das etwa … Gold?“, stotterte Michel mit begehrlichem Blick.
„Ja, teilweise. Bei uns in Jerusalem ist dies das übliche Zahlungsmittel. So ein Besant besteht aus sieben Teilen Gold und einem Teil Silber.“
Balian nahm Roland die Münze geradezu ehrfürchtig ab.
„Ziemlich schwer für die Größe. Komm mal mit!“, forderte er seinen jungen Gesellen auf und ging mit ihm die Schmiede. Dort hatte er eine Handwaage, mit der er das Silber für die von ihm hergestellten Kelche und Becher abmaß, um den Silberwert für den Zehnt angeben zu können. Auf die eine Seite der Waage legte er die Besant-Münze, auf die andere Denier-Münzen, die aus Silber bestanden. 240 Deniers ergaben ein französisches Pfund, das der Livre* entsprach. 12 Deniers ergaben 1 Sou, 20 Sou 1 Livre.
Bei zwei Deniers war der Besant schwerer, bei drei Deniers die Seite mit den Silbermünzen.
„Etwas zwischen zwei und drei Deniers“, brummte Balian. „Und du sagst, dass sieben Teile davon Gold und ein Teil Silber sind, ja?“
„Stimmt“, bestätigte Roland.
„Gold ist hier zwölfmal so viel wert wie Silber. Dein Besant ist etwa zweieinhalbmal so schwer wie ein Denier. Wäre er vollständig aus Silber, wäre er also zweieinhalb Deniers wert. Wäre er komplett aus Gold, wäre er einundfünfzig Deniers wert. Ein Achtel davon ist aber Silber. Ein Achtel von einundfünfzig sind etwas mehr als sechs. Die müssen wir abziehen, bleiben noch fünfundvierzig Deniers. Berücksichtigen wir das Silber, ziehen wir glatte sechs ab. Macht fünfundvierzig oder drei dreiviertel Sou. Fünf deiner Goldmünzen und ein Drittel davon machen ein Livre aus. Oder sechzehn Stück drei Livre“, rechnete Balian. „Das ist viel Geld, mein Junge. Bist du wirklich bereit, das für die Kräuter auszugeben, um meinem Sohn zu helfen?“
Roland sah den Meister verblüfft an.
„Meister, vergebt mein Erstaunen, doch wusste ich nicht, dass einfache Menschen in Frankreich so gebildet sind, dass sie diese Mathematik beherrschen“, entfuhr es ihm. Balian seufzte.
„Dass Bildung ein Privileg des Adels sein sollte, diesen Unfug habe ich hier ja schon häufig gehört. Aber dass das auch in der Neuen Welt in Outremer* verbreitet ist, habe ich nicht gewusst. Offensichtlich haben die Kreuzritter ihre Standesdünkel gleich mitgenommen. Aber mit Übeln ist es wie mit Freude: Geteilt wird mehr daraus. Ihr da hinter dem Meer glaubt also, dass wir hier noch Grunzlaute von uns geben und uns in Felle kleiden, was?“, versetzte er. Roland lächelte sanft.
„Ich bitte um Entschuldigung für meine unbedachten Worte. Ja, es gibt solche Gerüchte bei uns. Und ich danke Euch, dass Ihr mich eines Besseren belehrt habt, Meister“, erwiderte er. Balian musste schmunzeln. Er schlug seinem Gesellen kräftig auf die Schulter.
„Hahaha! Junge, du gefällst mir!“, lachte er. „Du bist sehr diplomatisch. Deine Eltern haben dich gut erzogen. Aber soll ich dir etwas sagen?“
„Meister?“
„Wenn unsere hohen Herren keine Diener aus dem einfachen Volk hätten, wenn sie nicht die Geistlichen hätten, die schreiben, lesen und rechnen können, stünden sie ziemlich dumm da. Die meinen nämlich, dass es unter ihrer Würde sei, selbst zu schreiben, selbst etwas zu lesen oder gar auszurechnen. Baron Henri selbst ist eher eine Ausnahme. Der Mann kann lesen und schreiben. Sein Sohn kann es nicht und will es auch nicht. Armand hält das für überflüssigen Ballast. Aber wir Handwerker, die wir unsere hergestellten Dinge auch verkaufen, die Händler – alles Menschen aus dem einfachen Volk – wir müssen lesen, schreiben und rechnen können, sonst könnten wir unseren Beruf gar nicht ausüben. Denk mal drüber nach.“
„Das werde ich, Meister.“
„Und du willst wirklich dein Geld für so einen Bengel wie den meinen opfern?“, hakte der Schmied nach.
„Wenn ich damit helfen kann, ja.“
Balian sah ihn eine Weile an.
„Ich wünschte, du wärst mein Sohn. Michel ist ein trotziger Nichtsnutz. Irgendwas muss ich falsch gemacht haben, weil er sich so gar nicht für mein Handwerk interessiert. Aber er hat auch kein Talent. Was mache ich nur mit ihm?“
„Ihr …“
„Habe ich dir nicht gesagt, dass du mich duzen sollst?“
„Doch. Dennoch scheint es mir nicht angemessen. Ihr seid mein Meister“, erwiderte Roland. Balian schmunzelte.
„Ja, aber nicht dein Herr“, entgegnete er. „Wir sind – solange du hier bist und für mich arbeitest – gleich. Wenn du wieder zu Hause bist und dein adliges Leben führen kannst, mag das anders sein. Aber dann bist du höher gestellt als ich und werde Ihr zu dir sagen müssen. Dann kann ich nur hoffen, dass du mich überhaupt noch kennst.“
Der Junge lächelte auf eine schier unnachahmliche Weise, der fast niemand widerstehen konnte.
„Ich werde dich nicht vergessen – und auch deine Familie nicht, Meister Balian. Ich bin adlig geboren, auch wenn mein Onkel das heftig bestreitet. Im Königreich Jerusalem gelten vielleicht andere Gesetze als hier in Frankreich. Wäre mein Großvater hiergeblieben, hätte er sich einem anderen Adligen als Ritter verdingen müssen oder die geistliche Laufbahn einschlagen müssen. Wäre er Priester geworden, dann gäbe es weder meinen Vater und seine Brüder noch mich und meine Schwester – jedenfalls nicht als Nachkommen der Familie du Puiset.
Unser Schmied Amir, der mich die Schmiedekunst gelehrt hat, ist ein Sarazene. Amir ist kein Adliger. Er war ein einfacher Fußsoldat von Sultan Nur ad-Din, bis er in Gefangenschaft geriet, aus der mein Vater ihn freikaufte und ihm erlaubte, nach Damaskus heimzukehren. Doch er arbeitet noch immer für meinen Vater, weil er meint, ihm das schuldig zu sein. Von ihm habe ich außer dem Handwerk auch Dankbarkeit und ein Gefühl für Pflichterfüllung gelernt. Deshalb, Meister Balian, werde ich weder dich noch deine Familie vergessen – und schon gar nicht, dass ihr mich aufgenommen habt, als mein Onkel zu hoffärtig war, um mich als seinen Neffen zu behandeln“, erklärte er. Balian konnte die Tränen, die ihm in die Augen schossen, nicht zurückhalten.
„Es wäre schön, wenn es mehr Adlige wie dich gäbe, mein Junge“, sagte er mit brüchiger Stimme.
Am folgenden Morgen ging Roland in das einige Meilen entfernte Dorf Bonville. Die alte Madeleine empfing den Jungen mit einem misstrauischen Blick.
„Wer bist du und was willst du?“, fragte sie.
„Ich bin Roland, Meister Balians Geselle. Ich komme, um Kräuter zu kaufen“, antwortete er.
„Kräuter? Wofür?“
„Der Sohn meines Meisters ist krank. Ich möchte ihm eine Suppe machen, die mir ein Johanniter gemacht hat, um mich von der gleichen Krankheit zu heilen“, erwiderte er.
„Balians Sohn? Michel?“
„Ja.“
Die alte Frau seufzte.
„Ich gebe dir die Kräuter, denn ich sehe in deinen Augen, dass du ein gutes Herz hast. Doch ich fürchte, du wirst es bereuen“, sagte sie. Welche Kräuter benötigst du?“
„Weidenrinde, Fenchelsamen und Salbei. Wieso?“
„Wie lange bist du schon bei Meister Balian?“, fragte sie, während sie ihre Kräutersträuße und Tiegel durchging und Samen und getrocknete Blätter zusammensuchte.
„Seit ein paar Wochen“, sagte Roland.
„Dann kennst du dieses Früchtchen wohl noch nicht gut genug, um ihn in die Hölle zu wünschen. Balian ist ein liebenswürdiger Mensch, seine Frau Julie auch. Natalie ist ein liebes Mädchen. Aber Michel? Der passt nicht in die Familie. Der ist eher wie dieser Lümmel Armand, der Sohn unsere Barons. Der könnte eher mit dem verwandt sein als mit deinem Meister. Ich habe dich noch nie gesehen, obwohl du mir irgendwie bekannt vorkommst. Woher kommst du?“
„Aus Jerusalem“, antwortete er. Die Alte lachte meckernd.
„Junge, du machst Scherze!“, wehrte sie ab.
„Nein, leider nicht“, entgegnete er. „Mein Vater schickte mich zur Erziehung her.“
Madeleine sah ihn durchdringend an.
„Hergeschickt? Aus Jerusalem? Ist dein Vater von hier?“
„Nicht direkt. Mein Großvater ging als junger Mann von hier auf den Kreuzzug und blieb in Jerusalem. Mein Vater wurde in Jerusalem geboren wie ich auch.“
„Wer ist dein Großvater?“
„Weshalb interessiert dich das?“
„Ich bin eine alte Frau – so alt, dass ich als junges Mädchen den Aufbruch von Hugo und Barisan du Puiset und ihrer Gefolgsleute nach Jerusalem noch mit eigenen Augen gesehen habe. Barisan war damals siebzehn Jahre alt. Du musst etwa im gleichen Alter sein – und du bist ihm schier aus dem Gesicht geschnitten. Ist Barisan dein Großvater?“
„Ja.“
Madeleine nickte.
„Das erklärt das gute Herz, das dir aus den Augen leuchtet. Hugo, der Großonkel des jetzigen Vizegrafen von Chartres, war ein Tunichtgut. Sein Cousin Barisan war anders: edelmütig, aber bescheiden. Er kam eher nach der Mutter Agnes, einer geborenen de Blois. Du scheinst mir aus dem gleichen Holz geschnitzt zu sein.“
Roland wurde rot. Er wollte sich nicht mit etwas brüsten, was in Frankreich nicht sein Recht war – jedenfalls nach den Vorstellungen seines Onkels. Aber er wollte auch nicht lügen.
„Ja, das bin ich“, sagte er. Die alte Frau nickte erneut.
„Dass ich es noch erleben darf, dass ein Adliger nicht mit seinem Adel protzt, ist ein Wunder Gottes. Ich hoffe, du bleibst hier und beerbst deinen Onkel – und nicht dieser Lümmel Armand. Aber wieso bist du bei Meister Balian und nicht bei deinem Onkel?“
Roland seufzte.
„Mein Onkel sagt, dass meine Eltern zu nahe miteinander verwandt sind und deren Ehe deshalb nicht gültig ist. Er sagt, ich sei deshalb unehelich, ein Bastard. Deshalb wollte er mich nicht in seiner Burg haben und hat mich zu Meister Balian geschickt, weil ich zu Hause schon Schmied gelernt hatte.“
„Na, das sagt der Richtige!“, kicherte die Kräuterfrau. „Hüpft mit jeder Frau ins Bett, die nicht bei drei auf dem nächsten Baum ist, hat mehr uneheliche Kinder als jeder Barbar und schimpft den Enkel des edelsten du Puiset einen Bastard!“
„Entschuldigung, du meinst, Baron Henri könnte Michels Vater sein?“, hakte Roland nach.
„Was sagt dir der Begriff jus prima noctis?“, fragte Madeleine.
„Das Recht der ersten Nacht, wenn mich meine Lateinkenntnisse nicht täuschen. Wieso?
„Weißt du auch, was das bedeutet?“
„Nein.“
„Es ist das vermeintliche Recht, auf das sich Grundherren hierzulande gerne berufen. Es heißt, dass sie bei einer Hochzeit eines ihrer Untertanen das Recht haben, als Erster mit der Braut zu schlafen. Nicht wenige Bräute werden deshalb nicht von ihrem Ehemann, sondern von ihrem Grundherrn erstmals schwanger. Als Balian und Julie heirateten, war es nicht anders. Henri war deren Herr. Er verlangte Julie, bevor Balian sie berühren durfte. Michel ist das ältere Kind von Julie. Es würde mich nicht wundern, wenn er gar nicht Balians Sohn wäre, sondern Henris“, erklärte sie. „Aber ich habe dir das nicht gesagt, verstanden?“, ergänzte sie.
„Nein, ich werde es nicht erwähnen“, versprach Roland. Madeleine lächelte.
„Du bist Barisans Enkel! Gott segne dich, Roland du Puiset.“
Jetzt war es Roland, der charmant lächelte.
„Nein, Roland von Ibelin. Aber ich habe es dir nicht gesagt, verstanden?“, erwiderte er. Sie nickte mit verstehendem Schmunzeln und gab die Kräuter in ein Stoffsäckchen, das sie Roland überreichte.
„Was bin ich dir für die Kräuter schuldig?“, fragte er.
„Gib mir fünf Deniers.“
„Nimmst du auch diese hier?“, fragte Roland und zeigte ihr einen Besant. „Meister Balian meint, dies sei fünfundvierzig Deniers wert, aber ich habe nichts anderes.“
„Das ist Gold, Roland!“, keuchte Madeleine. „Das ist neunmal so viel, wie ich haben will. Das kann ich nicht annehmen, denn ich kann dir keine vierzig Deniers zurückgeben.“
„Dann nimm es und behalte den Rest.“
„Nein, das geht nicht. Niemand wird mir glauben, dass ich eine solche Münze durch einen Verkauf bekommen habe. Man wird glauben, ich hätte es gestohlen“, wehrte sie ab.
„Und was machen wir jetzt? Ich kann die Kräuter doch nicht annehmen, ohne zu bezahlen.“
„Dann versprich mir, dass du mir die fünf Deniers bezahlst, sofern du entsprechende Münzen hast und bemühe dich, sie zu bekommen“, sagte sie. Er lächelte.
„Das werde. Ich verspreche es.“
Kapitel 8
Verbotenes Tun
Mit den Kräutern kehrte Roland nach Saint-Martin-au-Bois zurück. Als er das Wohnhaus des Schmieds betrat, hustete nicht nur Michel, sondern auch Julie. Schniefend begrüßte sie ihn.
„Was hast du dafür bezahlt?“, fragte sie, als sie die ansehnliche Menge Weidenrinde, Fenchelsamen und Salbei sah.
„Erst einmal noch nichts, weil Madeleine die Goldmünze nicht annehmen wollte, die ich ihr geboten habe“, erwiderte Roland. „Sie meinte, ihr würde keiner glauben, dass sie sie durch Handel erworben hat. Ich schulde ihr fünf Deniers und werde sie bezahlen, sobald ich das Geld habe.“
„Du bist der Erste, dem sie Kredit gibt. Erweise dich ihres Vertrauens würdig, Roland“, sagte Balian.
„Das werde ich, Meister“, lächelte Roland und machte sich daran, den Kräutertee zu kochen. Als das Wasser kochte, gab er die Kräuter hinein, ließ sie eine Weile sprudelnd kochen. Ein angenehmer Duft verbreitete sich in Balians Haus.
Es war längst Herbst, das Wetter meist trüb und nass, doch an diesem Tag schien die Sonne. Tief, wie sie stand, fiel sie auch in das Schmiedehaus. Roland beobachtete den Lauf der Sonne an der Wanderung eines Schattens und fischte die Kräuter nach einer Zeit, die er am Sonnenstand ablas, aus dem Kessel, schöpfte für Julie und Michel jeweils eine Schüssel voll, gab noch einen Löffel Honig dazu und rührte um.
„Bitte“, sagte er und servierte beiden die Schüsseln mit dem Kräutertee. „Wenn du erlaubst, gieße ich die Suppe in den Krug hier. Dann müsst ihr sie nur auf dem Herd warm machen.“
„Roland, du bist ein Geschenk Gottes. Nicht nur für deine Eltern, sondern auch für uns“, sagte Julie. Sie und Michel tranken den Kräutertee und spürten bald eine Verbesserung ihres Befindens. Natalie beobachtete Rolands Tun.
„Du, Roland, ich habe da eine Idee. Sag mir, was du davon hältst“, wandte sie sich an den Gesellen ihres Vaters.
„Und die wäre?“
„Sieh mal: Aus den Nesselfasern habe ich Garn gesponnen und einen leichten Stoff gewebt“, sagte sie und präsentierte ihm ein fast quadratisches Stück des weißen Stoffes.
„Oh, der sieht sehr schön aus. Was willst du daraus machen?“, fragte er, als er den Stoff befühlte.
„Ich habe mal bei einer edlen Dame gesehen, dass sie sich mit einem ähnlichen Tuch die Nase geputzt und hinein geschnupft hat. So ein Tuch kann man waschen und wieder benutzen“, erklärte Natalie.
„Wir sind keine Edelleute, Natalie!“, erinnerte Julie schniefend. Roland lächelte sanft.
„Das kommt darauf an, wo du edel ansetzt, Julie“, sagte er. „Meine Eltern sind Adlige. Ich als deren Sohn gelte in Frankreich aber nicht als adlig – weil ich nach französischem Recht angeblich ein uneheliches Kind bin. Ihr Julie, habt mich aufgenommen. Ihr so einfachen Menschen, die dem Dritten Stand angehören. Mein ach so edler Onkel verweigerte mir die Ausbildung, die mein Vater wünschte, als er mich herschickte. Edel ist für mich Güte, Großmut und Freundlichkeit. Das habe ich bei dir und deinem Mann Balian gefunden.“
„Du meinst, Adel ist keine Frage von Geburt, sondern von edlem Handeln?“, hakte Balian nach.
„Ja, genau, Meister. Als ich für den Baron unseren Stammbaum zusammenstellen sollte, hatte ich die Chronik der du Puisets als Quelle. Danach ist Hilduin du Puiset im Jahr des Herrn 1048 in den Adelsstand erhoben worden. Davor war er ein Mann aus dem einfachen Volk. Ich erkenne daran, dass es Adel in meiner Familie nicht schon seit der Erschaffung der Welt gibt, sondern dass erst vor gut hundert Jahren jemand als besonders edel erkannt wurde, weil er so gehandelt hat. Das wird auch für andere Adelsfamilien gelten. Der König adelt jemanden, und wenn der Adel erblich ist, dann ist fortan seine Familie, sind seine Nachkommen adlig – ganz gleich, ob sie ebenso edel handeln wie jener, dessen Adel vom König erkannt wurde. Deshalb denke ich, dass Adel kein Selbstzweck ist, sondern die Aufgabe hat, die Menschen zu beschützen, die sich nicht selbst verteidigen können. Und ich halte es für sehr fragwürdig, die Anerkennung oder Verweigerung von einer ehelichen oder unehelichen Geburt abhängig zu machen, denn keiner von uns kann selbst bestimmen, ob er in eine eheliche Gemeinschaft oder außerhalb davon geboren wird. Ich meine aber, dass jeder Mensch von Gott nur für das verantwortlich gemacht werden kann, was er selbst beeinflussen kann“, erklärte Roland.
„Du stellst dich gegen die gottgewollte Ordnung?“, entfuhr es Michel.
„Was meinst du mit gottgewollter Ordnung?“
„Dass der Klerus über dem Adel und der Adel über dem gemeinen Volk steht!“, präzisierte Michel.
„Nun, dann gibt es wohl unterschiedliche gottgewollte Ordnungen“, bemerkte Roland. „Soviel ich weiß, streiten sich im Heiligen Römischen Reich Kaiser und Papst, wer der Höhere ist. Im Königreich Jerusalem steht der Patriarch von Jerusalem nicht über dem König. Wenn es in Frankreich so ist, dass der Klerus höher steht als der Adel, dann mag der französische Klerus sich so durchgesetzt haben. Aber das ist weltliche Macht, nicht gottgewollte Ordnung. Wenn du mich genau fragst, ist das Argument von der gottgewollten Ordnung nur eine Ausrede, um dem so genannten gemeinen Volk Dinge verbieten zu können, die man selbst gerne tut oder für sich selbst als selbstverständlich betrachtet – wie das Tragen und Benutzen von Waffen zum Beispiel oder die Jagd.“
Balian und seine Familie wurden bleich.
„Lass diese Worte nie deinen Onkel hören. Er würde dich dafür köpfen lassen!“, warnte der Schmiedemeister.
„Dann musst du dir keine Sorgen machen, Meister. In die Verlegenheit werde ich sicher nicht kommen, weil mein Onkel mich nicht in seiner Nähe haben will. Aber … was das Tuch betrifft: Natalie hat es selbst gemacht und kann auch mehr davon machen. So etwas zu benutzen, ist gewiss keine Hoffart.“
Die Kräuteraufkochung, die Natalie in den folgenden Tagen mehrfach am Tag für ihre Mutter und ihren Bruder heiß machte, half den Erkrankten, die Erkältung bald zu überwinden. Natalies Schnupftücher halfen, die Nasen freizubekommen ohne die Kleidung zu verschmutzen. Balian, Julie und Natalie waren dem jungen Gesellen dankbar, dass er sein Wissen weitergegeben hatte, Michel dagegen wurde noch ablehnender gegenüber Roland.
Er war kaum genesen, als in die Klosterschule in Saint-Martin-au-Bois zurückkehrte. Sie stand unter der Leitung des Erzbistums Chartres, dessen Bischof dafür einen Weihbischof eingesetzt hatte, der ebenfalls aus dem Haus du Puiset stammte. Guillaume du Puiset war der jüngste der Brüder du Puiset dieser Generation. Ebrard war der älteste und hatte als Ebrard IV. die Vizegrafschaft Chartres geerbt. Hugo war der nächstjüngere und war von sich aus Geistlicher geworden. Er hatte Frankreich verlassen und war seit 1153 Bischof von Durham. Henri hatte als dritter Sohn die Baronie Saint-Martin-au-Bois erhalten, die erst für ihn geschaffen worden war. Guillaume hatte als jüngster Sohn dann nichts mehr zu erben gehabt und war ebenfalls Geistlicher geworden. Auch er war folglich ein Onkel zweiten Grades von Roland von Ibelin.
Michel beschwerte sich bei Bischof Guillaume, dass der neue Geselle seines Vaters erstens die gottgewollte Ordnung von Klerus, Adel und einfachem Volk in Frage stellte und zweitens Heilkunst anwandte, obwohl er dafür keine Erlaubnis hatte. Bischof Guillaume sah den künftigen Priester eine Weile an.
„Ich verstehe dich richtig: Du möchtest, dass Roland, der Geselle deines Vaters, dafür bestraft wird, dass er dir, deiner Schwester und deiner Mutter mit seinem Wissen geholfen hat, Krankheit zu überwinden?“, hakte er nach.
„Nur Heiler dürfen heilen, sagt unser Baron. Dass er nun gerade mir geholfen hat, muss doch zweitrangig sein. Ich bin doch nicht besser als andere“, beharrte Michel.
„Michel, Gott ist die Liebe. Unser Herr Jesus hat uns aufgegeben, den Nächsten so zu lieben, wie man sich selbst liebt. Was der Geselle deines Vaters für dich, deine Schwester und deine Mutter getan hat, war ein Akt der Nächstenliebe. Ihn dafür zu bestrafen, wäre Unrecht. Und was er zum Adel gesagt hat: Roland hat durchaus Recht, wenn er sagt, der Adel sei dazu da, um das Volk zu beschützen.
Es ist nicht die Aufgabe des Adels, das Volk nach Strich und Faden auszupressen. Das Volk ernährt den Klerus und den Adel, ja. Aber nur, weil wir Kleriker uns ausschließlich um den Gottesdienst und die Seelsorge bemühen und deshalb keine Zeit haben, auch noch Felder zu bestellen, zu pflegen und sie abzuernten oder Vieh zu züchten – sieht man von den Benediktinern ab, die die normale Arbeit in ihr Klosterleben übernommen haben und deshalb nicht auf einen Zehnt der Bauern angewiesen sind.
Für den Adel gilt das gleiche, nur dass der Adel von Feldarbeit und Handwerk freigestellt ist, um sich in den Waffen zu üben, um das Volk zu beschützen. Mein Bruder, der Baron Henri, meint, dass es sein gutes Recht ist, dass er die feinsten Speisen auf dem Tisch hat; dass er sich beim Tod eines seiner Untertanen dessen bestes Stück Vieh und einen Batzen von dessen Eigentum als Herrenerbe abzweigen kann; dass er das Recht hat, eine junge Ehefrau noch vor deren Ehemann besitzen zu dürfen.
Ich sage dir, dass all das Hoffärtigkeit ist – eine schlichte Todsünde! Er kann sich dieses vermeintliche Recht nur nehmen, weil der König dem einfachen Volk jede Bewaffnung verboten hat und es auf den Schutz durch den Adel verweist. Wie also sollte sich ein einfacher Mensch wie dein Vater gegen die sündigen Forderungen wehren, wenn er keine Waffen besitzen darf, sein Herr aber hunderte von Rittern und Söldnern hat, die auf dessen Befehl aus dem Vater Kleinholz machen würden? Mein Neffe macht sich einen Spaß daraus, mit seinen Freunden durch die Getreidefelder der Bauern zu reiten, das Korn damit zu verderben und dann die Bauern zu bestrafen, weil sie nicht genug Korn an die Burg liefern! Mein Bruder nimmt keinen Zehnt, also den zehnten Teil der Erträge seiner Bauern, nein, er will feste Abgaben. Wenn es eine Missernte gibt, dann hungern jene, die die Lebensmittel herstellen, nicht jene, die sich von ihnen aushalten lassen, aber nicht einmal ihren Standespflichten nachkommen. Mein Bruder müsste seine Bauern vor seinem ungeratenen Sohn schützen, doch er tut es nicht, denn dieselben Leute, die die Bauern drangsalieren, sind jene, die sie eigentlich beschützen sollten.
Nein, der Geselle deines Vaters verdient für das, was er für dich und deine Mutter getan hat, Lob, nicht Strafe. Und dem, was er zum Adel gesagt hat, stimme ich zu“, erklärte Guillaume.
„Ich habe verstanden, Exzellenz“, erwiderte Michel und verneigte sich vor dem Bischof. Es war die beste Methode, seinen unwirschen Gesichtsausdruck vor dem geistlichen Herrn zu verbergen.
Einige Tage später sandte der Bischof Michel zum Baron, damit er dort Spenden des Adligen für die Klosterschule abholte. Michel nutzte die Gelegenheit, Roland wegen verbotener Heilkunst beim Vizegrafen anzuschwärzen.
Es dauerte keine volle Stunde, bis Armand, Henris Sohn, mit zehn Söldnern bei Balians Schmiede erschien.
„Balian, wo ist dein Geselle Roland?“, fragte er, als er den Schmied allein vorfand.
„Er liefert Beschläge bei Maître Ademar in Cambery aus. Er müsste bald wieder hier sein“, erwiderte der Schmied. „Was ist denn?“
„Wenn er kommt, schicke ihn gleich in die Burg. Mein Vater wünscht, ihn zu sprechen.“
„Ich werde es ihm sagen“, versprach der Schmied. Armand und seine Männer zogen ab.
Gute zwei Stunden später erschien Roland in der Burg.
„Ihr wolltet mich sprechen, Onkel Henri. Hier bin ich“, meldete er sich. Henri nickte.
„Du warst in Bonville und hast bei Madeleine Kräuter gekauft. Mit diesen hast du einen Aufguss gemacht, um die Frau deines Meisters, seinen Sohn und seine Tochter zu heilen!“, hielt er seinem Neffen vor.
„Ja.“
„Wie kommst du dazu, dir das Recht anzumaßen, den Heiler zu spielen?“, fuhr sein Großonkel ihn an.
„Wieso Heiler spielen?“, fragte Roland verblüfft. „Ich habe mein Wissen genutzt, um der Familie meines Meisters zu helfen. Seit wann ist es verboten, eine Kräutersuppe zu kochen, die bei Erkältung Linderung verschafft?“, wunderte er sich.
„In Saint-Martin-au-Bois ist das die Aufgabe und das ausschließliche Recht des von mir beauftragten Heilers. Niemand anderes hat das Recht, einfach mal zu heilen!“ versetzte Henri. „Ich sehe für dieses mal von einer Strafe ab, aber wenn du das je wieder tust, bedeutete es zehn Stockhiebe! Hast du verstanden?“
Roland biss die Zähne zusammen, um sich an einer grantigen Antwort zu hindern. Er nickte mühsam.
„Ich … habe verstanden“, ergänzte er gerade rechtzeitig, bevor sein Onkel ihn barsch zu einer Antwort auffordern konnte. Henri nickte knurrend.
„Dann raus hier!“, befahl er grollend. Verstört kehrte der junge Mann um, stoppte aber an der Tür und drehte sich noch einmal um.
„Was sollte ich sonst noch wissen, was ich alles nicht darf?“, fragte er.
„Du darfst, was ich dir ausdrücklich erlaube. Alles andere ist verboten. Klar?“
Roland nickte.
„Dann bitte ich dich um die Erlaubnis, dass ich die Klingen verkaufen darf, die ich mit Erlaubnis meines Meisters für mich selbst geschmiedet habe, damit ich meine Heimreise bezahlen kann.“
„Es ist Sache deines Meisters, dir diese Erlaubnis zu erteilen“, entgegnete Henri. „Und wenn du welche verkaufst, schuldest du mir dafür den Zehnt! Wehe dir, wenn du nicht ehrlich bist!“
„Das werde ich. Ich danke für die Erlaubnis, Onkel Henri. Gott schütze dich“, verabschiedete sich Roland.
„Raus!“, donnerte der Baron.
Zornbebend kehrte Roland in die Schmiede zurück.
„Ah, da bist du ja. Was wollte der Baron?“, fragte Balian.
„Mir Strafe androhen, falls ich nochmals eine heilende Kräutersuppe mache! Ich fasse es nicht! Er sagt, er hat dafür einen Heiler beauftragt, und ich sollte mir nicht anmaßen, es dem gleichzutun“, erwiderte der Junge grantig. „Ist hier noch ein unfertiges Schmiedestück? Ich muss auf irgendetwas einschlagen!“
„In der Esse ist noch ein unfertiges Mauereisen. An dem kannst du dich austoben“, bot Balian an. „Aber woher wusste der Baron überhaupt davon?“
Roland holte sich Werkzeug und zuckte mit den Schultern, als er das Mauereisen auf den Amboss packte.
„Ich weiß es nicht. Eigentlich wussten nur du, deine Familie und ich davon – und Madeleine, aber ich glaube nicht, dass sie Onkel Henri davon etwas gesagt hat“, sagte er, während er mit dem Hammer auf das Schmiedestück eindrosch.
„Wieso sollte sie nicht?“
„So, wie sie sich zu ihm geäußert hat, denke ich nicht, dass sie Henri sehr schätzt“, entgegnete Roland und schob das Mauereisen wieder in die Esse, um es erneut zu erwärmen. Er betätigte den Blasebalg, um die Hitze des Feuers zu erhöhen. Wenig später hatte der Mauereisen-Rohling die richtige Glühfarbe. Roland nahm ihn heraus und schlug mit einem schwereren Hammer als bisher wütend auf das Eisen ein, bis daraus ein Beil geworden war, würdig, einem Henker als Handwerkszeug zu dienen. In seinem Zorn bemerkte er nicht, dass Balian die Schmiede verließ.
Der Schmiedemeister hatte durchaus eine Ahnung, wer seinen Gesellen angeschwärzt haben könnte.
„Julie, ist Michel hier?“, fragte er seine Frau.
„Nein, er ist in der Kirche, um Père Nicolas bei der Abfüllung des Messweins zu helfen“, erwiderte sie.
„Wenn er kommt, frag ihn doch, ob er nach seiner Krankheit beim Baron war und ihm gesagt hat, dass Roland dich, Natalie und ihn mit seiner Kräutersuppe geheilt hat“, bat er.
„Und wenn er das bestätigt?“
„Dann gib dem undankbaren Lümmel eine Ohrfeige oder schick ihn in die Schmiede, damit er sie sich dort bei mir abholt!“, versetzte Balian. „Henri hätte Roland beinahe eingesperrt oder ihm Prügel verpasst, weil er euch geholfen hart. Und dieser Lump von Baron verweist auch noch auf Abelard, diesen grantigen Dorfvorsteher von Monbartier, der entweder nie da ist, wenn man ihn braucht, sich verleugnen lässt oder horrende Summen haben will, bevor er überhaupt etwas tut!“
Kapitel 9
Tod in Saint Martin
Der Winter im nördlichen Frankreich war für Roland hart. Zum ersten Mal in seinem Leben beging er seinen Geburtstag am 13. Januar im Schnee – und er hoffte, dass er das auch nie wieder erleben musste. Die Damaszenerklingen, die er auf dem Markt in Chartres am Samstag, seinem freien Tag, anbot, verkauften sich hervorragend und brachten ihm so viel Geld ein, dass er hoffen durfte, ein Jahr nach seiner Abreise aus Jerusalem dorthin zurückkehren zu können. Noch vor Weihnachten hatte er seine Schulden bei Madeleine beglichen und rechnete auch den Zehnten bei seinem Onkel gewissenhaft ab.
Kurz nach Lichtmess 1177 erkrankte Julie erneut. Roland wollte – Verbot hin oder her – erneut mit dem Kräutersud helfen.
„Nein, zu es nicht!“, wehrte Julie ab. „ich will nicht, dass Baron Henri dich diesmal bestraft. Michel würde dich wieder verpetzen. Balian braucht dich, mein Junge.“
„Gut. Dann gehe ich nach Monbartier und hole den Heiler“, erwiderte er. „Wenn er als Einziger heilen darf, gibt es wohl keine andere Möglichkeit.“
„Abelard nimmt viel Geld!“, warnte sie.
„Ich habe die Kräuterfrau bezahlen können. Außerdem habe ich mit den Damaszenerklingen gut verdient. Da sollte die Bezahlung für Abelard möglich sein“, lächelte er verbindlich.
„Willst du das wirklich tun?“, fragte sie.
„Ja.“
„Du bist ein guter Junge!“
Im dichten Schneetreiben machte sich Roland auf den Weg nach Monbartier, einem Dorf, das südlich von Saint-Martin-au-Bois näher an der Eure lag. Das Haus von Abelard fand er erst nach einiger Sucherei. Die Dorfbewohner, die er getroffen hatte, hatten ihm nur sehr zögerlich die Lage des Hauses beschrieben. Auf sein Klopfen passierte zunächst nichts. Aber kurz bevor ihm die Füße einfroren, öffnete der Bewohner des Hauses doch noch.
„Was willst du?“, grunzte er unfreundlich.
„Meister Balian aus Saint-Martin-au-Bois schickt mich zu Euch. Seine Frau ist krank. Bitte, kommt rasch nach Saint Martin!“, bat Roland.
„Was habe ich denn mit denen zu schaffen?“, grunzte der Mann.
„Verzeiht: Seid Ihr Abelard, den der Baron als Heiler eingesetzt hat?“, erkundigte sich Roland.
„Ich bin Abelard. Aber was ist das für ein Unsinn? Ich bin kein Heiler!“, wehrte der Dorfvorsteher ab. Roland sank in sich zusammen.
„Nicht? Dann habe ich den Weg vergeblich gemacht“, seufzte er. Abelard grinste geradezu niederträchtig.
„Wer hat dir denn den Unfug erzählt?“
„Die Frau meines Meisters.“
„Da siehst du, was für dummes Zeug Weiber von sich geben. Verschwinde!“, knurrte der Dorfvorsteher.
Unverrichteter Dinge stapfte Roland nach Saint-Martin-au-Bois zurück. Es war schon dunkel, als er das Hauptdorf der Baronie erreichte.
„Lieber Himmel!“, entfuhr es Balian erschrocken, der gerade aus seiner Schmiede kam. „Wo warst du?“
„In Monbartier. Ich wollte Abelard holen, damit er Julie heilt“, erklärte Roland. „Hat sie dir das nicht gesagt?“
„Nein. Sie hat hohes Fieber. Ich hätte dich warnen sollen. Der Lump hat nicht aufgemacht oder er hat geleugnet, Heiler zu sein“, mutmaßte Balian.
„Er bestreitet, Heiler zu sein“, seufzte Roland.
„Sein übliches Spiel …“, bemerkte der Schmied. „Ich hoffe, dein Onkel kann ihn zur Räson bringen. Hoffentlich empfängt er dich.“
Roland lief die Viertelmeile bis zur Burg und bat, den Baron sprechen zu können.
„Der Baron ist nicht da“, wehrte der Posten ab.
„Dann seinen Sohn Armand“, erwiderte Roland. Der Posten grinste.
„Ich glaube nicht, dass der mit dir sprechen will.“
„Dann frag ihn, bitte.“
„Bursche, du hast mich mit Ihr anzusprechen!“, versetzte der Posten.
„Fragt Ihr ihn, bitte“, bat Roland, schon nur noch mühsam beherrscht. Der Posten lachte.
„Hach, ist das schön, dieses Bauernpack so unterwürfig zu sehen!“, prustete er. „Und wenn ich das nicht tue?“
„Ich weiß ja, dass mein Onkel mich nicht gerne in seiner Burg sieht. Aber dass seine Wächter von der gleichen Krankheit befallen sind, wusste ich noch nicht“, versetzte Roland.
„He, wie redest du mit mir?“
„Wie es einem hoffärtigen Lumpen zukommt. Und jetzt benachrichtigst du Armand – und zwar etwas plötzlich!“
„Willst du eine Tracht Prügel?“, knurrte der Wächter. Er holte aus, aber Roland war schneller. Ein fürchterlicher Fausthieb schickte den Posten ins Reich der Träume.
„Alarm! Angriff!“, brüllte ein anderer Posten . Roland schnappte sich den Spieß des Wächters. Die Wachen, die zum Tor stürzten, bremsten auf beiden Hacken, als sie den Neffen des Barons bewaffnet sahen.
„Nein, kein Angriff!“, widersprach der Schmiedegeselle wütend. „Ich möchte nur den Baron oder seinen Sohn sprechen, damit er den Heiler in Monbartier an seine Pflichten erinnert!“, versetzte er. „Euer Kamerad hier meinte, mich schlagen zu wollen, weil ich mich nicht veräppeln lassen wollte. Er wollte mich schlagen, ich habe mich gewehrt!“
„Hör mal, Bürschchen …“
Roland richtete sich zu seiner vollen Größe auf.
„Ich bin Balian Roland von Ibelin, Baron Henris Großneffe! Also nenn‘ mich nie wieder Bürschchen!“, donnerte Roland die Wachen an. Der durchaus selbstbewusste Auftritt Rolands ließ die Posten zurückzucken.
„Seid ihr noch gescheit, dem Neffen des Barons den Zutritt zu verweigern?“, fuhr ein weiterer Wächter die Posten am Tor an, der den Donjon gerade verließ. Roland kannte ihn als David, einen der Söldnerführer seines Onkels. Die anderen Wächter ließen ihn passieren.
„Ich bitte um Entschuldigung für diese Tröpfe, Mylord. Severin und Claude sind manchmal zu üblen Streichen aufgelegt“, wandte David sich an Roland. „Kommt, der Baron erwartet Euch.“
„Schon gut. Ihr müsst Euch nicht für Fehler anderer entschuldigen“, erwiderte Roland.
Wenig später hatte er Audienz bei seinem Großonkel.
„Was willst du?“, fragte er knurrig.
„Julie, die Frau meines Meisters ist erneut krank. Deshalb wollte ich Abelard holen, der nach den Worten meines Meisters der von Euch eingesetzte Heiler ist. Aber Abelard sagt, er sie kein Heiler und behauptet auch, nicht von Euch dazu bestimmt zu sein. Wenn er der Heiler ist, bitte ich Euch, ihn an seine Pflichten zu erinnern. Ist er es nicht, bitte ich Euch, mir zu sagen, an wen ich mich wenden muss. Mir habt Ihr es ausdrücklich verboten“, trug Roland vor.
„Was habe ich dir verboten?“, fragte Henri verblüfft.
„Meiner Gastfamilie die heilende Suppe zu kochen, durch die sie bei der letzten Krankheit genesen sind“, präzisierte Roland.
„Ach so, ja …“ brummelte Henri. „Abelard ist der Heiler. Geh zu ihm und sage ihm, dass ich ihm befehle, deiner Familie zu helfen!“, antwortete er auf die Frage seines Neffen.
„Nun, ich war dort“, sagte Roland. „Er bestreitet ja, der Heiler zu sei. Ich denke nicht, dass er einen Befehl Eurerseits durch mich akzeptieren wird“, gab er zu bedenken.
„Unsinn! Geh zu ihm und sage ihm das!“
„Wenn er sich weiter weigert: Was tue ich dann?“
„Er wird sich nicht weigern!“
„Noch mal: Was tue ich wenn er sich entgegen Eurer Annahme doch weigert?“, bohrte Roland unnachgiebig weiter.
„Dann komm wieder!“, grollte Henri.
„Ihr versprecht mir, dass ich dann ohne erneute Faxen Eurer Wachen eingelassen werde?“, hakte sein Neffe nach.
„Wieso Faxen?“
„Eure Posten Severin und Claude haben Euch erst verleugnet, mich veralbert und mich angegriffen. Erst als David dazukam und ihnen befohlen hat, mich einzulassen, konnte ich zu Euch vordringen“, sagte Roland.
„Du hast Zugang zu mir“, versprach Henri mit hörbarem Schnaufen.
„Ich danke Euch“, erwiderte Roland und verbeugte sich vor seinem Großonkel.
Einige Stunden später war er wieder bei Abelard in Monbartier. Wie er erwartet hatte, sträubte sich der Dorfvorsteher erneut, ihn nach Saint Martin zu begleiten.
„Jetzt habe ich aber genug!“, fuhr Roland ihn an. „Ich lasse mich nicht länger von Pontius zu Pilatus schicken. Ihr kommt auf der Stelle mit oder ich sorge dafür, dass der Baron Euch holen lässt!“
Abelard lachte meckernd.
„Hahaha, der wird nicht mal vorlassen, Bürschchen!“, prustete er. „Der schickt auch keine Soldaten!“
Roland hatte nun wirklich genug. Er packte den Dorfvorsteher am Schlafittchen und zerrte ihn mit einiger Gewalt aus seiner Hütte.“
He, was soll das?“, keuchte Abelard erschrocken.
„Ihr – kommt – jetzt – mit! Sonst setzt es Prügel!“, drohte Roland. Abelard spürte, dass der Junge ihm körperlich überlegen war und gab seinen Widerstand auf. Grummelnd ging er mit ihm nach Saint-Martin-au-Bois.
Mitten in der Nacht trafen sie dort ein. Zu Rolands Entsetzen knieten Balian und Natalie an Julis Lager und weinten bitterlich. Michel stand ebenfalls wie vom Donner gerührt daneben.
„Meister?“, meldete Roland sich an Balian drehte sich um.
„Es ist zu spät!“, sagte er tränenerstickt. „Julie ist tot.“
Dann sah er Abelard.
„Du bockiger Mistkerl! Deinetwegen ist mein Weib tot! Geh mir aus den Augen!“, donnerte er ihn an. Abelard drehte sich wortlos um und beeilte sich, Saint Martin zu verlassen.
„Es tut mir Leid. Ich hätte das Verbot nicht beachten sollen“, sagte Roland erschüttert.
„Nein, mein Junge, es ist nicht deine Schuld. Schuld ist der Baron, der einen unverständigen, bockigen Nichtsnutz zum Heiler eingesetzt hat. Einen ausgewiesenen Menschenfeind. Er ist schuld, weil er es dir verboten hat, Julie zu helfen. Und hätte Michel dich nicht verpetzt, wäre es dazu auch nie gekommen!“, wehrte Balian ab.
Noch zögernd näherte sich Roland dem Totenbett und kniete daneben nieder.
„Vergib mir, Julie, dass ich dir nicht helfen konnte“, flüsterte er und küsste sie auf die bleiche Stirn. „Ruhe in Frieden“, ergänzte er, stand auf und wollte gehen, aber Balian hielt ihn zurück.
„Wohin willst du?“, fragte er.
„In die Schmiede. Es ist einiges liegen geblieben, weil ich so lange unterwegs war und wir so viel zu tun haben.“
„Nein. Der Baron wird zwar toben, wenn er die Mauereisen nicht bekommt, aber …“, sagte Balian, aber Roland unterbrach ihn:
„Er wird dich einsperren, wenn die Sachen nicht fertig werden“, warnte er.
Kapitel 10
Erbschaftsprobleme
Entgegen Balians düsterer Prognose tat der Baron nichts gegen seinen Meister, obwohl die bestellten Mauereisen trotz Rolands fleißigem Einsatz nicht zum vereinbarten Zeitpunkt fertig waren. Henri hatte Grund zur Freude, an der er seine Untertanen teilhaben lassen wollte.
Unter Henris Rittern war Etienne de Restignac. Er besaß mit dem Dorf Restignac eine kleine Herrschaft, die nicht genügend abwarf, um allein davon leben zu können. Er hatte sich deshalb Henri als Ritter verdingt. Etienne war schon älter, war zum zweiten Mal verheiratet, aber beide Ehen hatten keine Kinder hervorgebracht. De Restignac hatte in zweiter Ehe Constance de Valpellier geheiratet, eine Schwester des Barons Raoul de Valpellier. De Valpellier hatte Etienne danach abwerben wollen, doch Etienne hatte zu der treuen Sorte von Rittern gehört, die ihren Herrn nicht wegen einer erneuten Heirat im Stich ließen. Constance war zwei Jahre zuvor verstorben, nun folgte ihr Etienne in die Ewigkeit.
Da Etienne keine Kinder hatte und er sich geweigert hatte, seine kleine Herrschaft seinem Schwager zu versprechen, war er in der Wahl seines Erben frei. Henri du Puiset hatte gewiss seine Fehler, aber gegenüber treuen Rittern war er ein guter Herr. Etienne hatte sein Dorf Restignac, das arm und unbedeutend genug war, um keines anderen Adligen Begehr zu wecken, Henri du Puiset vermacht.
Henri war überrascht, aber er nahm das Erbe gerne an, mochte auch ein dichter Wald Restignac von den zu Henris Lehen gehörigen Dörfern Bonville und Chaumur trennen. Daraus ließ sich – so der Gedanke von Henri du Puiset – gewiss etwas machen. Mit Zustimmung des Vizegrafen von Chartres, zu dessen Herrschaftsbereich die Baronie Saint-Martin-au-Bois mit den dazugehörigen Dörfern Bonville, Brechignon, Cambery, Chaumur und Monbartier gehörte, erhielt er auch die Herrschaft Restignac. In Henris Lehen wurde der Zuwachs drei Tage lang fröhlich gefeiert.
Doch des Einen Freud ist des Anderen Leid. Raoul de Valpellier wartete zunächst ab. Als er auch drei Monate nach dem Tod seines Schwagers noch keine Nachricht hatte, dass Restignac nun unter seiner Herrschaft stand, schrieb er an den Vizegrafen, wann er denn damit rechnen könne, dass ihm Restignac übertragen werde. Die Antwort des Vizegrafen, dass Etienne Restignac seinem Herrn Henri du Puiset vermacht hatte und dieser inzwischen auch als neuer Herr von Restignac bestätigt sei, trieb Raoul die Zornesröte ins Gesicht. Er sah sich um die Herrschaft Restignac betrogen.
Drei Tage nach Erhalt der Nachricht des Vizegrafen ritt er nach Saint Martin und ließ sich bei Henri melden.
„Mylord, der Baron de Valpellier macht Euch seine Aufwartung“, meldete Diener Remy den Besucher.
„Ja, Remy, lass ihn ein“, erwiderte Henri. Harte Schritte folgten seiner Aufforderung.
„Seid gegrüßt, Raoul de Valpellier!“, begrüßte Henri den Baron der Nachbarbaronie. „Was verschafft mir die Ehre Eures Besuchs?“
„Eine Rückforderung, Mylord, Henri!“, knurrte de Valpellier.
„Eine Rückforderung? Ich habe mir bei Euch nichts geborgt, das ich Euch zurückgeben müsste“, widersprach Henri verwundert.
„Ihr habt ein Erbe angenommen, das mir zustand!“, erklärte Raoul.
„Ich habe nur ein Erbe angenommen, das nicht aus meiner Familie stammt – und das ist Restignac. Etienne hat es mir vermacht“, erwiderte Henri.
„Genau das meine ich. Es gehört mir!“, versetzte Raoul.
„Nein, denn Etienne hat es mir vererbt. Der Vizegraf hat das Testament anerkannt und mein Besitzrecht bestätigt. Es ist rechtmäßig mein Erbe. So hat Etienne de Restignac es ausdrücklich gewollt!“, entgegnete Henri schroff.
„Er hatte kein Recht, es Euch zu vermachen! Er war mit meiner Schwester vermählt. Also bin ich der Erbe von Restignac!“, beharrte Raoul.
Henri seufzte.
„Eure selige Schwester, Raoul, ist vor zwei Jahren verstorben. Kinder hatten sie und Etienne nicht. Etienne war der alleinige Erbe dessen, was Eure Schwester besaß. Im Übrigen war er bereits Herr von Restignac, bevor er Eure Schwester ehelichte. Sie hatte keine eigenen Rechte an Restignac. Ihr als ihr Bruder hättet bestenfalls am persönlichen Eigentum Eurer Schwester, wenn sie Euch in ihrem Testament bedacht hat. Wenn dem so sein sollte, zeigt mir ihr Testament, und ich will Euch gerne geben, was ihr persönlich gehörte. Aber das ist ganz gewiss nicht Restignac!“, versetzte er.
„Etienne hat es mir als Brautpreis versprochen, als er Constance heiratete!“, behauptete de Valpellier.
„Er hat mir zwar gesagt, dass Ihr eine solche Forderung gestellt habt, dass er dies aber abgelehnt hat und seinerseits von Euch Mitgift gefordert hat. Er hat letztlich darauf verzichtet, wie ich weiß, aber einem Brautpreis hat er auch nicht zugestimmt, so weit ich weiß. Hätte er es Euch versprochen, hätte der Vizegraf dem auch zustimmen müssen, wie Ihr wisst, denn ohne dessen Genehmigung dürfen von ihm vergebene Lehen nicht weitergegeben werden. Wenn Ihr also behauptet, Restignac sei Euch versprochen worden, beweist es.“
„Wollt Ihr mich einen Lügner nennen?“
„Nein, ich fordere Euch auf, Euren angeblichen Anspruch zu beweisen!“, entgegnete Henri kalt.
„Ich muss überhaupt nichts beweisen! Etienne war mein Schwager. Er gehörte zu meiner Familie – und damit alles, was er besaß! Ihr müsst beweisen!“, donnerte de Valpellier.
„Das habe ich. Mit Etiennes Testament, das mir Restignac zuspricht. Der Vizegraf hat es anerkannt und mich letztlich mit Restignac belehnt“, versetzte der Baron von Saint-Martin-au-Bois.
„Ihr müsst es mir beweisen!“
Henri schnaufte gereizt, griff zur Klingel und läutete. Remy erschien.
„Mylord?“, meldete er sich mit einer Verbeugung.
„Etiennes Testament!“, befahl Henri.
„Sofort, Mylord!“, bestätigte der Diener und verschwand. Wenig später kehrte er mit dem erbetenen Dokument zurück. Henri entrollte das Pergament und legte es Raoul vor.
„Bitte, überzeugt Euch“, forderte er de Valpellier auf. Den Griff des Barons zum Testament verhinderte ein schneller Griff Henris, der dessen Hand aufhielt.
„Nichts da! Lest es, ohne es anzufassen!“, grollte er.
Gezwungenermaßen freiwillig las Raoul das Testament ohne Berührung.
„Das ist eine Fälschung!“, behauptete er schließlich.
„Jetzt ist es wirklich genug!“, fuhr Henri ihn an. „Das ist Etiennes Testament! Es ist gültig! Wenn Ihr etwas anderes behauptet, müsst Ihr beweisen – und zwar beim Vizegrafen! Raus hier!“, warf er Raoul hinaus.
„Das werde ich! Verlasst Euch darauf!“, grollte de Valpellier. „Eure Verweigerung kostet Euch nur mehr, denn wenn der Vizegraf zustimmt, werdet Ihr Restignac herausgeben müssen, samt allem Volk! Und dann will ich als Ersatz für meine Mühen, dass ich Euch überhaupt zur Herausgabe auffordern musste, weil Ihr mir mein Eigentum nicht freiwillig und ohne Aufforderung gegeben habt, den fünffachen Zehnt aller Eurer Dörfer plus dem zu erwartenden Zehnt von Restignac! Bar zu bezahlen und auf der Stelle, sonst erkläre ich Euch die Fehde und nehme Euch alles weg!“, drohte de Valpellier zornbebend und verließ Henris Burg.
Völlig konsterniert ließ der sich in seinen Stuhl fallen, dass das Kissen unter ihm nur so staubte. Es dauerte nur Augenblicke, bis sein Sohn Armand hereinkam, der den lautstarken Streit bis in seine Gemächer gehört hatte.
„Was war das, Vater“, fragte er.
„Raoul de Val-pel-ier!“, keuchte sein Vater. „Armand, hol mir Balian und Roland her! Wir werden Waffen brauchen! Mit dem Hund ist nicht zu spaßen. Der tut, was er sagt. Selbst wenn der Vizegraf seine Forderung ablehnt, wird er versuchen, sich Restignac mit Gewalt zu holen. Beeil dich!“, befahl er.
Balian und Roland waren mit Mauereisen beschäftigt, als Armand du Puiset mit einigen Begleitern in die Schmiede kam.
„Mitkommen – alle beide, aber etwas plötzlich!“, befahl der Sohn des Barons barsch.
„Wohin und warum?“, fragte Balian.
„In die Burg, weil ich es dir und deinem Gesellen befehle, ihr Pack!“, schnauzte Armand. Roland versteifte sich, aber Balian schüttelte den Kopf.
„Nein. Komm, der Herr ruft uns“, sagte er. Beide ließen ihre Werkzeuge liegen, wo sie gerade arbeiteten und folgten Armand und seinen Begleitern in die Burg.
„Mylord?“, sprach Balian den Baron an und verneigte sich ebenso wie sein junger Geselle.
„Ihr wisst, weshalb ich euch rufen ließ?“, fragte Henri.
„Nein, Mylord. Euer Sohn geruhte nicht, es uns zu sagen“, erwiderte Balian. Armand wollte ihn treten, aber eine unwirsche Handbewegung seines Vaters ließ ihn davon Abstand nehmen.
„Balian, Roland: Uns droht wohl eine Fehde. Ich brauche Schwerter, Spieße, Helme und so weiter. Seht zu, dass ihr das umgehend liefert!“, wies der Baron die beiden Schmiede an.
„Wie viel wovon und bis wann?“, erkundigte sich Roland.
„So viel ihr könnt – und schnell! Schmelzt von mir aus alles ein, was ihr an Metall bekommen könnt, aber es muss schnell gehen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich euch geben kann. Raoul de Valpellier traue ich jeden Winkelzug zu. Raus mit euch! Fangt sofort an! Alles andere muss warten!“
„Wie Ihr wünscht, Mylord. Wenn noch schadhafte Waffen und Rüstungen bei Euch vorhanden sind, gebt sie uns gleich mit“, bat Balian.
„Ich lasse danach suchen und dir liefern. Ab mit euch!“, erwiderte Henri unwirsch und winkte seinen Neffen und den Schmied hinaus. Beide verbeugten sich und verließen die Burg.
„Roland, geh gleich zu Aristide und bitte ihn um sein Pferd. Reite nach Brechignon zu Maître Simon, dem Sattler. Bitte ihn um alles Altmetall, das er hat. Wenn du das hast, wende dich an Maître Ademar in Cambery, den Schreiner. Was er an Altmetall – krumme Nägel und so weiter – hat, soll er dir mitgeben oder baldmöglichst liefern. Und dann frag bei Bischof Guillaume, was er an Mauereien einstweilen zurückgeben kann und sag ihm, warum. Dein Onkel hat Recht, dass Raoul de Valpellier die Rücksichtslosigkeit auf zwei Beinen ist. Er scheut sich nicht, anderen ihre Lehen streitig zu machen.“
Roland nickte, rannte ins Dorf hinunter und klopfte bei Aristide schon an, bevor sein Meister die Schmiede erreicht hatte.
„Roland, mein Junge, was gibt es, dass du so heftig an die Tür pochst?“, fragte der alte Bauer, als er die Tür öffnete.
„Guten Tag, Aristide. Bitte, leiht mir Euer Pferd“, bat Roland. „Ich soll nach Cambery und Brechignon reiten, um Metall für die Schmiede zu beschaffen. Der Baron wünscht umgehend einen Haufen Waffen.“
„Hat das was mit diesem Lumpen de Valpellier zu tun?“, hakte Aristide ein.
„Ihr sagt es!“, seufzte Roland.
„Nimm Rollo, den Schwarzen Normannen*. Er steht hinten auf der Weide. Ich sehe zu, was ich hier im Dorf an Altmetall auftreiben kann und bringe es deinem Meister.“
„Ich danke Euch!“, rief Roland und rannte zur Weide, auf der Rollo graste.
„He, aber nicht ohne Sattel!“, rief der Bauer hinterher. Roland drehte um und ließ sich den Sattel geben.
„Danke“, sagte er.
„Bitte, mein Junge. Weißt du, was ich an dir mag?“
„Nein“
„Du bist so ganz anders als dein Onkel und sein missratener Sohn. Schade, dass nicht du unser Baron bist. Aber jetzt beeil dich!“
„Das werde ich!“, versprach Roland und rannte zur Koppel. Aristide verließ ebenfalls sein Haus und zog von Haus zu Haus, um Metall zu sammeln.
Rolands Bemühungen waren überaus erfolgreich. Nicht nur die Handwerker, zu denen Balian ihn geschickt hatte, krempelten ihr Hab und Gut nach überflüssigem Metall um, alle Dörfler in den sieben Dörfern, die nun zu Saint-Martin-au-Bois gehörten, taten es ebenfalls. Einige Männer boten auch ihre Dienste als Helfer an. Balian war froh über jede Hand, die ihm und seinem Gesellen half.
Benoit, ein Junge aus Restignac, erwies sich als ausgesprochen talentiert und wollte gerne Schmied lernen. Balian nahm ihn als Lehrling an und durfte feststellen, dass Roland noch eine weitere Fähigkeit hatte: Er war ein guter Lehrer, der Benoit schnell beibringen konnte, was ein Schmied wissen musste.
Zwei Wochen arbeiteten die Schmiede fast Tag und Nacht, jede Hilfskraft nutzend, die sich ihnen bot. Dann hatten sie für fünfzig Männer Rüstungen, Schwerter und Spieße gefertigt. Und sie waren nicht viel zu früh damit fertig.
Raoul de Valpellier war von Saint-Martin-au-Bois direkt nach Chartres weitergeritten und hatte sich bei Vizegraf Ebrard du Puiset wegen des seiner Ansicht nach voreilig anerkannten Testamentes beschwert.
„Das Testament ist eindeutig: Euer Schwager hat das Dorf Restignac mit allen Rechten und Pflichten seinem Dienstherrn Henri du Puiset, Baron von Saint-Martin-au-Bois, hinterlassen. Euer Schwager hat sich schon vor gut zehn Jahren diese Erblassung genehmigen lassen“, erwiderte Ebrard auf diese Beschwerde.
„Aber er hat mir vor der Eheschließung mit meiner seligen Schwester Constance versprochen, dass Restignac an mich gehen sollte, falls auch die zweite Ehe ohne Kinder bleiben sollte!“, widersprach Raoul.
„Welchen Beweis habt Ihr für ein solches Versprechen?“, fragte der Vizegraf.
„Er hat es mir mündlich gegeben. Aber ein gegebenes Wort darf nicht gebrochen werden!“, beharrte Raoul.
„Welche Zeugen gibt es für dies Versprechen?“, hakte Ebrard nach.
„Ihr bezichtigt mich der Lüge?“
„Nein. Ich frage nach einem Beweis. Wie Ihr wisst, gilt in Frankreich immer noch der römische Rechtsgrundsatz, dass derjenige, der etwas behauptet, dies auch beweisen muss“, entgegnete der Vizegraf. „Baron Henri hat seine Ansprüche durch das von Etienne geschriebene und gesiegelte Testament beweisen. Es stammt aus dem Jahr 1167. Er hat dieses Testament offensichtlich gleich nach der ebenfalls 1167 erfolgten Genehmigung verfasst. So viel ich weiß, hat Etienne Eure Schwester erst vor vier oder fünf Jahren geheiratet. Wenn er Euch versprochen hätte, Euch Restignac zu hinterlassen, hätte er das von mir erneut genehmigen lassen müssen und sein Testament ändern lassen müssen, denn ohne meine Genehmigung als Lehensgeber ist die Überlassung eines von mir vergebenen Lehens ungültig. Das wisst Ihr. Etienne hat keine weitere Genehmigung von mir erbeten. Auch wenn Ihr ein geändertes Testament vorlegen könntet, wäre es bezüglich der Überlassung Restignacs ungültig. Seht es ein: Etienne hat Restignac Henri vererbt und nicht Euch!“, entgegnete der Vizegraf bestimmt.
Doch Raoul de Valpellier sah es nicht ein. Kaum zu Hause angekommen, ließ er seinen Schreiber herbeirufen und diktierte ihm den Fehdebrief an Henri du Puiset, in dem er nun nicht nur Restignac, sondern gleich Bonville, Chaumur und deren Zehnt der vergangenen drei Jahre als zusätzlichen Zins forderte. Sofern nicht innerhalb von drei Tagen die Übertragungsurkunde sowie das Geld samt einem Beweis der Zehntzahlungen bei ihm vorliege, werde er angreifen. Der Vizegraf habe die Übertragung genehmigt – behauptete er wider die Wahrheit.
Henri erhielt den Fehdebrief, schrieb umgehend an den Vizegrafen, welche Forderungen Raoul de Valpellier an ihn stellte und bat um den Nachweis der Genehmigung oder anderenfalls um Beistand durch den Vizegrafen, falls er das Ansinnen de Valpelliers abgelehnt habe. Dann ließ er Balian und Roland rufen, informierte sie über Raouls Drohung und ermahnte sie, sich mit den Rüstungen und Schwertern zu beeilen.
„Mylord“, setzte Roland an, „ich hätte da noch etwas.“
„Und was?“
„Seht Euch diese Zeichnung an, Mylord. Ich habe eine Schleuder konstruiert. Sie wirft viel weiter und viel schwerere Brocken als die Trébuchets, die Ihr bisher habt“, bot Roland an. Henri nahm die Zeichnung und warf einen Blick darauf.
„Wie schnell kannst du das bauen?“, fragte er.
„Ich habe Maître Ademar die Zeichnung gezeigt. Er ist dabei, sie zu bauen. Sie könnte schon fertig sein“, erwiderte Roland. Henri nickte.
„Gut, gut. Aber jetzt müssen wir uns verteidigen. Da hilft eine Belagerungsmaschine wenig. Konzentriere dich jetzt darauf, Rüstungen und Schwerter zu schmieden“, wies Henri ihn an.
Kapitel 11
Des Einen Leid, des Anderen Freud
s „Mach dir nichts draus, Roland“, sagte Balian, als sie wieder in der Schmiede waren. „Henri hat wenig militärischen Verstand. An seiner Stelle würde ich so eine Maschine auf dem Bergfried aufstellen lassen und damit die Angreifer auf Distanz halten. So etwas eignet sich gut, um damit Angriffstürme zu zerstören, wenn man es richtig macht“, sagte er. „Michel! Natalie!“, rief er dann. Beide erschienen prompt.
„Vater?“, fragte Natalie.
„Ihr beide geht augenblicklich in die Burg. De Valpellier hat Baron Henri die Fehde erklärt. Ihr beide bringt euch in der Burg in Sicherheit“, wies er seine Kinder an.
„Und ihr beide?“, fragte Natalie.
„Roland und ich verteilen die Waffen und kommen dann nach. Nun macht schon! De Valpellier traue ich fast alles zu!“
„Ja, Vater!“, bestätigten Natalie und Michel wie aus einem Munde. Sie suchten sich noch ein paar Sachen zusammen und eilten dann zur Burg.
Roland und Balian liefen in die Schmiede, packten die fertigen Stück zusammen und brachten sie zur Burg, wo Armand sie in Empfang nahm.
„Was steht ihr hier noch herum? Los, macht weiter!“, befahl er den Schmieden. Gehorsam kehrten beide in die Schmiede zurück. Während sie noch auf dem Weg waren, verließ Henris Aufgebot – angeführt von ihm selbst – die Burg und eilte nach Restignac. Von dort hatte ein Posten auf dem Söller Rauch aufsteigen sehen. Armand und seine Männer verließen ebenfalls die Burg und eilten in Richtung Monbartier davon in der Annahme, dort auf die Söldner de Valpelliers zu treffen.
Henri und sein Aufgebot jagten durch den Wald nach Nordwesten, wo Restignac lag. Es waren nur gute sieben Meilen. Ihnen kamen auf halber Strecke die Bewohner Restignacs entgegen.
„Das Dorf brennt, Herr!“, rief Benoit, der eher zufällig an diesem Tag in seinem Heimatort Restignac gewesen war, weil er Ware ausliefern sollte.
„Wer war es“, fragte Henri.
„Leute unter einem Banner, das blau, weiß und grün war. Einer wurde als Baron de Valpellier angesprochen“, erwiderte Benoit. „Aber sie sind schon wieder fort. Sie sind in den Wald in Richtung Bonville geritten. Wir wollten noch löschen, aber sie haben auch die Sperre des Dorfteichs zerstört. Er ist ausgelaufen. Da ist nichts mehr zu retten.“
„Wir werden euer Dorf wieder aufbauen!“, versprach Henri.
„Ist das Rauch da?“, fragte einer der Flüchtlinge aus Restignac und wies hinter Henri und seine Reiter. Der Baron sah sich um. Über dem Wald zogen schwarze Rauchwolken im Wind.
„Heiliger Kaiser Karl!“, entfuhr es Henri. „Saint Martin! Zurück! Der Hund greift Saint Martin an!“, schrie er. Er und sein Aufgebot machten kehrt, um in Saint Martin einzugreifen. Henri wurde klar, dass der Angriff auf Restignac nur dazu gedient hatte, um ihn von Saint Martin wegzulocken.
Armand und seine Leute, die in Richtung Monbartier fortgeritten waren, verließen eben den Wald südlich von Saint Martin, als ein Feldarbeiter dort mit blankem Entsetzen im Gesicht hinter sie wies.
„Feuer!“, schrie er. „Das muss Saint Martin sein!“
Armand stoppte sein Pferd und sah sich um.
„Himmel!“, entfuhr es ihm. „Das ist Saint Martin! Zurück! De Valpellier muss dort sein!“, rief er. Auch er und seine Männer machten kehrt und jagten auf demselben Weg zurück zum Hauptort des Lehens.
„Der Hund wartet nicht einmal die Fehdefrist ab!“, erkannte Balian derweil in Saint Martin. „Los, Werkzeuge und Rohmaterial müssen sofort in Sicherheit gebracht werden!“, trieb er seinen Gesellen an.
Die Weisung des Schmieds kam keinen Moment zu früh. Lautes Kriegsgeschrei dröhnte von der von Osten nach Saint Martin führenden Straße. Von dort preschten Reiter in den Farben de Valpelliers heran, die alles vor sich niederhauten. Der Baron führte die Männer persönlich an. Einige blieben zurück und zündeten mit Fackeln die Häuser an.
„Roland! Lauf! In die Burg mit dir!“, befahl Balian. Der junge Geselle gehorchte und rannte wie von den Furien gehetzt zur Burg. Balian packte noch Hufeisen und Klingenrohlinge zusammen und rannte hinterher, doch de Valpelliers Reiter waren schneller. Sie stellten ihn wenige Klafter vor dem rettenden Burgtor.
„Du wolltest wohl ausreißen, was?“, fuhr er Balian an. „Was hast du da für Sachen?“
„Klingenteile und Hufeisen“, erklärte einer der Männer de Valpelliers, der Balian rasch durchsuchte, während ihn zwei andere festhielten.
„Dann bist du der Schmied, hm?“, hakte Raoul nach. Balian nickte.
„Der bin ich“, bekannte er.
„Du hast für meinen Feind Waffen gemacht!“, hielt de Valpellier ihm vor. „Du bist kein unschuldiger Dorfbewohner. Das kostet dich die rechte Hand – mindestens!“, entschied er. Balian versuchte, sich zu befreien, aber gegen vier Männer des Angreifers kam er nicht an. Sie zerrten ihn zu einem Felsbrocken, den sie als Schafott missbrauchten, als einer der Söldner dem Gefangenen mit dem Schwert die rechte Hand abhackte.
Der Schrei des Schmieds dröhnte bis in die Burg. Roland sprang eilig auf die Wehrmauer und sah, dass sein Meister brutal verstümmelt wurde.
„Belagert die Burg!“, hörte er de Valpellier befehlen. Dessen Männer rannten auf die Burg zu, aber die Dorfbewohner, die sich in die Burg hatten retten können, schossen mit Langbogen auf die Angreifer. Viele brachen getroffen zusammen, andere zogen sich nur kurz zurück, um Leitern zu holen, mit denen sie die Mauern Stürmen wollten.
„Achtung! Leitern!“, rief Roland. Die Bogenschützen schossen auf die Männer mit den Leitern, die weit vor der Burgmauer aufgehalten wurden
Roland bemerkte, dass an der Kreuzung östlich von Saint Martin Handwerker eine große Holzstruktur zusammenzubauen begannen. Es sah aus, als wollten die Söldner einen Belagerungsturm aufbauen. Er schaute sich um und sah im Hof der Burg ein Trébuchet*.
„Habt Ihr etwas zum Verschießen?“, fragte er Etienne, den Anführer der Geschützmannschaft.
„Ja“
„Dann legt ein Geschoss ein und schießt es zur Kreuzung ab!“, wies Roland ihn an.
„Wieso sollte ich das tun, du Naseweis?“, knurrte Etienne zurück.
„Baron de Valpellier lässt einen Belagerungsturm zusammenbauen. Wenn der an die Mauer kommt, müssen sie nicht mal das Tor aufbrechen“, erwiderte Roland. „Da kommt mir der Gedanke, das zu verhindern.“
Der Geschützführer wurde nun doch aufmerksam, stieg auf die Mauer und sah die Bemühungen der Söldner de Valpelliers.
„Wie weit mag das sein?“, brummte er. Der Bau fand etwa an der Kreuzung zweier Straßen statt, von der eine an Saint-Martin-au-Bois von Nord nach Süd vorbeiführte und die andere an der Burg vorbei durch das Dorf nach Cambery im Osten und Chaumur im Westen führte.
„Bis zur Kreuzung ist es etwa eine Viertelmeile“, gab Roland Auskunft.
„Ziemlich weit, könnte aber passen“, brummte der Geschützführer. „David! Weiteste Einstellung und eine Handbreit nach rechts!“, schrie er hinunter. David und seine Kameraden richteten das Trébuchet aus, beluden es und lösten die Sperre. Die Schleuder drehte sich, die Leine des Schleudersacks wurde freigegeben, der Brocken flog im hohen Bogen auf das Ziel zu und traf den noch im Bau befindlichen Angriffsturm. Die Balken wurden zu Kleinholz zerschmettert, die Bauleute stoben in alle Richtungen davon.
Jubel brandete unter den Verteidigern der Burg auf, während de Valpelliers Söldner regelrecht geschockt waren und sogar die Leitern vergaßen, mit denen sie die Mauerkrone noch hätten erreichen können.
Fast im selben Moment preschte Armand mit seinen Leuten von Westen kommend an der Burg vorbei und griff de Valpelliers Sergeanten frontal an, die sich prompt zurückziehen mussten. Die Bogenschützen an der Burg halfen mit Pfeilhagel nach. De Valpellier zog seine Leute zurück. So schnell, wie sie gekommen waren, so schnell verschwanden sie wieder.
Armand und seine Männer machten halt und verfolgten die Angreifer nicht weiter als bis zum Waldrand, der noch etwa eine halbe Meile weiter östlich war. Als sie die Burg erreichten, kehrte auch Henri mit den übrigen Männern zurück.
Kaum dass die Soldaten de Valpelliers geflohen waren, rannte Roland aus der Burg, um sich um den hilflos liegengelassenen Balian zu kümmern. Das Material, das er bei sich gehabt hatte, hatte de Valpellier mitnehmen lassen. Roland und David schleppten den Schmiedemeister in die Burg, wo sich Roland sauberes Leinen erbat, um den Armstumpf seines Meisters zu verbinden, damit er nicht verblutete.
„Was ist passiert?“, fragte Henri, als er in die Burg kam und die Bemühungen seines Neffen bemerkte. Roland berichtete, was geschehen war.
„Und wieso hast du deinen Meister nicht geschützt?“, fragte der Baron streng.
„Er hatte mich mit Rohmaterial und Klingenrohlingen vorgeschickt. Er konnte mit seiner eigenen schweren Last nicht schnell genug laufen“, erwiderte Roland.
„Ich habe dich gefragt, wieso du ihn nicht geschützt hast, wie es die Pflicht des Ritters ist!“, fuhr der Baron seinen Neffen an.
„Ihr habt mir die Anerkennung als Adliger entzogen, weil die Ehe meiner Eltern nicht französischen Vorstellungen entspricht. Meine Ausbildung zum Ritter habe ich nicht fortsetzen dürfen. Ich durfte auch keine Waffe tragen. Wie also hätte ich ihn schützen sollen?“, entgegnete Roland bestimmt. „Aber selbst wenn ich bewaffnet gewesen wäre und die Waffe hätte benutzen können, hätte ich mit Widerstand gegen de Valpelliers Söldner nur erreicht, dass ich tot und Meister Balian dennoch verstümmelt wäre. Es waren wenigsten zehn oder zwölf Männer samt Baron de Valpellier, die ihn angegriffen haben“, protestierte er.
„Roland sagt die Wahrheit, Mylord“, schaltete sich David ein. „Ich habe gesehen, wie beide zur Burg rannten und ich habe gehört, dass Meister Balian Roland zurief, er solle sich beeilen, in die Burg zu kommen. Er hat es ihm befohlen, Herr.“
„Mylord, Ihr wisst, dass Schmieden immer als Erstes angegriffen werden“, fügte der Geschützführer hinzu. „Im Übrigen ist der Junge ein kluger Mann. Er gab mir den Hinweis auf den Belagerungsturm, den die Feinde gerade bauen wollten und konnte mir die Entfernung sagen. Wir konnten die Turmteile mit einem Schuss zerstören. Das hat geholfen, de Valpelliers Leute lange genug zu lähmen, bis Euer Sohn mit seinen Männern zurück war und sie direkt bekämpfen konnte.“
„Höre ich da etwa Kritik?“, grunzte Henri.
„Und wenn es so wäre: Etienne hätte Recht!“, schaltete sich nun Bischof Guillaume ein, der eher zufällig in die Kämpfe geraten war, weil er mit Henri und Balian eigentlich einen Kirchenneubau in Saint Martin hatte besprechen wollen.
„Ach, was wisst Ihr denn, Exzellenz!“, maulte der Baron.
„Henri, ich bin dein jüngerer Bruder. Deshalb hast du dieses Lehen bekommen, während ich mich dem Herrn verschrieben habe, weil es kein weiteres Lehen gab, das ich hätte übernehmen können. Das bedeutet keineswegs, dass ich von Strategie und Taktik nichts verstehe. Wir sind am selben Hof erzogen worden und haben dieselbe Ausbildung erhalten“, entgegnete Guillaume. „Du hättest die Schmiede – die einzige in allen Dörfern, die zu diesem Lehen gehören – rechtzeitig in die Burg verlegen müssen!“
„Wie kannst du es wagen …“
„… dich zu kritisieren? Weil es kritikwürdig ist!“, unterbrach Guillaume den Baron. „Du kritisierst Roland, weil er seinen Meister nicht geschützt hat – und das zu Unrecht, denn als dem gemeinen Mann, zu dem du ihn herabgestuft hast, ist es ihm verboten, Waffen zu tragen und zu benutzen, es sei denn, du erlaubst es ihm ausdrücklich. Mit bloßen Händen hätte er Balian wirklich nicht schützen können, schon gar nicht gegen eine Übermacht. Und hätte er seinen Meister mit Waffengewalt verteidigt, hättest du ihn dafür ebenso bedroht, ja bedrohen müssen, wenn du deine eigene Rechtsauffassung ernst nimmst, wie für seine von dir nicht geduldete Hilfeleistung an Balians Meisterfamilie – wenn er es denn überlebt hätte, was ich nicht glaube. Sie hätten ihn getötet und Balian ebenso um seine rechte Hand gebracht. Aber du hättest als Baron dieses Lehens wissen müssen, dass Saint Martin auf jeden Fall eines der ersten Ziele de Valpelliers sein würde. So ist dir immerhin noch der Schmiedegeselle geblieben. Balian kann ihn weiter ausbilden.“
Balian bildete Roland weiter aus, Roland selbst bemühte sich um die Ausbildung Benoits, dessen Arbeitskraft nach der Verstümmelung des Meisters auch unerlässlich war. Roland machte das so gut, dass Balian ihn nur wenige Monate nach der abgewehrten Fehde zur Meisterprüfung der Schmiedezunft anmeldete. Die Zunft ging darauf ein und ließ Roland nach Chartres kommen, um die Prüfung abzunehmen.
„Du hast Hufschmied gelernt?“, fragte einer der Zunftmeister.
„Bei Meister Balian habe ich alles geschmiedet, was an Metall zu machen ist – von Hufeisen und Mauereisen über Tafelgeschirr bis zu Damaszenerklingen“, erwiderte Roland in der Hoffnung, als Meisterstück eine Klinge schmieden zu können. Seine Hoffnung wurde nicht enttäuscht.
„So, so … Klingen … Nun, dann fertige ein Schwert als Meisterstück“, forderte der Zunftmeister.
„Was darf ich dafür benutzen?“, fragte der Meisterkandidat.
„Was immer dir sinnvoll erscheint, ein gutes Schwert mit einer Scheide zu fertigen. Das Material bekommst du. Wenn du das Stück behalten willst, musst du das Material bezahlen“, erklärte der Zunftmeister.
Roland ließ sich unterschiedlich harte Eisensorten geben, Büffelleder und Holz vom Nussbaum. Dann begann er, die Klinge und die Angel aus den unterschiedlichen Eisensorten zu schmieden, indem er die Sorten zunächst einzeln zu Strängen verarbeitete, diese dann verschweißte*, immer wieder faltete, sie zu einer Klinge mit rautenförmigem Querschnitt auswalzte. Aus einem verdickten Stück formte er die Angel und die Parierstange aus, deren Enden wie Hundeköpfe geformt waren. Das obere Ende der Angel schließlich formte er zu einem achteckigen, offenen Knauf, aus dem er noch blattartige Verzierungen herausarbeitete, die ein hohles Tatzenkreuz darstellten. Das eigentliche Heft, den Griff, stellte er aus anschmiegsam geformten Nussholzteilen her, aus deren Kern er die Form der Angel heraus stemmte, die Teile mit Holzzapfen und Löchern versah, so dass sie die Angel umschlossen. Die Holzteile wurden mit Baumharz verklebt. Darüber kam ein gut handbreites Stück Rohleder aus Büffelhaut, die so befestigt wurde, dass keine störende Naht blieb, die im Kampf Handschuhe oder die bloße Hand schädigen konnte. Es war eine Arbeit, die einige Tage in Anspruch nahm.
Die Zunftmeister waren von der Arbeit, die die eines Schwertfegers* gleich mit einschloss, restlos begeistert. Dem gut Siebzehnjährigen hatten sie eine solche Leistung nie zugetraut – und doch lag das Ergebnis vor ihnen, von ihnen selbst beaufsichtigt.
„Roland, das ist ein wahres Meisterstück, auch ohne die sichtbare Faltung. Das ist ein wunderschönes Schwert, das jeglichen Anspruch an ein Schwert erfüllt. Ab heute bist du ein Meister des Schmiedehandwerks. Sei willkommen in unserer Zunft, Meister Roland.“
„Ich danke Euch, Zunftmeister. Das Schwert möchte ich behalten. Was bin ich für das Material schuldig?“
Der Zunftmeister verlangte zwei Livres für das Material, was zwar relativ viel Geld war, aber Rolands Klingenverkäufe hatten ihm weit mehr eingebracht. Der größte Anteil an den Kosten eines Schwertes lag ohnehin in der handwerklichen Ausführung und Verzierung einer solchen Klinge. Ein Schwert, das beim Schmied bestellt und gekauft wurde, hatte etwa den Gegenwert dessen, was ein Bauer in einem ganzen Jahr verdiente.
Als Meister betitelt kehrte Roland nach Saint-Martin-au-Bois zurück, von seinem Meister Balian, dessen Tochter Natalie und Lehrling Benoit begeistert empfangen. Henri du Puiset nahm die Meisterschaft seines Großneffen zufrieden zur Kenntnis.
„Ich gratuliere dir, Roland. Mit dir als Meister hat mein Lehen wieder einen Schmied, der mir helfen kann, es zu erhalten“, sagte er. „Ich habe Raoul de Valpellier beim Vizegrafen wegen der Fehde angeklagt, nachdem ich erfahren habe, dass Vizegraf Ebrard ihm dies verboten hatte. Ich habe ihn inzwischen zur Wiedergutmachung der Schäden aufgefordert, aber ich glaube nicht, dass er bezahlen wird. Ich werde ihm wohl selbst die Fehde erklären müssen, um zu meinem Recht zu kommen. Du hattest mir einen Plan für eine größere Schleuder gezeigt. Ich möchte, dass du sie baust und vorführst, was sie vermag.“
„Das werde ich“, versprach Roland.
Er ritt noch am gleichen Tag nach Cambery zu Meister Ademar, der die Schleuder nach Rolands Konstruktion auch fertig hatte. Ademar, sein Sohn Arnaud und weitere Gehilfen brachten die Einzelteile nach Saint-Martin-au-Bois und bauten sie in der Burg zusammen. Als sie fertig war, hatten Geschützmeister Etienne, David und ihre Leute den Brocken, den sie auf den Belagerungsturm geschleudert hatten, mit viel Mühe und dem Einsatz von drei Ochsengespannen wieder in die Burg gebracht. Roland ließ den Brocken in die Wurfschlaufe befördern, spannte die Schleuder und löste dann die Sperre. Der Brocken wurde doppelt so weit geschleudert wie zuvor.
„Heiliger Kaiser Karl!“, entfuhr es Henri. „Damit kann ich gegen Raoul zu Felde ziehen! Roland, du kommst als Maschinist und Reiter mit! Wenn du dich bewährst, will ich über deine illegitime Herkunft hinwegsehen und dich als Sohn meines Cousins zum Ritter schlagen.“
Kapitel 12
Vergeltung und Verrat
Wenig später traf ein Bote des Vizegrafen ein, der die Botschaft überbrachte, dass Henri die Fehde gegen Raoul de Valpellier wegen dessen Verstößen gegen das Fehderecht gestattet sei.
Henri sandte seine eigenen Boten aus und bat Verwandte und Freunde um Beistand bei der Fehde, die er gegen de Valpellier führen wollte. Alle, die er um Beistand bat, sagten diesen auch zu, auch Stephane de la Pie. Mit Stephane hatte Henri sich auch schon um ein Erbe gestritten, doch hatte er jenen Streit verloren.
Zwei Wochen später, es war inzwischen August 1177, erhielt Raoul de Valpellier den Fehdebrief von Henri du Puiset. Raoul wusste um die große Verwandtschaft, die Henri hatte. Sollte er diese alle mobilisiert haben, hatte Raoul keine Chance, das wusste er nur zu gut. Das war auch der Grund gewesen, weshalb er die drei Tage Frist, die er Henri vor dem Angriff hätte geben müssen, nicht gewährt hatte. Er hatte gefürchtet, Henri könnte seine Verwandten und Freunde zu Hilfe rufen.
Doch ein zweiter Brief, den er erhielt, machte ihm Hoffnung, dass es gutgehen könnte: Ihm wurde anonym empfohlen, sein Volk in die Herrschaft de la Pie zu evakuieren und du Puisets Heer ins Leere laufen zu lassen. Es würde gewiss zu Schäden an der Burg kommen, aber wenn Henris Kämpfer sie stürmen wollten, würden sie eine Überraschung erleben.
Raoul überlegte nicht lange. Er wies seine Dorfvögte an, das Volk umgehend nach La Pie zu bringen, das südöstlich seines eigenen Lehens Valpellier lag. Die Leute sollten alles mitnehmen, was sie nur tragen konnten. Schon am folgenden Tag wanderten aus sechs Dörfern, die de Valpelliers Lehen waren, die Bewohner mit Sack und Pack aus. Auch die Burg ließ Raoul räumen. Im Hauptort der Herrschaft de la Pie, Saint-Joseph-sur Eure, fanden die Menschen ein riesiges Zeltlager vor, in dem sie unterkommen konnten.
Henri du Puiset war ein Mann, der die Regeln der Ritterlichkeit achtete. Er setzte sein Heer so in Marsch, dass es Papoges, den Hauptort der Baronie Valpellier, erst am dritten Tag nach dem Erhalt des Fehdebriefes erreichte. Er hatte auch nicht vor, das Volk zu drangsalieren, sondern einzig und allein Raoul für seine Verbrechen zu bestrafen. Das Heer erreichte Papoges wie erwartet; was die Männer nicht erwartet hatten, war, dass keine Menschenseele zu sehen war, kein Stück Vieh auf den Weiden stand, kein einziger Söldner de Valpelliers sich blicken ließ. Es herrschte Totenstille, abgesehen vom Vogelgezwitscher, das lauter schien als gewöhnlich.
„Es sieht völlig verlassen aus, Vater“, bemerkte Armand. Henri nickte.
„Roland!“, rief er. Sein Großneffe schloss auf Aristides normannischem Hengst Rollo zu ihm auf.
„Onkel?“, fragte er.
„Reite zurück zu Stephane und bitte ihn, seine Reiter als Späher auszusenden. Mir kommt diese Stille seltsam vor.“
„Ich sage es ihm“, erwiderte Roland, wendete sein Pferd und ritt zu Stephane de la Pie, der mit seinen Männern die Nachhut bildete.
„Mylord, der Baron du Puiset bittet Euch, Eure Reiter als Späher auszusenden. Es kommt ihm seltsam vor, dass hier niemand zu sehen ist“, bat er den mit Henri befreundeten Baron.
„Kehre zurück zu deinem Herrn und sage ihm, dass ich bereits einen Teil meiner Männer als Späher eingesetzt habe“, erwiderte Stephane.
„Das werde ich. Danke, Mylord“, dankte Roland und ritt eilig zu Henri zurück.
„Baron Stephane hat bereits Späher ausgesandt“, meldete er.
„Gut“, nahm Henri die Meldung zur Kenntnis. „Da wir keinen Schlüssel zur Burg haben und niemand da ist, der uns das Tor öffnet, müssen wir das anders machen. Roland: die Schleuder!“, befahl Henri.
„Ja, Mylord!“, bestätigte Roland und rief seine Hilfskräfte zusammen, um die Schleuder aus den von Maître Ademar gelieferten Einzelteilen aufzubauen. Balian nahm derweil Messungen vor.
„Sieh mal:“, sagte er zu seinem Gesellen. „Diese kecke Wölbung dort am Torturm. Siehst du sie?“
„Ja“, erwiderte Roland.
„Ziele darauf. Dort ist die Mauer dünn“, gab Balian ihm einen Tipp.
„Wird gemacht“, bestätigte der Jungmeister. Die von ihm konstruierte Schleuder ließ sich dank eines eisernen Ringes auf dem Fahrgestell fast problemlos schwenken. Auch die Entfernungseinstellung war deutlich einfacher als bei anderen Schleudern. Der junge Mann hatte – unter Anleitung seines Meisters – zudem Peilhilfen ersonnen, die eine gute Kontrolle der Flugbahn ermöglichten.
Das Riesen-Trébuchet wurde vorbereitet, dann flogen Steine in Richtung Burgmauer. Sie schlugen tatsächlich an den Stellen ein, die Meister Balian bezeichnet hatte. Der Erfolg war buchstäblich durchschlagend: Der Torturm brach in sich zusammen, in der Mauer entstand eine gewaltige Lücke.
Henris Männer stürmten auf der Stelle die Mauerbresche, als plötzlich Hornsignale erschollen. Die Nachhut von Henris Heer, geführt von Stephane de la Pie, griff ohne Vorwarnung Henris Leute an, unterstützt vom Hausherrn der Burg, Raoul de Valpellier und dessen Gefolgsleuten, die sich vorsichtig in den Rücken von Henris Armee geschlichen hatten, geführt von den „Spähern“ de la Pies.
Mit den Leuten de la Pies hatten Raouls Söldner eine gewisse Überzahl – und das Überraschungsmoment auf ihrer Seite, denn mit einem solchen Verrat hatte in Henris Heer niemand gerechnet. Es war ein harter Kampf, bei dem Henri, seine Mannen und Sergeanten in Richtung Burg gedrängt wurden.
„Benoit: Verschwinde mit Meister Balian!“, wies Roland den Lehrling an, der ebenso wie er selbst als Sergeant für Henri mitgezogen war. Der talentierte Junge zog den Schmiedemeister, der selbst nicht kämpfen konnte, vom Schlachtfeld fort. Sie gelangten in einen Wald, in den sich noch mehr von Henris Leuten zurückzogen, während Roland seinem Großonkel und dessen Sohn die Flucht ermöglichte. Henri und Armand konnten mit einigen Getreuen aus der Umklammerung durch Stephanes und Raouls Leute ausbrechen und sich absetzen, während Roland und wenigstens fünfzig andere in die Burg getrieben wurden, dort gestellt und gefangen genommen wurden.
Als die Nacht hereinbrach, waren die gefangenen Männer Henris im Kerker der Burg Valpellier eingesperrt, Henri, Armand und ihre in Freiheit verbliebenen Gefolgsleute – einschließlich Benoit und Balian – befanden sich auf dem eiligen Rückmarsch nach Saint Martin.
Dort angekommen, war Henri du Puiset völlig konsterniert und entsetzt. Von den zweihundert Männern, die er nach Papoges geführt hatte, waren siebzig nicht zurückgekehrt, darunter sein Großneffe. Ob sie gefangen oder tot waren, wusste er nicht. Stephanes achtzig Männer, die den Verrat mitgemacht hatten, waren ebenso fort. Von den fünfzig Mann, die er überhaupt noch hatte, waren zwanzig kampfunfähig verwundet. Bei einigen war nicht sicher, ob sie überleben würden.
„Wie konnte das passieren?“, fragte Henri ungläubig, als er wieder in seiner eigenen Burg war und die Verluste realisiert hatte. Armand zuckte hilflos mit den Schultern.
„Dass Stephane so etwas tun würde, konnte keiner ahnen“, sagte er. „Was wird Raoul mit denen machen, die er vielleicht gefangen genommen hat?“
„Im schlimmsten Fall bringt er sie um. Aber ich denke, er wird mit ihnen als Geiseln versuchen, seine Forderungen durchzusetzen“, mutmaßte Henri.
Wir Recht er mit dieser Vermutung hatte, zeigte sich einige Tage später, als Raouls Herold eine Nachricht überbrachte:
Raoul de Valpellier grüßt Henri du Puiset.
Henri, Ihr habt den Kampf gesucht und habt ihn verloren. Fünfzig Eurer Sergeanten sind meine Gefangenen. Ich gebe sie frei, wenn Ihr folgende Forderungen erfüllt:
- Ihr übertragt mir die Dörfer Restignac, Bonville und Chaumur zu meinem Besitz.
- Ihr zahlt mir als Wiedergutmachung für den Schaden, den Ihr angerichtet habt, den Zehnt aller sieben Dörfer unter Eurer gegenwärtigen Herrschaft für die nächsten fünf Jahre.
- Ihr liefert den Mann aus, der die Schleuder ersonnen hat, die meinen Burgturm so zerstörte, dass der Wiederaufbau ein gutes Jahr dauern wird. Ich werde diesen Mann dafür hängen.
Sobald ich habe, was ich will, dürfen Eure Leute nach Hause. Tut Ihr das nicht, werden Eure Männer sterben.
Raoul de Valpellier, Baron von Valpellier“
Henri ließ den Herold warten und ihn verpflegen. Inzwischen diktierte er seinem Schreiber folgende Botschaft:
Henri du Puiset grüßt Raoul de Valpellier.
Raoul, Ihr habt die Fehde gewonnen, wenn auch durch Verrat eines meiner Verbündeten, doch ich kann Eure Forderungen nicht erfüllen.
Die Dörfer Restignac, Bonville und Chaumur sind ebenso wenig mein Eigentum wie Eure Lehensdörfer auch nicht Euer Eigentum sind. Sie sind mein Lehen, über das ich nicht frei verfügen kann.
Über den Zehnt kann ich mit Euch verhandeln, allerdings nur, wenn ich weiterhin aus allen sieben Dörfern auch Einkünfte habe.
Was den Konstrukteur der Schleuder betrifft: Der Mann, der sie erdacht hat, war ein Besucher aus dem Heiligen Land, der mein Haus vor über einem Jahr verlassen hat. Er hat als Gegenleistung für seinen Aufenthalt bei mir diese Schleuder konstruiert, weil ich ihn ausdrücklich dazu aufgefordert habe. Insofern kann ich ihn nicht ausliefern, selbst wenn ich es wollte.
Henri du Puiset, Baron von Saint-Martin-au-Bois.
Der Herold nahm die Botschaft mit und war drei Tage darauf wieder in Saint Martin mit einem neuen Schreiben von Raoul:
Raoul de Valpellier grüßt Henri du Puiset.
Henri, Eure Ausreden interessieren mich nicht! Ich bestehe auf die Herausgabe der Dörfer! Wenn Ihr darüber nicht selbst verfügen könnt, ist es an Euch, dafür zu sorgen, dass sich das ändert. Fordert also den Vizegrafen dazu auf, die Dörfer mir zu Lehen zu geben.
Was den Zehnt betrifft: Ich habe keine Verhandlungen angeboten, ich habe eine klare Forderung gestellt und werde nicht weniger akzeptieren als das, was ich gefordert habe. Ob Ihr Euch das leisten könnt, ist mir herzlich egal. Ihr konntet Euch leisten, mir die Fehde zu erklären, jetzt tragt auch die Folgen dessen, was Ihr angestellt habt.
Was den Kerl betrifft, der Euch dieses Schleuderinstrument an die Hand gegeben hat: Sollte er hier je wieder nach Saint Martin kommen, habt Ihr ihn auf der Stelle an mich auszuliefern! Ich will diesen Hund tot sehen!
Raoul de Valpellier, Baron von Valpellier
Henri antwortete Raoul nicht auf diese harsche Reaktion, sondern wandte sich an den Vizegrafen, den er um Hilfe bat. Er stellte ihm dar, dass er wegen des Verrats eines seiner Verbündeten die ihm gestattete Fehde verloren habe und nun erneut mit den von ihm, dem Vizegrafen, bereits abgelehnten Forderungen de Valpelliers konfrontiert sei, der fünfzig seiner Männer gefangen genommen habe, dass als Wiedergutmachung für eine erlaubte Kriegshandlung mehr als sein gesamtes Vermögen gefordert werde, denn Raoul wolle drei seiner Dörfer haben, aber für fünf Jahre den Zehnt von sieben Dörfern. Und obendrein solle er jemanden ausliefern, der ihm einen Gefallen getan habe, aber nicht sein Untertan sei und zudem seit mehr als einem Jahr nicht mehr in seinem Hause sei.
Ebrard du Puiset ließ ein Schreiben an Raoul de Valpellier aufsetzen, mit dem er ihn wegen der Lehensfrage zu sich beorderte. De Valpellier folgte dem Ruf seines Lehnsherrn, glaubte er doch, Ebrard werde ihm nunmehr endlich die Dörfer übertragen, der er haben wollte.
Als der Baron in Begleitung von zehn seiner Söldner in Chartres eintraf, ließ der Vizegraf ihn auch umgehend vor.
„Also, Baron de Valpellier: Ihr wollt immer noch Dörfer haben, die noch nie Euer Lehen waren. Ihr fordert zudem für fünf Jahre den Zehnt von allen sieben Dörfern, die bis jetzt Henri zu Lehen gegeben sind, wollt ihm aber überhaupt nur vier lassen. Und dann wollt Ihr jemandem Eurem Gericht überantwortet wissen, der Henri einen Gefallen tat, aber erstens längst Henris Haus verlassen hat und zweitens gar nicht dessen Untertan ist. Ist das so richtig?“, fragte Ebrard.
„Henri hat mich angegriffen und ist in der Fehde unterlegen. Er hat keine Rechte gegen mich, aber ich fordere Genugtuung von ihm für das, was bei mir zerstört worden ist“, rechtfertigte sich Raoul.
„Indem Ihr Dörfer haben wollt, mit denen ich Henri belehnt habe? Indem obendrein für sieben Dörfer den Zehnt für die nächsten fünf Jahre haben wollt, obwohl Ihr im gerade mal vier Dörfer lassen wollt? Und was ist das mit dem Mann, den Ihr richten wollt?“, fuhr der Vizegraf ihn an.
„Die Dörfer waren bisher nicht mein Lehen, richtig. Aber ich will sie nun erst recht haben. Zum Zehnt: Er soll sehen, wie er das Geld und die Naturalien zusammenbekommt. Das ist nicht mein Problem. Und den Konstrukteur dieser Teufelsmaschine, die mit einem Schlag meinen Burgturm zerstört hat, den will ich hängen sehen!“, beharrte de Valpellier. Ebrard schnaufte gereizt.
„Die Dörfer bleiben Henris Lehen! Ich werde sie Euch nicht überlassen. Zahlung: Ihr schuldet Henri noch etwas, nämlich die Kosten für den Wiederaufbau seiner Dörfer, die entgegen meiner Weisung angegriffen und zerstört habt. Ihr habt dazu noch gegen das Fehderecht verstoßen, indem Ihr nicht einmal die vorgeschriebene Drei-Tages-Frist zwischen Erklärung der Fehde und dem Angriff eingehalten habt! Ihr habt Euch erdreistet, Henris Schmied – den einzigen in seinen sieben Dörfern – zu verstümmeln und ihn so arbeitsunfähig zu machen! Nicht nur, dass Ihr – obwohl Henri die von Euch erklärte Fehde gewann – keinen Ersatz dafür geleistet habt, nein, Ihr setzt noch was drauf!“, wetterte Ebrard. „Ich habe jetzt wirklich genug! Ihr werdet die Gefangenen ohne weitere Forderungen freilassen, ihnen ihre Waffen und was Ihr ihnen sonst noch abgenommen habt, zurückgeben und Henri den ihm zustehenden Schadensersatz bezahlen! Und damit Ihr nicht auf dumme Ideen kommt, werden Euch meine Männer begleiten und sicherstellen, dass Ihr gehorcht. Euren Hauptmann und Eure Söldner, die Euch herbegleitet haben, nehme ich einstweilen in Verwahrung. Sie werden zu Euch zurückkehren, wenn Henri mir bestätigt, dass alle heil zu Hause angekommen sind und er das Geld, das er von Euch gefordert hat, um seine Schäden zu reparieren und einen neuen Schmied auszubilden, bis zum letzten Sou erhalten hat! Wache! Entwaffnet diese Herren und sperrt sie ein!“
Raoul de Valpellier war wie vom Donner gerührt. Die Wachen des Vizegrafen entwaffneten ihn und seine Männer und sperrten sie ein. Eine Stunde später holten die Posten Raoul wieder aus dem Kerker, damit er mit der zusammengerufenen Eskorte von hundert vizegräflichen Sergeanten nach Papoges reiten konnte, die sicherstellen sollte, dass die Weisung des Vizegrafen auch erfüllt wurde.
Zähneknirschend musste Raoul de Valpellier die Gefangenen freigeben und mit der von Henri geforderten Summe heimschicken.
In Saint Martin herrschte großer Jubel, als die Männer heimkehrten und auch das vom Baron geforderte Geld mitbrachten. Natalie erkannte unter den Heimkehrern Roland. Nichts hielt sie mehr in der Burg, als sie ihn sah. Sie rannte ihm entgegen und umarmte ihn fest.
„Ich hatte solche Angst um dich!“, schluchzte sie, als er die Umarmung erwiderte und sie küsste.
„Mit gutem Grund“, sagte er. „Ich danke Gott und meinen Kameraden, dass sie mich nicht verraten haben, sonst hätte Raoul mich umgebracht. Wie geht es deinem Vater und Benoit. Sind sie heil hergekommen?“
„Ja, das sind sie. Komm!“
Auch Balian und Benoit eilten den Heimkehrern entgegen, nahmen Roland voller Freude in Empfang.
Henri ließ die Freigelassenen in die Burg kommen und begrüßte sie dort.
„Ich danke Gott und unserem Vizegrafen, dass ihr wieder hier seid – und dass ihr mir das mitgebracht habt, was ich von Raoul haben wollte“, sagte er. „Wer bei Raouls Angriff geschädigt wurde, wird dafür Ersatz erhalten.“
Vor Roland blieb er stehen.
„Roland, ohne deinen tapferen Einsatz hätten Armand und ich aus der Umzingelung dieses verräterischen Mistkäfers Stephane nicht entkommen können. Knie nieder!“, forderte er ihn auf. Roland tat, wie ihm geheißen.
Henri ließ sich Rolands Meisterstück geben. Dann sagte er:
„Sei tapfer und aufrecht im Angesicht deiner Feinde, auf dass Gott dich lieben möge. Beschütze die Wehrlosen. Sprich stets die Wahrheit, mag es auch deinen Tod bedeuten. Halte dich an das Recht und tue kein Unrecht. Das ist dein Eid!“
Er holte aus und verpasste seinem Großneffen eine saftige Ohrfeige.
„Und das ist dafür, dass du ihn nicht vergisst!“, ergänzte er und überreichte Roland das von ihm selbst geschmiedete Schwert.
„Erhebe dich als Ritter, Roland von Ibelin!“, sagte er. Roland stand auf und nahm das Schwert mit einer artigen Verbeugung an.
„Ich danke Euch“, erwiderte er.
Den Sergeanten, die nach Chartres zurückkehrten, gab Henri die Erklärung mit, dass die Gefangenen frei seien und er den verlangten Ersatz erhalten habe. Gleichzeitig bat er darum, im Wald zwischen Restignac und Bonville eine zweite Burg bauen zu dürfen, die dem Volk von Restignac, Bonville und Chaumur als Zuflucht dienen sollte.
Kapitel 13
Missgunst
Henri bekam wenig später, es war Anfang September, die Genehmigung des Vizegrafen, eine zweite Burg zu bauen. Er bat Roland zu sich, der nach wie vor im Haus seines Meisters lebte. Einerseits hatte er sich daran gewöhnt, andererseits brauchte die Familie ihn, zumal Michel zum Advent endgültig ins Kloster gehen würde. Benoit war talentiert, brauchte aber noch viel Unterstützung, die Balian mit nur einer Hand nicht geben konnte. Dazu wollte er von Natalie nicht mehr getrennt sein.
„Ihr habt mich rufen lassen, Mylord?“, meldete er sich bei seinem Onkel.
„Roland, ich habe die Genehmigung für die neue Burg im Wald. Du hast eine gute Zeichnung für diese komplizierte Wurfmaschine gemacht“, sagte Henri. „Kannst du das auch für eine Burg?“
„Ich habe es noch nie gemacht, aber ich will es gerne versuchen“, erwiderte Roland.
„Dann fang damit an!“, wies sein Onkel ihn an und gab ihm Pergament mit.
Als er wieder in der Schmiede war, setzte er zunächst die Arbeit dort fort. Nach dem Abendessen blieb er noch unten im Haus sitzen und widmete sich im Licht einiger Kienspäne der erbetenen Zeichnung.
„Willst du nicht schlafen gehen?“, fragte Natalie besorgt.
„Nein, ich habe noch zu tun. Mein Onkel möchte eine Konstruktion für eine neue Burg. Ich will ihn nicht lange warten lassen“, erwiderte er.
„Aber so etwas machen doch Baumeister!“, wunderte sie sich.
„Ich weiß. Ich versuche es. Wenn es ihm nicht zusagt, wird er um den Baumeister nicht herumkommen“, lächelte er.
„Na schön, versuche es. Aber denk daran, dass morgen früh bei Sonnenaufgang die normale Arbeit wieder anfängt“, erinnerte sie.
„Das werde ich nicht vergessen“, erwiderte er. Sie schenkte ihm gleichfalls ein Lächeln und gab ihm einen sanften Kuss auf die Wange, auf der sich seit seiner Gefangenschaft der erste Bartflaum zeigte.
„Gute Nacht“, sagte sie.
„Gute Nacht. Schlaf gut“, erwiderte er. Sie ging in das Halbgeschoss hinauf.
„Wo ist Roland?“, fragte Michel, der sich schon an den Schornstein kuschelte.
„Er soll noch etwas für den Baron zeichnen.“
„Und was?“
„Eine Burg.“
„Jetzt ist er schon Baumeister, was?“, spottete Michel und erntete einen vernichtenden Blick seines Vaters.
„Wenn der Baron das von ihm fordert, ist Spott unangebracht, mein Sohn!“, wies er ihn zurecht.
„Ja, schon gut“, knurrte Michel und drehte sich um. Kopfschüttelnd sah Balian ihn an, legte sich dann selbst hin und war bald eingeschlafen.
Heller Mondschein, der durch ein mit Pergament bespanntes Fenster im oberen Stock fiel, weckte Natalie wieder auf. Sie sah sich um und fand Roland auf seinem Schlafplatz neben ihrem Vater. So, wie er im Schlaf lächelte, hatte er einen schönen Traum. Dabei wollte sie ihn auf keinen Fall stören. Sie legte sich wieder hin, schlief ein – und träumte von Roland.
Am folgenden Morgen schickte Roland Benoit in die Schmiede, um das Feuer anzufachen und die Mauereisen für die in Saint Martin im Bau befindliche Kirche vorzubereiten. Er selbst ging zunächst zur Burg, um seinem Onkel die erbetene Zeichnung zu geben.
Henri saß noch mit Armand beim Frühstück, als Remy Roland einließ.
„Guten Morgen, Mylord. Ihr hattet um eine Zeichnung für die neue Burg im Wald gebeten. Hier ist sie“, sagte der junge Mann.
Henri nahm ihm die Zeichnung ab. Es war eine sternförmige Festung mit Ecktürmen, die einem frontalen Angriff mit ihrem rautenförmigen Grundriss fast keine Fläche boten.
„Alle Achtung, Junge! Ich werde das mit Maître Paul besprechen“, nahm Henri die Zeichnung entgegen. „Danke. Hast du einen Wunsch?“
Roland lächelte.
„Ja. Ich hätte gerne Eure Erlaubnis, um Natalie, Meister Balians Tochter, heiraten zu können“, sagte er. Armand verschluckte sich fast, Henri ging es kaum besser.
„Roland, du bist noch nicht mündig!“, erinnerte der Baron erschrocken.
„Deshalb bitte ich ja um Eure Erlaubnis. Ihr seid im Moment der Einzige, der mit mir verwandt ist, mir übergeordnet ist und mir deshalb die familiäre Erlaubnis zu Heirat geben kann“, erwiderte Roland. Henri lehnte sich zurück.
„Und was ist mit Natalie? Was sagt ihr Vater zu deinen Absichten?“, fragte er.
„Ich habe beide noch nicht gefragt, weil ich erst Euch um Erlaubnis bitten wollte.“
„Vater, nein! Der Bengel ist doch noch viel zu grün dafür!“, protestierte Armand.
„Du bist jetzt …?“, fragte der Baron, ohne auf den Einwand seines Sohnes einzugehen.
„Siebzehn, Mylord. Im Januar werde ich achtzehn“, erwiderte Roland.
„Es sind schon Leute mit fünfzehn Jahren verheiratet worden“, bemerkte Henri. „Du bist Meister, du bist Ritter. Damit kannst du trotz deiner fehlenden Jahre als mündig betrachtet werden. Also, wenn dein Meister Balian einverstanden ist, dann heirate deine Natalie.“
„Ich danke Euch, Mylord!“, erwiderte Roland mit einer Verbeugung und verließ die Burg, um seiner normalen Arbeit nachzugehen. Armand sah seinen Vater verstört an.
„Aber ich wollte Natalie heiraten!“, protestierte er.
„Natalie ist keine passende Partie für dich, mein Sohn“, widersprach Henri. „Du sollst dieses Lehen erben. Da gehört sich eine standesgemäße Ehe! Befasse dich mit einer Ebenbürtigen!“
„Ah, du spekulierst wohl auf das Recht der ersten Nacht, Vater“, hakte Armand nach. „Sowie bei ihrer Mutter Julie, was?“
„Dieses Recht gibt es ohnehin nur für eine Ehe, in der beide Eheleute meine Untertanen sind. Roland ist nicht mein Untertan – und durch den Ritterschlag selbst von Adel. Da kommt dieses Recht sowieso nicht in Betracht“, entgegnete sein Vater.
„Wieso hast du diesen Nichtsnutz eigentlich zum Ritter geschlagen? Er hat nicht mehr getan, als seine Pflicht erfüllt!“, grollte Armand. Henri sah seinen Sohn eine Weile an.
„Mein lieber Junge“, sagte er dann, „es ist einfach eine Tatsache, dass Balian Roland der Sohn meines Cousins Balian ist, mag er nach unserem Recht auch in einer ungültigen Ehe geboren sein, weshalb ihm hierzulande auch kein Adelstitel per Geburt zustünde. Aber seine Eltern sind beide von Adel. Das ist das Eine. Das Andere ist, dass er sich tapfer geschlagen hat und durch seinen Einsatz und sein eigenes Opfer dafür gesorgt hat, dass du und ich entkommen konnten. Eigentlich, mein Sohn, wäre es deine Aufgabe gewesen, mich zu retten. Deshalb hat dein Cousin sich den Ritterschlag verdient“, grollte Henri. „Noch was zum Recht der ersten Nacht: Balian weiß es nicht. Sein Sohn Michel ist meiner – und er ist genauso ungeraten wie du!“
Armand war wie vor den Kopf geschlagen.
„Mi… Michel soll mein Bru… Bruder sein?“, stotterte er entsetzt.
„Halbbruder, mein Sohn, Halbbruder. Und ohne Erbrecht für das Lehen. Für die Schmiede genau genommen auch, aber Balian würde ihm die Schmiede ohnehin nicht vermachen. Wenn Roland sie nicht haben will, was ich annehme, wird er sie an Benoit weitergeben. Der Junge hat Talent – im Gegensatz zu Michel.“
Roland kehrte in die Schmiede zurück. Balian empfing ihn mit einem breiten Grinsen.
„Junge, wir haben einen großartigen Auftrag: Der Bischof hat neues Altargeschirr bestellt! Altarkreuz, Kelch, Patene*, Kännchen für Wein und Wasser und einen Behälter für Weihrauch samt Löffel!“, jubelte der Meister.
„Holla! Haben wir denn Gold hier?“, fragte Roland erschrocken und erfreut zugleich. Balian wies auf eine kleine Truhe, die normalerweise nicht in der Schmiede stand.
„Hat der Bischof mitgebracht. Silber für die Gefäße, Gold für die Vergoldung der Innenseite des Kelches und der Patenen-Fläche!“, grinste Benoit.
„Dann fange ich am besten gleich damit an“, nickte Roland. „Oder hast du noch etwas, was dringender zu erledigen ist?“
„Nein, Benoit hat schon ein Dutzend Mauereisen gemacht und Hufeisenrohlinge geschmiedet.“
„Gut. Aber ich habe noch ein Anliegen, Meister.“
„Und das wäre?“
„Ich bitte dich um Natalies Hand. Ich liebe sie und möchte sie heiraten“, sprach Roland seine Werbung aus. Balian musste sich setzen.
„Du … du willst meine Tochter heiraten? Du, ein Ritter?“
„Balian, ich habe bei dir gelernt, dass Adel oder ein Ritterschlag kein höheres Wesen aus mir macht. Ich habe gelernt, dass das so genannte gemeine Volk nicht weniger wert ist als der Adel. Mein Onkel ist von Standesdünkeln zerfressen, mein Cousin ist ein Rüpel, dem das Leben des einfachen Volkes nichts bedeutet. Auch wenn ich der Sohn von Adligen bin, bin ich nicht besser als du“, erwiderte Roland. Balian lächelte verschmitzt.
„Und … was sagt Natalie dazu?“, fragte er.
Ich wollte sie nicht ohne deine Erlaubnis fragen, so wie ich dich nicht ohne Zustimmung meines Onkels fragen wollte. Seine Erlaubnis habe ich.“
„Und ich gebe dir meine Erlaubnis nicht – wenn du vorher nicht auch Natalie gefragt hast“, grinste der Schmiedemeister.
„Dann erlaube mir, sie zu fragen.“
„Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, Meister Roland“, versetzte Balian schmunzelnd. „Aber sei unbesorgt: Ich werde sie keinem anderen zur Frau versprechen, bevor du sie heute Abend fragen kannst. An die Arbeit!“
Roland betrachtete das schon als halbe Zustimmung und machte sich mit Elan an die Arbeit, für den Bischof das bestellte Altargeschirr herzustellen. Balian konnte nicht umhin, die Geschicklichkeit des jungen Meisters zu bewundern, der an diesem Tag das Altarkreuz und den Kelch fertigte. Es waren wunderschöne Silberarbeiten, die sein designierter Nachfolger fabrizierte.
Gegen Abend holte er aus seinem Gelddepot einen Denier, den er eher in Eile zu einem Verlobungsgeschenk umgestaltete: Zu einem Kreuzanhänger, der seine eigentlich vorhandene handwerkliche Präzision nur unvollkommen widerspiegelte. Als er vor Natalie kniete und sie um ihre Hand bat, nahm sie seinen Antrag und sein Geschenk überglücklich an.
„Ja, Roland. Ja, ja, ja!“, rief sie. Er umarmte sie und küsste sie.
„Nun, meister Balian: Deine Tochter ist einverstanden, meine Frau zu werden. Jetzt frage ich dich: Erlaubst du mir, deine Tochter Natalie zu heiraten?“, wandte er sich an den arbeitsunfähigen Meister.
„Ja, mein Junge, ja! Ihr habt meinen Segen“, erwiderte der. „Roland, wenn du das Altargeschirr bei Bischof Guillaume ablieferst, dann bestell doch gleich das Aufgebot, damit ihr bald heiraten könnt“, schlug er vor.
„Das werde ich“, versprach Roland und nahm Natalie erneut in den Arm.
Am folgenden Tag fertigte er den Rest der Silberarbeiten, vergoldete Kelchinneres und die Patenen-Fläche. Am nächsten Tag wollte er nach Chartres reiten, um dem Weihbischof Guillaume die Sachen zu bringen, der dort beim Erzbischof zu Besuch weilte.
Michel, der von Armands Absicht wusste, Natalie wenigstens zu seiner Mätresse zu machen, wusste genug. Er verließ das Haus, um Armand zu unterrichten. Seinem Vater sagte er, dass er für seine erste Weihe noch etwas vorbereiten wolle. Er stand jetzt unmittelbar vor der Weihe zum Subdiakon, die ihn schon zum zölibatären Leben verpflichten würde.
Kapitel 14
Intrige
Armand ließ Michel auch nicht lange warten, als dieser ihn um eine Unterredung bat.
„Was bringst du?“, fragte der Sohn des Barons.
„Mein Vater hat zugestimmt, dass Roland meine Schwester Natalie heiratet. Roland bringt morgen Altargeschirr, das der Bischof bestellt hat, nach Chartres und will dann gleich das Aufgebot bestellen“, erklärte Michel.
„Danke. Dann werde ich dafür sorgen, dass er dort gar nicht erst ankommt“, erwiderte Armand. „Sag mal, du wirst bald zum Subdiakon geweiht, oder?“
„Ja.“
„Willst du wirklich Geistlicher werden oder ist das der Wunsch von Meister Balian?“, hakte Armand nach. Michel zuckte mit den Schultern.
„Es ist sein Wunsch, weil ich nicht zum Handwerker tauge. Aber ob ich ein besserer Priester wäre …“, entgegnete er.
„Wahrscheinlich so wenig wie ich. Und seit gestern weiß ich auch warum: Meister Balian ist gar nicht dein Vater, sondern mein Vater Henri. Ich werde eines Tages sein Lehen erben und würde dich gern als meinen Bruder zum Hauptmann machen. Aber dafür musst du kämpfen lernen. Willst du das?“
Michel war von dieser Entwicklung mehr als nur überrascht. Zwar hatte er sich schon häufiger gefragt, weshalb er so gar nicht als Handwerker zu gebrauchen war, aber dieser Umstand bot ihm die Antwort auf seine Frage.
„Wenn Ihr meint, dass ich dazu fähig bin, wenn ich nicht mal einen Hammer richtig halten kann, gerne. Aber ist das überhaupt möglich? Wenn Euer Vater auch der meine ist, bin ich unehelich und habe weniger Rechte als ein normaler Mensch aus dem einfachen Volk“, erinnerte Michel.
„Nun, mein Vater hat Roland, der nach unseren Gesetzen auch unehelich ist, zum Ritter geschlagen. Dann ist das auch bei dir möglich, schließlich ist dein leiblicher Vater adlig. Du solltest der Weihe zum Subdiakon dann aber aus dem Weg gehen. Sonst wird es nichts mit dem Hauptmann.“
„Dann will ich sehen, ob ich das noch verschieben kann“, erwiderte Michel. Armands Angebot eröffnete ihm einen völlig neuen Weg, von dem er bisher nicht einmal etwas geahnt hatte.
Der Morgen kam, und Roland sattelte sich Rollo, den er erneut von Aristide ausgeliehen hatte, um das Altargeschirr nach Chartres zu bringen. Er ritt zur Kreuzung, um dann den Weg hinunter nach Chartres zu nehmen. Natalie winkte ihm nach, bis er dort im Wald verschwand.
Der Weg führte bis Monbartier durch den Wald, doch so weit kam er gar nicht. Etwa auf der Hälfte des Weges nach Monbartier kamen sechs Bewaffnete hinter einem Eibendickicht hervor, die Masken trugen und ihn ohne Vorwarnung angriffen. Roland konnte nicht einmal mehr das am Sattel hängende Schwert ziehen, um sich zu verteidigen. Ein harter Schlag auf den Kopf ließ ihn das Bewusstsein verlieren. Er stürzte vom Pferd, das ausbrach und nach Saint Martin zurückjagte. Einer der Maskierten fluchte laut, aber der Schwarze Normanne, den Aristide erst wenige Jahre zuvor vom Vizegrafen von Rohan* als Lohn für einen Dienst erhalten hatte, war viel zu schnell, um ihn einzuholen.
Die Maskierten stiegen von ihren eigenen Pferden, hoben den bewusstlosen Roland auf, legten ihn quer über die Kruppe des Pferdes eines ihrer Kameraden, nachdem sie ihn gefesselt hatten.
„Los, ab zur Höhle!“, befahl einer der Maskierten. Die Männer ritten eilig weiter in Richtung Monbartier, verließen den Weg aber noch vor dem Dorf und ritten quer durch den Wald in Richtung Nordwesten, Richtung Restignac und unterhalb der Ebene von Saint-Martin-au-Bois.
Dort, im Wald zwischen Restignac und Bonville, hatte Armand du Puiset eine Höhle entdeckt, die als Fundament für die geplante neue Burg dienen konnte. Roland wusste davon nichts und hatte sie deshalb auch nicht in seiner Zeichnung berücksichtigt.
Auf dem halben Weg dorthin kam Roland wieder zu sich und fand sich auf der Kruppe eines Dextrarius, eines Schlachtrosses. Er konnte erkennen, dass das Tier braunes Fell, zwei weiße Hinterfesseln und einen weißen Fleck an der rechten Flanke neben dem Sattelgurt hatte. Als er sich aufrichten wollte, bemerkte ein nachfolgender Reiter, dass er aufwachte und zog ihm mit einem Knüppel nochmals eins über den Kopf, so dass er erneut das Bewusstsein verlor.
Wenig später hatten die Maskierten die Höhle erreicht, die nicht weit vom Waldweg lag, der in Richtung Westen nach Restignac und in Richtung Osten nach Bonville führte. Sie luden den nach wie vor Bewusstlosen ab und beförderten ihn in die Höhle, die Armand am Tag zuvor eilig vorbereitet hatte. Einer der Maskierten nahm die Maske ab. Darunter kam Armand du Puiset zum Vorschein, der sich zunächst davon überzeugt hatte, dass Roland weggetreten war. Er löste Rolands Fesseln und schloss ihn mit einer eisernen Kette an einem eisernen Ring an, den er mit einem unterarmlangen Spieß so tief in eine Felsritze getrieben hatte, dass er selbst nicht wieder hatte herausziehen können. Eine kleine Öllampe, wie sie in Kirchen in Europa als Ewiges Licht am Tabernakel verwendet wurde, gab ein wenig Licht.
Die Maskierten – außer Armand selbst fünf seiner Sergeanten – verschlossen die Höhle mit dichtem Brombeergebüsch und kehrten über Bonville nach Saint Martin zurück, jedoch nicht, ohne noch einige Stücke Wild zu jagen, waren sie doch im Morgengrauen aufgebrochen, um zu jagen, wie Armand seinem Vater gesagt hatte.
Rollo, Aristides Rapphengst, der ledig nach Saint Martin zurückkehrte, löste Besorgnis bei den Bewohnern des Dorfes aus. Aristide eilte zu Meister Balian und sagte ihm, dass Rollo reiterlos zurückgekehrt war. Die Dorfbewohner stellten einen Suchtrupp zusammen. Weil Roland über Monbartier nach Chartres hatte reiten wollen, suchten die Leute auch auf dem Weg nach dort.
Aristide fand schließlich die Spuren des Überfalls, auch die Spuren, die davon wegführten. Doch schon bald verlor er die Spur an felsigem Untergrund und dem nachfolgenden Nadelteppich alter Tannen, der nur dann eine Spurzeichnung zugelassen hätte, wenn die Entführer in schnellem Galopp geritten wären.
„Ende!“, seufzte der Bauer. „Wenn die Leute schlau waren, sind sie hier in langsamem Schritt geritten. Die können sonstwo hin geritten sein. Ohne Spuren können wir sie nicht weiter verfolgen“, stellte er fest. „Gehen wir zurück. Der Baron muss erfahren, dass Roland etwas zugestoßen ist.“
Betrübt kehrten die Dorfbewohner am späten Nachmittag nach Saint Martin zurück und meldeten zunächst Meister Balian, dass der junge Meister überfallen und entführt worden war.
„Es waren wohl keine Räuber, denn die Ware, die Roland bei sich hatte, ist noch in den Satteltaschen“, schloss Aristide seinen Bericht. Balian musste sich setzen, weil er weiche Knie bekommen hatte. Wenn Raoul de Valpellier dahinter steckte, lebte Roland möglicherweise gar nicht mehr. Es dauerte eine Weile, bis er sich einigermaßen gefangen hatte.
„Aristide“, bat er schließlich, „tust du mir einen Gefallen?“
„Und der wäre?“
„Reite nach Chartres und bring das Altargeschirr zu Bischof Guillaume. Er wartet darauf. Ich gehe zum Baron und sage ihm, dass Roland verschwunden ist.“
„Ich reite nach Chartres“, versprach Aristide. Balian und er verließen die Schmiede. Der Bauer eilte zu seinem Hof, der Schmied zur Burg, um den Baron zu unterrichten.
„Wie bitte? Entführt?“, keuchte Henri, der mit Armand gerade beim Abendessen saß, als Balian ihn aufsuchte.
„Ja, Mylord. Aristide und andere haben Spuren eines Überfalls auf halbem Weg nach Monbartier gefunden. Rollo ist allein zurückgekehrt, hatte aber noch die Ware bei sich, die Roland in Chartres abliefern wollte. Es ging denen, die ihn überfallen haben, also nicht um das Silber, sondern um ihn selbst.“
„Wer könnte so etwas tun?“, fragte Henri. Sein Sohn zuckte mit den Schultern.
„Vielleicht jemand, der Lösegeld erpressen will?“, mutmaßte er.
„Und wer kommt auf die Idee, für Roland Lösegeld haben zu wollen? Er lebt hier ja nicht als mein Neffe zweiten Grades, sondern als Schmied. Und das weiß außerhalb dieses Lehens kein Mensch – mein Bruder Guillaume ausgenommen, aber gerade der würde Roland nichts antun! Für einen einfachen Mann, für den man ihn außerhalb meines Lehens halten muss, wäre schon das Schwert, das er am Sattel hatte, mehr als genug Auslöse, ganz zu schweigen von dem Silbergeschirr, das er bei sich hatte “, entgegnete Henri.
Erneutes Schulterzucken von Armand.
„Dann bleibt uns nichts, als abzuwarten, ob eine Forderung gestellt wird“, erwiderte er und konnte seinen eigenen Schock gerade noch tarnen. Sein Plan geriet gerade mächtig ins Wanken. Er hatte geplant, dass er Raoul die Geschichte in die Schuhe schieben wollte. Doch jetzt wurde ihm klar, dass de Valpellier erneut Tribut und Dörfer fordern würde. Und wenn sein Vater darauf eingehen würde und beim Vizegrafen doch erreichen konnte, die Dörfer für die Freilassung seines Neffen abtreten zu können und auch den Tribut leistete, hätte er selbst nur noch vier Dörfer zu erben – und eine Menge Schulden, denn Raoul würde sich kaum mit den bisherigen Forderungen zufrieden geben. Ging sein Vater nicht darauf ein und wandte sich an den Vizegrafen, um Raoul zu bestrafen, würde spätestens nach dessen Festnahme der Betrug auffliegen.
Er überlegte angestrengt, wie er Roland endgültig loswerden konnte, ohne dass Raoul de Valpellier ins Spiel kam. Sein Vater deutete seine Nachdenklichkeit zu seinem Glück falsch, vermutete Henri doch, dass sein Sohn einen Plan entwarf, wie er Roland finden und befreien konnte.
In der Höhle kam Roland wieder zu sich und fand sich an die Höhlenwand gekettet wieder. Das kleine Licht, das an der gegenüberliegenden Wand hing, genügte, um ihn erkennen zu lassen, dass er nicht in einem richtigen Kerker gelandet war. Er brauchte eine Weile, um wieder ganz klar im Kopf zu werden.
Als er seine fünf Sinne wieder beisammen hatte, untersuchte er mit der freien linken Hand seinen rechten Stiefel und fand, wonach er suchte: den Dietrich, den er sich kurz nach seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft gemacht hatte. Mithilfe des Dietrichs konnte er die Kettenschelle öffnen. Er wunderte sich nicht schlecht, als er die Kette mit dem Licht der kleinen Lampe näher beleuchtete und feststellte, dass sowohl die Schelle als auch das Endglied der Kette Meister Balians Handwerkermarke trugen – ebenso wie der Ring, der an der Höhlenwand befestigt war. Mit dem Licht suchte er einen Weg nach draußen und fand ihn auch recht schnell.
Als er die Höhle verließ, war die Sonne gerade untergegangen. Er blies das Licht aus und deponierte es hinter dem Brombeerbusch, den er wieder über den Höhleneingang zog. Dann sah er sich um. Der halbwegs gerade Waldweg, der nicht weit von der Höhle entfernt daran vorbei führte, sah sehr nach dem Weg zwischen Bonville und Restignac aus. Auch die Lichtverhältnisse, die den Sonnenuntergang links von der Höhle nahelegten, ließen Roland annehmen, dass rechts herum der Weg nach Bonville führen musste. Die Erkenntnis traf ihn wie ein Schlag.
‚Wenn es stimmt, dass ich im Wald zwischen Bonville und Restignac eingesperrt wurde, müssen sich meine Entführer im Lehen von Onkel Henri auskennen. Beritten kommen dann nur die Söldner meines Onkels infrage, denn außer ihnen hat nur noch Aristide ein Dextrarius-Pferd – aber dessen Schwarzen Normannen habe ich selbst geritten. Besser mich sieht hier niemand‘, dachte er. Er sah sich vorsichtig um und verließ dann den Weg, schlug sich lieber zwischen den Büschen an der Seite durch, als deutlich erkennbar auf dem Weg zu laufen.
Seine Vorsichtsmaßnahme kam keinen Moment zu früh, denn an dem Ende des Weges, in dessen Richtung er ging, erschienen Reiter auf Schlachtrössern. Er duckte sich zwischen die Büsche.
‚Das ist das erste Mal, dass ich Onkel Henri für seinen Hochmut dankbar bin. Hätte er mich nicht zum einfachen Mann degradiert, würde ich bestimmt prächtigere Kleidung tragen, die auch in der Dämmerung erkennbar ist. Die dunkle Kleidung des einfachen Volks und die fallende Dunkelheit machen mich fast unsichtbar‘, dachte er und duckte sich noch etwas tiefer zwischen die Büsche, konnte die Reiter aber beobachten. Sie waren maskiert, eines der Pferde hatte zwei weiße Hinterfesseln.
Tatsächlich ritten die Männer an ihm vorbei, ohne ihn zu bemerken und stoppten bei der Höhle, wie Roland bemerkte, als er ihnen vorsichtig hinterher schaute.
Die Männer saßen ab, einer zog den Brombeerbusch beiseite.
„Wieso ist das Licht hier? Ist der etwa …“, hörte er einen grollen. Die Maske ließ ihn aber die Stimme nicht erkennen.
„Bei allen Teufeln der Hölle! Er ist weg! Los, sucht ihn!“, hörte Roland den schimpfen, der die Höhle untersucht hatte.
„Es ist dunkel. Den finden wir nicht mehr, so dunkel wie er gekleidet ist!“, widersprach ein anderer.
„Er kann schon wer weiß wann ausgerissen sein. Wäre er eben erst geflohen, hätten wir ihn sehen müssen, denn es gibt nur diesen Weg durch den Wald“, gab ein weiterer zu bedenken.
„Roland ist nicht auf den Kopf gefallen, auch wenn du ihm ordentlich eins übergezogen hast!“, versetzte der, der die Höhle kontrolliert hatte. „Er wird gemerkt haben, wo er ist, spätestens, als er am Waldrand ankam. Wir suchen in Restignac!“, entschied er.
„Und wenn er dort nicht ist?“
„Dann stellen wir Bonville auf den Kopf!“
„Entschuldige, wenn ich dem nicht ganz folgen kann. Wie willst du Leuten aus den Dörfern erklären, dass wir in deren Häusern nach Roland suchen, von dem inzwischen wohl jeder weiß, dass er entführt wurde?“
„Zerbrich dir nicht meinen Kopf!“
„Nein, aber ich würde meinen gern noch ein Weilchen behalten. Roland weiß nicht viel. Er war bewusstlos, als wir ihn herbrachten. Selbst wenn er sich wieder zurechtfindet, weiß er noch lange nicht, wer ihn überfallen hat. Er hat keinen Beweis gegen uns. Es könnten ja auch Leute von de Valpellier gewesen sein. Der Lump will die Dörfer hier um den Wald herum haben, also wird er sich hier wohl auskennen. Wolltest du nicht sowieso de Valpellier die Geschichte in die Schuhe schieben?“
Der Mann, der aus der Höhle gekommen war, stieg wieder auf sein Pferd.
„Ja, wollte ich. Aber das wird so nicht gehen. Würde er Forderungen stellen, würde mein Vater sich sofort an den Vizegrafen wenden. Wenn der eingreift, fliegt die Geschichte auf. Nein, das wird nichts.“
Die Reiter kamen langsam wieder in Rolands Richtung. Er duckte sich wieder in die Büsche und ließ die Leute passieren.
„Wir hätten das Silberzeug mitnehmen sollen. Dann könnten wir ihm wenigstens anhängen, dass er sich damit aus dem Staub machen wollte“, bemerkte der erste Sprecher, der auf dem Pferd mit den zwei weißen Hinterfesseln saß. Ob das Tier auch den weißen Fleck an der rechten Flanke hatte, konnte Roland in der Dunkelheit nicht erkennen. Ihm war nun zwar klar, dass sein Cousin Armand hinter der Entführung steckte, aber es stimmte auch, dass er keinen wirklichen Beweis gegen ihn und seine Gefolgsleute hatte.
Zu seinem Glück setzten die Männer ihre Pferde in Galopp und verschwanden rasch in Richtung Bonville. Roland überlegte, was er nun tun sollte. Genau genommen konnte er niemandem trauen, erst recht nicht Berittenen seines Onkels. Dann fiel ihm etwas ein: Er war einige Zeit zuvor mit Benoit im Wald auf Pilzsuche gewesen, um den gar zu monotonen Speiseplan etwas aufzubessern. Sie hatten mehrere Sonntage hintereinander im Wald zugebracht und waren an diesem Weg herausgekommen und hatten auch zurückgefunden. Der Wald war keineswegs so weglos, wie die Sergeanten seines Onkels annahmen. Aber es war zu dunkel, um den Weg zu finden.
Er kehrte nochmals zur Höhle zurück und holte von dort die kleine Lampe, entzündete sie mithilfe von Feuerstein und Zunder, die in einem kleinen Depot in der Felswand lagen. Das Licht reichte dann aus, um durch den Wald nach Saint Martin zurückzufinden. Als der Morgen dämmerte, erreichte er das Dorf.
Der Erste, der ihm begegnete, war Benoit, der gerade in die Schmiede wollte, um das Feuer zu entfachen.
„Roland!“, rief er. „Dem Himmel sei Dank! Du bist wieder da!“
Sein Ruf blieb nicht ungehört. In Windeseile standen zahlreiche Dorfbewohner um ihn.
„Was ist geschehen? Wo warst du?“, fragte Aristide.
Roland berichtete, was er selbst wusste, sparte aber aus, dass er aus dem Gespräch seiner Entführer vor der Höhle herausgehört hatte, dass der Kopf der Bande sein Cousin Armand war.
„Die müssen sich hier aber gut auskennen …“, bemerkte Aristide. „Hast du einen Verdacht?“
„Ja, aber bevor ich den laut äußere, muss ich Beweise haben, die den Baron auch überzeugen“, erwiderte Roland.
„Du solltest dich bei deinem Onkel zurückmelden“, empfahl der Bauer.
„Das werde ich.“
Kapitel 15
Ermittlung und Enthüllung
Roland ging zur Burg. Unter den Posten, die das Tor bewachten, waren auch jene, die ihn einmal aufgehalten hatten. Jetzt stand beiden das blanke Entsetzen im Gesicht, als sie ihn sahen. Beide konnten es zwar tarnen, aber nicht rechtzeitig genug für Roland.
„Oh, der verlorene Sohn ist wieder da!“, hustete Severin spöttisch.
„Ja, mit dem Unterschied, dass ich nicht freiwillig fortgegangen bin, nicht mein Erbe in fremdem Land durchgebracht habe und auch nicht reumütig zurückkehre, sondern als schuldloses Opfer einer Entführung“, versetzte Roland in Anspielung auf die biblische Geschichte vom verlorenen Sohn. „Wo ist mein Onkel? Ich will mich bei ihm zurückmelden.“
„Im Rittersaal, Mylord Roland“, gab Claude Auskunft.
„Danke, Mylord Claude.“
Roland ließ die beiden verdatterten Posten stehen.
„Du hättest es beinahe vermasselt, Severin!“, knurrte Claude, als Roland außer Hörweite war.
Henri empfing seinen Neffen zweiten Grades voller Freude im Rittersaal.
„Roland, mein Junge! Was ist passiert? Wo warst du?“, fragte der Baron, als er den Vermissten umarmte. Roland berichtete auch ihm, was er wusste, sparte aber auch hier sein Wissen um Armands Mittäterschaft aus, weil ihm nur sein eigenes Wissen als Beweis nicht ausreichend erschien. Henri grinste schadenfroh.
„Dann warten wir doch mal ab, ob noch eine Forderung gestellt wird. Ich bin nur froh, dass du lebend und gesund wieder hier bist. Aristide hat das Altargeschirr in Chartres abgegeben und hat Bischof Guillaume gesagt, dass er – falls du gesund zurückkehrst – auf ein Aufgebot für deine Hochzeit verzichtet und umgehend herkommt, um dich und Natalie zu trauen. Ich will ihn gleich in Kenntnis setzen.“
„Warte bitte, Onkel Henri. Natalie und ich haben ja noch nicht mal einen Tag ausgemacht!“, bremste Roland den Eifer seines Onkels.
„Na schön. Dann frag deine Natalie und gib mir Bescheid, wenn du den Tag weißt.“
„Das werde ich.“
„Bist du schon wieder in der Lage zu schmieden?“
„Ich bin die ganze Nacht gelaufen. Lass mir noch Zeit bis morgen. Dann stehe ich dir wieder zur Verfügung.“
Roland verließ die Burg und kehrte in die Schmiede zurück, wo er von Balian und Natalie freudig empfangen wurde, die beide noch im Haus gewesen waren, als er aus dem Wald gekommen war.
„Wir hatten große Angst um dich, Roland. Es wurde schon spekuliert, du wärst wieder in die Fänge von de Valpellier geraten“, sagte der Schmiedemeister.
„Dem Herrn sei Dank – nein. Sonst würde ich wohl kaum noch am Leben sein“, erwiderte Roland. Er sah seine Verlobte an.
„Meine Liebste: Wann wollen wir heiraten?“, fragte er. Sie lächelte verschmitzt.
„Von mir aus morgen.“
Roland erwiderte ihr Lächeln voller Liebe.
„Dann werde ich morgen einen Boten zu Bischof Guillaume senden, damit er kommt und uns traut“, sagte er.
„Roland … wie … wie soll ich …“, stotterte Balian erschrocken.
„Bezahlen? Nein, Meister, du bezahlst nichts. Ich will auch keine Mitgift!“, entgegnete Roland.
„Wie bitte?“
„Ich will keine Mitgift. Es wird teuer genug für dich, Michels Eintritt ins Kloster zu bezahlen“, erinnerte Roland ihn daran, dass sich die Kirche Aufnahmen ins Kloster in der Regel bezahlen ließ. Einfache Menschen hatten Geld oder wenigstens ihren Einkünften entsprechend Naturalien zu geben, Adlige wurden gerne mal aufgefordert, hohe Geldsummen zu geben oder gleich Grundstücke zu geben – bebaut oder auch nicht.
Balian schüttelte verblüfft den Kopf.
„Du bist wirklich anders als andere Adlige“, entfuhr es ihm. „Ich hoffe, du wirst wenigstens die Schmiede übernehmen, wenn mich der Herr ruft oder der Teufel holt“, setzte er hinzu.
Roland atmete tief durch.
„Balian, ich bin eigentlich nicht nach Frankreich gekommen, um dauerhaft hierzubleiben. Ich sollte für einige Zeit aus dem Heiligen Land verschwinden, bis der königliche Rat vergessen hat, dass ich um die Prinzessin Veronika geworben habe. Das wollte der Rat nicht und hat nach einem Gemahl für sie außerhalb Jerusalems gesucht und auch einen gefunden, der mir bei meiner Abreise noch begegnet ist. Sie wird inzwischen also verheiratet sein. Ich bin es demnächst auch, wobei ich betone, dass deine Tochter keineswegs die zweite Wahl ist, auch wenn ich zuerst um eine andere geworben habe. Deine Tochter, Balian, konnte ich gut kennen lernen. Mit Veronika hätte ich eher die Katze im Sack gekauft, denn ihr wahres Wesen habe ich nie kennen gelernt. Vielleicht wäre es ein großer Fehler gewesen, wenn ich sie geehelicht hätte. Vielleicht wollte Gott mir auf diese Weise zeigen, dass er jemand anderes für mich vorgesehen hatte. Jetzt kann ich nach Jerusalem zurückkehren, ohne in den Verdacht zu geraten, dem Gemahl der Prinzessin ins Gehege einzubrechen. Sie wird hoffentlich einen Thronfolger für meinen kranken König gebären, ihr Gemahl wird der Vater des künftigen Königs sein. Und da ich deine Tochter von Herzen liebe, werde ich ihr gewiss nicht untreu werden, das verspreche ich bei meiner Ehre als Sohn des Hauses Ibelin und als Ritter.“
Balian und Natalie sahen sich verwundert an.
„Ja, und … und … wer … wer soll dann die Schmiede übernehmen?“, stotterte der Altmeister.
„Benoit. Er ist sehr talentiert und begreift schnell. Er wird ein guter Schmied werden. Wenn er sich weiter so gut anstellt, kannst du ihn bald als Gesellen freisprechen, Meister.“
Balian umarmte seinen künftigen Schwiegersohn.
„Dann bleibe solange, bis Benoit Geselle ist“, bat er.
Am folgenden Tag arbeiteten Roland und Benoit wieder in der Schmiede. Gegen Mittag kam Severin mit seinem Dextrarius.
„Heda, Schmied!“ rief er in die Schmiede. „Dieser Dextrarius muss umgehend neu beschlagen werden! An die Arbeit, ihr Faulpelze!“, befahl er herrisch. Roland wischte sich den Schweiß von der Stirn und schob das Mauereisen, an dem er gerade arbeitet, wieder in die Esse, die Benoit mit dem Blasebalg heftig anheizte.
„Stehst du auf den Ohren?“, brüllte Severin.
„Nein, so wenig wie du“, entgegnete Roland kühl. „Ich habe noch einige Mauereisen für den Bischof in Arbeit. Du kannst das Pferd vorne anbinden oder in zwei Stunden nochmal herbringen, wenn es nicht warten mag.“
Severin machte einige harte Schritte auf den jugendlichen Schmiedemeister zu und wollte ihn an der Kapuze seiner Gugel packen, aber seine Hand saß plötzlich in einem wahren Schraubstock fest, Rolands kraftvoller Schmiedhand.
„Was erlaubst du dir, du Nichtsnutz?“, fuhr der Sergeant ihn an.
„Befleißige dich eines anderen Tons Sergeant Severin!“, knurrte Roland. „Benoit und ich arbeiten für den Bruder unseres gemeinsamen Herrn. Das ist mit Baron Henri so abgesprochen. Also hast du mir keine anderslautenden Befehle zu geben! Und jetzt verschwinde! Wir sind beschäftigt!“, wies er den Sergeanten aus der Schmiede. Severin, der vergeblich versuchte, sich zu befreien, konnte nur nicken. Roland gab ihn frei, Severin zog sich zurück.
„Das wird dir noch Leid tun!“, drohte er. „Und dir auch, Benoit, dass du mir nicht geholfen hast!“, keuchte er, als er außerhalb der Überdachung der Schmiede stand. Dann rannte er eilig zur Burg. Roland ging hinaus und band den Dextrarius an der hölzernen Querstange vor der Schmiede fest.
Einige Zeit später, als die Mauereisen fertig waren, sah er sich die Eisen des Dextrarius näher an. Der linke Vorderhuf und der linke Hinterhuf hatten gebrochene Eisen.
„Benoit: Zwei von den großen Hufeisenrohlingen!“, wies er den Lehrling an.
„Willst du sie erst anpassen, Meister?“, fragte der Junge.
„Ja, komm her damit!“
Der braune Dextrarius wurde nervös, als ein Windstoß den Geruch brennender Holzkohle in seine Nüstern trieb. Er stampfte unruhig mit den Hufen auf.
„Ruhig, Brauner, ruhig!“, beruhigte Roland das nervöse Tier. „Dir geschieht nichts.“
Er tätschelte den Rücken des Tieres, dann fiel ihm auf, dass der Braune zwei weiße Hinterfesseln hatte. Er ging um den Dextrarius herum auf dessen rechte Seite – und sah den weißen Fleck, der etwa eine Handbreit vom Sattelgurt entfernt war. Zwar war das Pferd in diesem Moment nicht gesattelt, aber der Sattel war ihm offenbar erst unmittelbar vor der Anlieferung an die Schmiede abgenommen worden, denn die Druckspur war noch erkennbar. Das war das Pferd, mit dem er entführt worden war!
Benoit kam mit den Rohlingen, Roland kehrte auf die linke Seite zurück und hob die zu beschlagenden Hufe nacheinander an, um zu prüfen, ob die Rohlinge groß genug waren. Dann nahm er zunächst das hintere Eisen ab, um es als Vorlage für das neue Eisen zu verwenden. Benoit reinigte inzwischen den Huf und schliff das Horn ab, während Roland schon das erste Eisen schmiedete.
Sie brachten gerade das erste Eisen auf den Huf, als Armand erschien.
„Mein Vater will dich sprechen – sofort!“, knurrte er.
„Ich kann jetzt nicht weg“, widersprach Roland bestimmt. „Dieser Dextrarius bekommt neue Hufeisen, die ich gerade anpasse!“
„Du kommst mit! Auf der Stelle!“
„Und was ist mit den Hufeisen? Die mache ich nicht zum Spaß, sondern im Auftrag deines Vaters!“
„Wenn du dich sofort darum gekümmert hättest, wärst du längst fertig, du Faulpelz!“
„Den Faulpelz nimmst du zurück, Armand! Benoit und ich arbeiten beide für deinen Vater und seinen Bruder. Weder Hufeisen noch Mauereisen wachsen auf Bäumen! Ich habe Severin gesagt, dass wir mit den Mauereisen beschäftigt sind und die Hufeisen warten müssen. Wenn ich ständig meine Arbeit unterbreche, weil neue Sofort-Aufträge gegeben werden, wird gar nichts fertig. Ich komme in die Burg, wenn der Dextrarius neu beschlagen ist und bringe ihn gleich mit“, versetzte Roland.
„Du widersetzt dich dem Befehl deines Herrn?“
„Nein, ich will ihn ausführen! Aber wenn du mich daran hinderst, wird es deinen Vater gewiss interessieren!“
„Drohst du mir etwa?“
„Nein, ich kündige an“, knurrte Roland. „Und jetzt lass mich endlich die Arbeit machen, die dein Vater von mir verlangt!“
„Das wird dir noch Leid tun!“, grollte Armand.
„Jetzt drohst du mir.“
„Nein, auch das ist eine Ankündigung! Verlass dich drauf!“, versetzte Armand, aber er verschwand.
Eine Stunde später brachte Roland den frisch beschlagenen Dextrarius in die Burg.
„Hier ist Herrn Severins Dextrarius“, sagte er zu einem Stallknecht, der ihm den Hengst abnahm und in den Stall brachte. Roland ging in den Rittersaal, wo sein Onkel war.
„Du wolltest mich sprechen, Onkel?“
„Du hast Severin bedroht!“
„Nicht mehr als er mich“, entgegnete Roland. „Hat er dir gesagt, weshalb ich den Dextrarius nicht auf der Stelle beschlagen habe?“
„Er sagte, du hättest dich geweigert, meinen Auftrag auszuführen.“
„Ich war mit einem Auftrag deines Bruders beschäftigt. Ich mache im Moment Mauereisen zu Dutzenden, damit er seine Kirche bauen kann. Das geschieht mit deinem Einverständnis. Dann kann ich nicht mal eben dazwischen Hufeisen machen. Wenn ich meine Arbeit unterbrechen muss, um einen dazwischengeschobenen Auftrag zu erledigen, wird die bestellte Arbeit nicht oder verspätet fertig. Das ist nicht in deinem Sinne und auch nicht in dem deines Bruders. Ganz abgesehen davon, dass Severin nichts davon gesagt hat, dass der Auftrag von dir kommt, du also über eine Unterbrechung der abgesprochenen Arbeit informiert und damit einverstanden bist.“
Henri nickte.
„Das ist natürlich richtig. Aber Armand hat dich in meinem Auftrag holen lassen. Dann hast du zu erscheinen.“
„Ich habe Armand gesagt, dass ich mit dem Dextrarius beschäftigt war. Hufeisen müssen nach dem Schmieden gleich angepasst und aufgenagelt werden, sonst verziehen sie sich – und die ganze Arbeit muss wiederholt werden. Verzogene Rohlinge muss ich einschmelzen, um daraus neue zu machen. Zusätzliche Arbeit, die weder dir noch deinem Bruder dient. Und sag deinen Gefolgsleuten bitte, sie möchten weder Benoit noch mich als Faulpelze titulieren, denn wir beide arbeiten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in deinem Auftrag – und zwar fast ohne Pause. Das Mittagessen hier in der Burg dauert für gewöhnlich zwei Stunden, wir nehmen uns nicht einmal eine halbe Stunde, um etwas zu essen“, versetzte Roland.
„Wie kannst du das so genau wissen?“, fragte Henri.
„Michel hat aus Chartres einige Stundenkerzen mitgebracht, die ich benutze, wenn Benoit und ich Essenspause machen.“
„Dann ist es in Ordnung, was du getan hast. Du kannst gehen, Roland.“
„Ich hätte noch eine Sache und würde dich bitten, mit mir in den Stall zu kommen, damit ich dir etwas zeigen kann.“
„Gut. Ich komme.“
Henri folgte seinem Neffen in den Stall, der ihn zu Severins Dextrarius lotste.
„Sag, mein Onkel, seit wann befindet sich dieses Pferd in deinem Besitz?“, fragte er, als sie den Stand erreicht hatten.
„Was? Dieser Dextrarius stammt aus meiner eigenen Zucht!“, widersprach Henri.
„Bist du ganz sicher?“, hakte Roland nach.
„Ja, bin ich. Es wurde in diesem Stall geboren, bevor ich nach dem Erwerb von Restignac mein Wappen ändern ließ. Sieh dir das Brandzeichen an: Ein Wappenschild, schräglinks mit einem Balken belegt, darüber und darunter je drei Sterne. Das ist mein altes Brandzeichen. Mit Restignac hat die Oberecke einen weiteren Stern für dieses siebente Dorf erhalten. Aber wieso fragst du?“
„Mein Onkel: Dieses Pferd gehörte zu denen, mit denen ich entführt wurde. Die Männer, die mich überfielen, trugen Masken und keinerlei Zeichen an der Kleidung, so dass ich sie nicht erkennen konnte. Einer schlug mich nieder, ich verlor das Bewusstsein und kam später auf der Kruppe eines braunen Dextrarius wieder kurz zu mir, bevor ich erneut einen Schlag auf den Kopf bekam und dann erst wieder in einer Höhle zu mir kam. Ich konnte erkennen, dass das Tier zwei weiße Hinterfesseln hatte – und diesen kleinen weißen Fleck knapp hinter der Lage des Sattelgurtes.“
Severin, der im Stall war, kam zu seinem Pferd gestapft.
„Ach, so was gibt es häufiger!“, widersprach er.
„Solange ich hier schon Pferde beschlage, habe ich nur ein einziges Pferd mit einem solchen Fleck knapp hinter der Sattellage gesehen: Dieses hier, Herr Severin!“, versetzte Roland.
„Was willst du damit sagen, Bastard?“, fuhr Severin Roland an und zog das Schwert. Zu seiner Verblüffung hatte Roland sein Schwert ebenso schnell gezogen. Die Klingen prallten aufeinander.
„Halt! Roland: Was meinst du? Bedenke den Eid des Ritters!“, fuhr Henri dazwischen.
„Onkel Henri, ich schwöre bei Gott, dass ich auf diesem Pferd hier entführt wurde!“, bekräftigte Roland.
„Unfug!“, entfuhr es Severin. „Wie sollte jemand anderes an mein Pferd kommen?“
„Es muss kein anderer, kein Fremder sein“, versetzte Roland. „Ihr, Herr Severin, gehört zu meinen Entführern! Das erklärt auch, weshalb ich in einer Höhle im Wald zwischen Bonville und Restignac eingesperrt wurde – und die Handwerkermarken meines Meisters an der Kette, der Kettenschelle und dem Ring, an dem die Kette angeschlossen war, mit der ich dort gefesselt war!“, hielt er Severin vor. „Ich weiß nicht, wer unter deinen Sergeanten und Rittern ein Interesse daran hat, mich zu beseitigen, aber es müssen deine Leute gewesen sein, mein Onkel. Sonst könnte dieses Pferd nicht mein Träger gewesen sein!“
Henri du Puiset schnappte nach Luft.
„Das scheint mir sehr deutlich zu sein!“, rief er. „Roland, zeige mir die Höhle!“, wies er seinen Neffen an.
„Folge mir!“
Roland ließ sich den Dextrarius satteln, auf einen Wink seines Onkels sattelten drei weitere Männer ihre Pferde und das des Barons und seines Sohnes, dann ritten sie in eiligen Galopp in den Wald zwischen Bonville und Restignac.
Dort angekommen, präsentierte Roland die Höhle und was er noch erwähnt hatte.
„Unfug!“, protestierte Severin. „Euer Neffe hat das vielleicht selbst veranstaltet.“
„Und weshalb sollte er das tun?“, fragte Henri. Severin zuckte mit den Schultern.
„Keine Ahnung!“, erwiderte er.
„Roland, weshalb sollten meine Ritter so etwas tun?“, wandte sich der Baron an Roland.
„Ich weiß es nicht, Onkel Henri. Doch von meiner Absicht, Silbergeschirr nach Chartres zu bringen, wussten nur wenige: Du, Armand und Meister Balian. Dass Meister Balian mir übel will, schließe ich aus. Schließlich will er mir seine Tochter zur Frau geben und mir die Schmiede übergeben, wenn die Zeit gekommen ist. De Valpellier schließe ich ebenfalls aus, denn er kann nicht gewusst haben, dass ich nach Chartres wollte. Dich, mein Onkel, kann ich ebenfalls nicht verdächtigen, denn du weißt, dass ich nicht nach deinem Amt trachte, sondern nach Jerusalem zurückkehren möchte. Und dann ist da noch Armand. Ob er mir etwas neidet, kann ich nicht sagen. Er hat mir gegenüber nie etwas erwähnt. Aber Severin gehört zu seinen ständigen Begleitern“, erklärte Roland.
„Du verdächtigst mich, in diese Entführung verwickelt zu sein? Das ist die Höhe! Ich fordere Genugtuung für diese Ungeheuerlichkeit!“
„Das kannst du haben, Cousin. Denn es ist nicht nur ein Verdacht, den ich gegen dich hege; ich weiß, dass du damit zu tun hast!“
„Wie bitte?“
„Als ich mich aus der Höhle befreit hatte, kamen aus Richtung Bonville maskierte Reiter. Ich konnte mich gerade noch in den Büschen verstecken. Die Reiter hielten zielsicher an dieser Höhle. Einer stieg ab und untersuchte sie, stellte fest, dass ich nicht mehr da war und wollte nach mir suchen lassen. Ein anderer meinte, es sei schon viel zu dunkel und ich könne schon Stunden zuvor ausgebrochen sein. Dieser Sprecher meinte auch, man könne meine Entführung ja de Valpellier in die Schuhe schieben, aber der, der die Höhle durchsucht hatte, meinte, das ginge nicht, weil de Valpellier dann ja Forderungen stellen würde – und der Betrug spätestens dann auffliegen würde, wenn de Valpellier auf Veranlassung seines Vaters vom Vizegrafen vorgeladen würde. Auch wenn du maskiert warst, Armand, das warst du!“
Mit einem Wutschrei wollte Armand auf Roland losgehen, aber sein Vater stellte sich dazwischen.
„Halt! Hier steht Aussage gegen Aussage. Ich setze deshalb ein Duell als gerichtlichen Zweikampf an. Ihr werdet euch morgen Mittag im Burghof duellieren – in voller Rüstung, mit Schwert und Schild!“
„Mylord, Roland hat doch keine Rüstung!“, warf David ein. Armand grinste niederträchtig.
„Ach … Dann wird er wohl mit dem Gambeson* vorlieb nehmen müssen!“, kicherte er.
„Nein. Ich dulde einen gerichtlichen Zweikampf nur mit gleichwertiger Rüstung“, entgegnete Henri. „Du kannst mein Kettenhemd nehmen, Roland. Es müsste dir passen.“
Roland schüttelte den Kopf.
„Ich habe gerade Davids Kettenhemd repariert. Um es richtig herzurichten, habe ich es über meinem Gambeson angezogen, damit Benoit die beschädigten Stellen markieren konnte. Deshalb weiß ich, dass es mir passt. David, habe ich deine Erlaubnis, dein Kettenhemd im Duell zu tragen?“
„Die hast du“, erwiderte David. „Ich leihe dir auch meinen Schild.“
„Danke für das Angebot, aber mein Schild, den ich nach dem Ritterschlag bei Maître Ademar bestellt habe, ist gestern gerade von seinem Sohn Arnaud geliefert worden“, erwiderte Roland. „Übrigens, Onkel Henri: Diese Felshöhle hier wäre ein gutes Fundament für die Burg, die du bauen möchtest. Ich denke, ich kann den Bauplan so anpassen, dass sie als deren Unterbau verwendet werden kann.“
Armand wurde bleich.
„Aber … das … das war doch meine Idee! Stiehlst du mir jetzt schon meine Ideen?“, fuhr er Roland an. Der Gescholtene und Armands Vater sahen ihn irritiert an.
„Das ist ja interessant!“, entfuhr es dem Baron. „Das heißt, du kennst diese Höhle!“, stellte er fest. Armand wurde noch blasser. Er hatte sich verplappert.
„Nun, dann hat Roland wohl die Wahrheit gesagt. Wenn du diese Höhle kennst – und zwar so gut, dass du sie als Burgfundament empfehlen wolltest – wenn hier Metallwaren aus Maître Balians Schmiede sind, die hier als Kerkerinstrumente eingebaut sind, dann kommt das einem Geständnis gleich, mein Sohn. Du bist an Rolands Entführung mindestens beteiligt gewesen und Severin auch, wenn Roland dessen Pferd erkannt hat. Dann erübrigt sich auch der Zweikampf, denn er hätte nur der Frage gedient, ob du beteiligt warst oder nicht“, versetzte Henri. „Zurück nach Saint Martin!“
Kapitel 16
Hochzeit in Saint Martin
Als die Truppe wieder in Saint Martin war, suchte Armand seinen Vater gleich wieder auf.
„Vater, du darfst das nicht glauben, was Roland mir anhängen will!“, forderte er. Henri ließ seinen Sohn nicht zu sich an den Herrensitz.
„Nein, du bleibst da unten stehen!“, befahl er. „Roland hat sehr schlüssig dargelegt, weshalb er dich dieses Verbrechens bezichtigt. Du wusstest von seiner Reise nach Chartres. Severin gehört zu deinen engsten Gefolgsleuten. Was das Pferd betrifft: Er hat Recht, wenn er sagt, dass diese Fellzeichnung sehr selten ist. Ich habe in meinem Leben viele Pferde gesehen, mein Sohn, aber diese Kombination von zwei weißen Fesseln mit einem kleinen weißen Fleck an der rechten Flanke knapp hinter dem Sattelgurt ist so selten wie ein Muselmann auf dem Thron des Papstes! Du bist auch zu der Zeit, als Roland entführt wurde, mit allen deinen Freunden fort gewesen. Du hattest also Gelegenheit, ihn zu überfallen. Du warst auch weg, als Roland sich aus der Höhle befreien konnte. Du und deine Kumpane, ihr seid noch einmal weggeritten, nachdem Balian die Entführung hier gemeldet hatte. Ihr dürftet erst nach der Dämmerung dort angekommen sein. Das passt zu Rolands Angabe, dass einer von euch meinte, es sei schon zu dunkel, um nach ihm zu suchen. Ich habe mich erst gefragt, ob ihr nach ihm suchen wolltet; jetzt bin ich mir einigermaßen sicher, dass ihr ihn umbringen wolltet, weil es unmöglich war, de Valpellier die Entführung in die Schuhe zu schieben. Und du hattest auch einen Grund, den Roland gar nicht kennen konnte: Du bist hinter Natalie her! Du konntest es offenbar nicht ertragen, dass sie Roland heiraten will, denn dir war sicher klar, dass Roland es nicht dulden würde, wenn du seiner Frau zu nahe trittst.“
„Wirst du mich bestrafen, Vater?“
„Das hängt von dir ab, mein Sohn. Wenn du dich ab jetzt vernünftig verhältst, die Felder der Bauern in Ruhe lässt, statt angeblich dort hindurch fliehende Füchse zu jagen, wenn du die Finger endlich von den Mädchen in unseren Dörfern lässt und dir eine standesgemäße Frau suchst. Seit wann wusstest du eigentlich von der Höhle?“
„Als du Restignac erbtest, habe ich mit den Leuten dort gesprochen. Sie haben mir die Höhle gezeigt und mir gesagt, dass es ihr Versteck sei, wenn das Dorf überfallen würde. Ich habe sie mir angesehen und kam auf die Idee, sie als Fundament für die Burg zu nutzen. Wie ist Roland nur an meine Idee gekommen?“
Henri seufzte.
„Roland ist ein kluger Junge. Er musste dir deine Idee nicht stehlen, er ist von selbst darauf gekommen – genau wie du“, sagte er. „Ich kann dir nur raten, ihn ab jetzt in Frieden zu lassen. Bedenke: Er ist Ritter und hat nicht nur das Recht, ein Schwert zu tragen, sondern auch, es zu benutzen. Wenn sich einer von euch mit ihm anlegt, kann das böse ausgehen. Und noch etwas: Nur ausgemachte Feiglinge greifen einen einzelnen Mann in der Horde an. Sollte mir je wieder zu Ohren kommen, dass du mit deinen Freunden derart handelst, werde ich deine Freunde aus meinem Dienst entlassen und ihre Waffen konfiszieren, dir werde ich dann die Ritterwürde entziehen. Hast du verstanden, mein Sohn?“
„Ja, Vater“, presste Armand heraus.
Eine Woche später fand in der noch im Bau befindlichen Kirche von Saint Martin die Trauung von Natalie, Tochter des Schmiedemeisters Balian, mit Roland von Ibelin, Schmiedemeister, statt, die Weihbischof Guillaume persönlich vornahm. Roland hatte aus Gold, das Guillaume ihm gleich nach seiner Ankunft vor der Hochzeit geschenkt hatte, für sich und Natalie Eheringe gemacht, die der Bischof nun weihte und die die jungen Leute sich gegenseitig ansteckten.
Weil Roland nichts davon wissen wollte, dass Balian als Brautvater die Hochzeit bezahlte, richtete er sie selbst aus. Es war Anfang Oktober, das Wetter war noch einmal schön und warm, was der Weinernte zugute kam. Roland hatte sie Hochzeit so geplant, dass die Lese beendet war und die Leute Zeit hatten. Und da das Wetter warm und trocken war, disponierten die Brautleute kurz um – und verlegten die Hochzeitstafel ins Freie: Mitten in das Dorf!
Den ganzen Tag feierten das Dorf und die von Roland und Natalie geladenen Gäste aus den anderen sechs Dörfern des Lehens die Hochzeit des jungen Meisters mit der Tochter des alten Meisters. Darunter waren auch Benoits Eltern aus Restignac, Maître Ademar und sein Sohn Arnaud, der etwas älter war als Roland.
„So eine Hochzeit beim einfachen Volk!“, schwärmte Arnaud. „Das hätte ich mir nie erträumen lassen, zu so einer Hochzeit eingeladen zu werden! Roland, ich hätte eine Bitte an dich.“
„Ja?“
„Ich will meine Dorotheé auch bald heiraten. Mein Vater hat mir versprochen, mich bald als Gesellen freizusprechen. Dann kann ich auch heiraten. Könntest du für uns beide die Ringe machen wie für dich und Natalie?“
„Bis wann brauchst du die Ringe?“
„Nächsten Monat.“
„Dann werde ich sie machen. Komm doch morgen mit Dorotheé in die Schmiede, dann kann ich die Maße eurer Finger abnehmen.“
„Ja, das … das ist schön. Jetzt habe ich nur noch das Problem, wie ich das bezahlen soll … Dorotheés Vater ist ein einfacher Bauer. Unsere Hochzeit wird gewiss nicht so großartig ausfallen wie eure.“
Roland lächelte sanft.
„Arnaud, du hast mir den Schild geschenkt, den ich bei deinem Vater bestellt habe, du hast mir und Natalie eine wunderschöne Intarsientruhe geschenkt. Glaubst du nicht, dass wir euch nicht auch etwas zur Hochzeit schenken würden? Ich habe da schon eine Idee: Wie wäre es mit den Ringen für euch beide?“, bot Roland an.
„Ach, du bist ja verrückt!“, schalt Arnaud. Doch Roland schüttelte den Kopf.
„Nein. Jeder schenkt nach seinen Möglichkeiten. Ich verdiene mit meinen Damaszenerklingen gutes Geld. Du bist ein großartiger Handwerker mit Holz und wirst es noch weit bringen, wenn du deinen Vater beerbst. Ich kann mit Holz nicht viel anfangen, aber ich kann Metall bearbeiten. Dann kann ich euch auch die Ringe schenken.“
„Oh, wieso kannst du nicht deinen Onkel beerben?! Dieser Tunichtgut Armand wird uns auspressen wie die Weintrauben!“, seufzte Arnaud.
„In Frankreich hätte ich kein Erbe zu bekommen. Mein Onkel ist mein Onkel zweiten Grades. Da habe ich keinen Anspruch auf dessen Titel. Außerdem werde ich bald nach Jerusalem zurückkehren. Mein Vater ist der Baron von Ibelin, Herr von Mirabel bei Jaffa.“
„Was? Du … du … bist … das glaube ich nicht!“, entfuhr es Arnaud. „Du bist doch ein ganz normaler Mensch!“
„Ja, mein Vater auch“, grinste Roland. „Arnaud, Adlige sind Menschen; ganz normale Menschen, die ebenso sterblich sind wie Bauern, Händler oder Handwerker.“
Arnaud sah ihn eine Weile an.
„Es gibt leider nicht viele Adlige, die diese Erkenntnis haben“, sagte er.
Am folgenden Tag kam Arnaud mit Dorotheé zu Roland in die Schmiede. Der junge Meister vermaß die linken Ringfinger der Verlobten und notierte sich die Maße in einem Wachstäfelchen.
„Wenn mein Onkel mir nicht noch den Auftrag gibt, heute noch dreißig Schwerter zu machen, habe ich die Ringe morgen fertig“, sagte er.
„Hast du denn Material dafür?“, fragte Dorotheé verblüfft. Statt einer Antwort griff Roland in seine lederne Gürteltasche und holte eine Besant-Münze heraus.
„Hier. Daraus mache ich eure Ringe.“
„Ist … ist das wirk… wirklich Gold?“, hustete Arnaud erschrocken.
„Teilweise. Sie enthalten sieben Teile Gold und einen Teil Silber“, erklärte Roland. Dorotheé konnte nicht anders: Sie umarmte Roland einfach.
„Danke, Roland!“, sagte sie. Auch Arnaud umarmte den jungen Schmied. Die Verlobten verließen die Schmiede. Roland und Benoit fertigten die noch in Arbeit befindlichen Klingen und Mauereisen. Als diese abkühlten, nahm Roland sich zwei Besant-Münzen vor. Er faltete sie zunächst kalt zu Goldklumpen, den er zu einem groben Draht schmiedete und dann durch ein Lochgitter immer dünner zog, dann auf dem Dorn des Ambosses zu Ringen in der beabsichtigten Größe drehte und dann in der heißen Flamme des Schmiedefeuers verlötete. Es gelang ihm, die Enden des Drahtes als schräges Ornament der Vorderseite zu verlöten.
„Die sind wunderschön, Meister!“, bewunderte Benoit die künstlerische Arbeit.
„Es soll ein Geschenk sein, Benoit. Da ziemt sich Schönheit.“
Die Hochzeit von Arnaud und Dorotheé in Cambery am 10. November 1177 fiel in der Tat bedeutend bescheidener aus als die von Roland und Natalie, aber die Brautleute waren nicht weniger glücklich. Die schönen Ringe, die Roland für sie gestaltet hatte, sorgten für Bewunderung.
Kurz vor Mitternacht erschien Arnaud mit seinen üblichen Begleitern Severin, Claude, Dominique, Philippe und Bruno.
„Wie schön sich das einfache Volk amüsiert!“, rief der Sohn des Barons, als die fünf Männer den Festsaal betraten. Auf der Stelle war Schweigen im Raum.
„Ich gratuliere dir, Arnaud; dazu, dass dein Vater dich zum Gesellen freigesprochen hat und zur Hochzeit mit deiner Dorotheé“, fuhr Armand fort. „Wie du weißt, gehören die Untertanen dem Baron – mit Haut und Haaren. Und nur der Baron kann über sie verfügen. Deshalb verlange ich, dass ich die erste Nacht mit deiner Braut verbringe! Dorotheé, du kommst mit mir!“
„Ihr seid der Sohn des Barons, nicht der Baron selbst, Mylord“, widersprach Arnaud. „Und Euer Vater hat mir versprochen, dass er auf dieses Recht verzichtet.“
Armand grinste.
„Deshalb bin ich ja hier. Mein Vater hat mir versprochen, dass er dieses Recht an mich abtritt. Also, mach keine Schwierigkeiten, sonst siehst du dir die Kerkerwände unserer Burg von innen an“, versetzte er. Er wartete noch einen Moment, aber weder Arnaud noch Dorotheé machten Anstalten, ihm zu gehorchen. Armand gab seinen Männern einen Wink, um Arnaud zu verhaften und Dorotheé in die Burg zu bringen, aber Roland stellte sich dazwischen, nachdem er Benoit bedeutet hatte, den Saal zu verlassen.
„Halt! Arnaud steht unter meinem Schutz!“, rief er.
„Bürschchen, wir sind fünf; du bist allein. Noch Fragen?“, bemerkte Severin herablassend. Doch er und auch die anderen waren zu verblüfft, um Benoits Verschwinden auch nur zu bemerken.
„Nein, aber einen Vorwurf! Ihr seid Feiglinge, wenn ihr nur zu fünft wagen wollt, an mir vorbeizukommen. Das ist Rittern nicht würdig!“, fuhr Roland ihn an. „Im Übrigen, lieber Cousin: Dein Vater hat schriftlich auf das Recht der ersten Nacht verzichtet!“
„Was du nicht sagst!“, grinste Armand. „Darf ich das mal sehen?“
„Nein. Ich weiß, dass du nicht lesen kannst. Das ist ja unter deiner Würde als Sohn des Barons“, versetzte Roland bissig. „Aber Père Jonathan, der Arnaud und Dorotheé getraut hat, kann lesen. Hochwürden, wärt Ihr wohl so freundlich?“
„Gewiss, mein Junge. Arnaud, gib mir die Botschaft!“
Der Schreinergeselle stand auf, holte aus einer Truhe die Botschaft des Grundherrn und gab sie dem Priester. Père Jonathan, las das Dokument kurz durch.
„Hört, was unser edler Baron schreibt:
Henri, Baron von Saint-Martin-au-Bois, Bonville, Brechignon, Cambery, Chaumur, Monbartier und Restignac grüßt Arnaud, den Gesellen und Sohn des Meisters Ademar in Cambery. Arnaud, ich beglückwünsche dich zu deinem wunderbaren Gesellenstück, das einen Ehrenplatz auf meinem Tisch hat, den dein Vater gefertigt hat.
Ich beglückwünsche dich auch zu deiner zauberhaften Braut Dorotheé, die zu ehelichen gedenkst. Als dein Herr erlaube ich euch beiden, in den heiligen Stand der Ehe zu treten. Weil du und dein Vater schon so viel für mich als euren Baron getan habt, will ich dir ein besonderes Geschenk machen: Ich verzichte ausdrücklich auf das Herrenrecht der ersten Nacht. Niemand soll dir deine Braut streitig machen und sie vor die berühren, Arnaud.
Gegeben zu Saint-Martin-au-Bois am 9. November im Jahre des Herrn 1177.
Henri du Puiset, Baron
Es folgt das Siegel, das unzweifelhaft das unseres Barons ist“, trug er vor.
Arnaud wurde bleich.
„Ergreift sie!“ befahl er. Seine Männer zogen die Schwerter, doch im selben Moment wurde die Tür des Festsaales aufgestoßen – und Baron Henri trat ein, begleitet von zwanzig seiner Sergeanten. Benoit hatte nicht erst nach Saint-Martin-au-Bois reiten müssen, um ihn zu holen. Henri hatte bemerkt, dass sein Sohn und dessen Freunde fort waren und hatte gleich den Verdacht, dass sie nach Cambery unterwegs waren, um Arnauds und Dorotheés Hochzeit zu stören. So hatte er sich auf den Weg dorthin gemacht, Benoit hatte sie bereits kurz vor der Dorfgrenze von Cambery getroffen.
„Was soll das werden, Armand?“, fuhr er seinen Sohn an.
„Dieses Bauernpack verweigert deinem Sohn das Recht der ersten Nacht mit der Braut!“, warf Armand den Gästen vor, die sich unter Rolands Führung drohend erhoben hatten. „Und dein … Neffe … unterstützt diesen offenen Bruch adligen Gewohnheitsrechtes auch noch! Ich verlange, dass er und alle anderen bestraft werden!“
Henri schüttelte den Kopf.
„Dass du nicht lesen kannst, weiß ich ja. Aber dass du auch keine Ohren am Kopf hast, ist mir neu. Ich habe in deiner Gegenwart Arnaud ausdrücklich zugesagt, auf dieses Recht zu verzichten. Ich habe es ihm auf Rolands Bitte sogar schriftlich gegeben, damit er es nötigenfalls beweisen kann. Wie kommst du dazu, mein Hochzeitsgeschenk so zu verderben?! Ich habe dir nach Rolands Entführung ausdrücklich verboten, das Volk zu drangsalieren und dir befohlen, die Mädchen dieser Baronie in Ruhe zu lassen! Und bei der ersten Gelegenheit widersetzt du dich diesem Befehl! Ich habe dir und deinen Kumpanen Bewährung gewährt, die ihr allesamt gebrochen habt! Diesmal gibt es keine Nachsicht: In den Kerker mit ihnen – alle fünf! Und ihr kommt da erst wieder raus, wenn ihr solchen Taten abschwört!“
Kapitel 17
Reise in den Tod
Nachdem Armand und seine Freunde einstweilen unter Verschluss waren, entspannte sich das Volk in Henris Baronie. Allein der Winter verhinderte, dass sich auch der Pflanzenwuchs auf den Feldern verbesserte.
In Balians Schmiede gingen die Geschäfte gut; mit den Mauereisen konnte Bischof Guillaume den Bau der neuen Kirche fortsetzen, die Ritter und Sergeanten von Baron Henris waren dank der Fertigkeiten von Roland und Benoit gut gerüstet. Privat hatte Roland auch nichts am Leben in Frankreich auszusetzen. Er und Natalie wurden etwa zwei Monate nach ihrer Hochzeit gewahr, dass Natalie schwanger war. Rolands ebenso liebevolle wie zärtliche Bemühungen um Nachwuchs erwiesen sich als erfolgreich.
Doch all das erschien ihm zu schön, um wirklich wahr zu sein. Sein Cousin und dessen Freunde saßen inzwischen seit vier Monaten im Kerker. Keiner von ihnen hatte bislang Anstalten gemach, seinen Taten in Zukunft abzuschwören.
In der Karwoche 1178 ließ Baron Henri Roland zu sich rufen.
„Ihr wolltet mit mir sprechen, mein Onkel?“, meldete sich der junge Mann mit einer höflichen Verbeugung bei seinem Onkel zweiten Grades.
„Ja. Danke, dass du gleich gekommen bist, Roland. Ich kann meinen Sohn und dessen Freunde nun nicht länger gefangen halten, mein Junge“, sagte Henri. „Alle fünf haben am Palmsonntag um Gnade gefleht und die von mir verlangten Erklärungen abgegeben. Ich muss sie also freilassen. Ich weiß aber auch, dass mein Sohn ein rachsüchtiger Mensch ist. Du wolltest doch ohnehin in deine Heimat zurückkehren, oder?“
„Ja, da ist meine Absicht“, bestätigte Roland.
„Wäre es für dich und Natalie nicht sogar besser, wenn euer erstes Kind im Königreich Jerusalem geboren wird?“, fragte sein Onkel.
„Das wäre in der Tat schön. Ich habe auch gut verdient, kann mir die Reise leisten. Benoit ist ein wirklich guter Schmied geworden, der für Euch mehr machen kann als nur Hufeisen“, erwiderte Roland. Seine braunen Augen strahlten geradezu.
Henri erhob sich und trat auf seinen Neffen zweiten Grades zu, umarmte ihn.
„Roland, ich wünschte, du wärst mein Sohn. Ich habe dir und deinen Eltern Unrecht getan, als ich deren Ehe als ungültig verworfen habe und dich nicht als meinen Neffen akzeptiert habe, jedenfalls nicht mit den dir zustehenden Rechten. Sie leben in einem anderen Land, in dem andere Gesetze gelten. Das war falsch von mir, und ich bitte dich um Vergebung“, bat er.
„Sie ist gewährt“, erwiderte Roland mit dem ihm eigenen, schier unwiderstehlichen Lächeln, das einfach ansteckend war.
„Du hast mehr Adel als mein eigener Sohn, der aus in einer in Frankreich tadellosen Ehe erwachsen ist. Er ist ein Tunichtgut“, fuhr Henri fort. „Du wärst eine Zierde der französischen Ritterschaft. Ich bedaure, dass du fortgehst, aber ich weiß, dass es besser für dich und deine geliebte Frau ist, wenn ihr diese Lande verlasst, um in die Neue Welt im Osten zurückzukehren. Doch solltest du eines Tages wieder nach Frankreich kommen, wirst du hier eine offene Tür finden.“
„Ich danke dir, Onkel Henri“, sagte Roland.
Er kehrte in die Schmiede zurück Dort war außer Meister Balian und Benoit auch Natalie, die gerade das Mittagessen herübergebracht hatte. Roland berichtete von der Warnung seines Onkels.
„Dann packt eure Sachen und reist ab!“, beschwor Balian die jungen Leute. „Armand wird Mittel und Wege finden, dich zu vernichten, wenn du hierbleibst, Roland!“
„Natalie?“, wandte Roland sich an seine Frau.
„Vater hat Recht“, erwiderte sie. „Du hast mich in den letzten Monaten auch sehr neugierig gemacht, was die Neue Welt betrifft. Und ich möchte deine Familie gern kennen lernen.“
„Gut, dann werden wir in der Woche nach Ostern aufbrechen“, lächelte Roland.
Der Umstand, zu Ostern aus dem finsteren Kerker entlassen zu werden, ließ bei Armand du Puiset einen noch viel finstereren Plan reifen. Er konnte nicht selbst Hand an seinen Cousin zweiten Grades und dessen Frau legen. Das würde ihn ebenso den Kopf kosten wie seine Freunde. Aber es gab jemanden, der Roland noch länger nach dem Leben trachtete – und um den es gewiss nicht schade wäre, wenn ihn der Teufel holte: Raoul de Valpellier!
Unter dem Vorwand, zum Fest seiner Kerkerentlassung Einladungen versenden zu wollen, erbat Armand einen Schreiber, nach Möglichkeit Michel, den Sohn des Schmieds. Der Schreiber kam; es war tatsächlich Michel, der zu Ostern dem Weihbischof helfen sollte.
„Ihr braucht einen Schreiber, Mylord?“, meldete er sich.
„Ja, vor allem einen, dem ich trauen kann. Du bist doch auch daran interessiert, Roland eins auszuwischen, oder?“
Michel grinste vielsagend. In Armands Auftrag schrieb er einige Einladungen – und einen Brief an Raoul de Valpellier, dass Roland von Ibelin der Konstrukteur der Schleuder sei, die während der Fehde den Turm von de Valpelliers Burg zerstört habe. Er würde demnächst weitere Informationen erhalten, wo er ihn verhaften könne.
Die Freilassung von Armand und dessen Freunden war in der Tat ein großes Fest, zu dem große Teile der zum Lehen gehörenden Dörfer eingeladen waren. Roland, seine Frau, Meister Balian und Geselle Benoit gehörten jedoch ausdrücklich nicht dazu. Sie hatten vielmehr den Befehl bekommen, sich ja nicht bei dem Fest sehen zu lassen, sondern gefälligst ihrer Arbeit für das Lehen nachzugehen. Roland schüttelte über den unhöflichen Ton und den Inhalt des Briefes nur den Kopf.
„Und so einer soll dieses Lehen einmal erben“, seufzte er. „Armes Saint Martin!“
Am Abend des Festtages hatten Roland und Natalie ihre Sachen fertig gepackt, beluden den Wagen, den Roland bei Maître Ademar gekauft hatte. Am folgenden Morgen, es war Ostermontag, der 10. April 1178, verabschiedeten sie sich, spannten das Pferd an, das Henri seinem Neffen zum Abschied geschenkt hatte, und fuhren in Richtung Chartres davon.
Es würde ein weiter Weg sein. Roland plante, auf demselben Weg zurückzukehren, auf dem er gekommen war. Das bedeutete, in Frankreich der Rhône folgend bis ins Königreich Arelat nach Marseille zu fahren und sich dort nach Jaffa oder jedenfalls nach Neapel einzuschiffen.
Vier Tage nach dem Aufbruch erreichte das jugendliche Ehepaar von Ibelin Toury, das etwas fünfzig Meilen südöstlich von Chartres lag. Die jungen Leute übernachteten in einem Gasthof, in dem auch einige Sergeanten des Vizegrafen von Étampes rasteten, der ebenfalls aus dem Haus du Puiset stammte. Der Urgroßvater des regierenden Vizegrafen Guy III. war Guy I. gewesen, der jüngste Bruder von Hugo I. du Puiset und Onkel von Barisan du Puiset.
„Sagt, was ist das für ein Wappen? Das habe ich noch nie gesehen“, bat einer der Sergeanten um Auskunft, als er Rolands Schild sah. Dieser war von dunkelrot und gelb gespalten mit einem schwebenden roten Tatzenkreuz in gewechselten Tinkturen versehen.
„Dies ist mein Wappen als ältester Sohn der Familie des Balian von Ibelin. Mein Vater ist Balian II. von Ibelin, Herr von Mirabel im Königreich Jerusalem“, gab Roland Auskunft.
„Holla! Ein Wappen aus dem Heiligen Land bekommt man hier nicht alle Tage zu sehen!“, stieß der Sergeant hervor. „Seid Ihr zu Besuch hier? Von welcher Familie hier in Frankreich stammt Ihr ab?“, fragte er weiter.
„Ja, wir waren hier zu Besuch bei meinem Onkel zweiten Grades, dem Baron Henri du Puiset in Saint-Martin-au-Bois“, erwiderte Roland.
„Euer Onkel zweiten Grades? Nun, dann sind wir verwandt. Ich bin Barthelemy du Puiset, Bruder von Guy III. du Puiset, dem Vizegrafen von Étampes. Mein Urgroßvater Guy I. war ein Bruder von Hugo I. du Puiset und Onkel von Barisan du Puiset, die ins Heilige Land gingen.“
„Barisan du Puiset war mein Großvater. Ich bin Balian Roland von Ibelin, dies ist mein Weib Natalie“, sagte Roland.
„Willkommen in der Vizegrafschaft Étampes, Cousin und Cousine! Willst du zurück nach Jerusalem, Cousin?“
„Ja.“
„Bei uns in Étampes weilen noch einige Johanniterritter, die ebenfalls ins Heilige Land zurückkehren wollen. Sie haben neue Ritter für den Orden angeworben und wollen morgen aufbrechen. Wollt Ihr Euch ihnen anschließen und hier auf sie warten?“, bot Barthelemy an.
„Meine Gemahlin erwartet unser erstes Kind und kann leider nicht reiten. Unser Wagen ist nicht schnell. Wenn die Ritter vom Johanniterorden es aber nicht zu eilig haben, wäre uns eine Begleitung durch die Johanniter nur recht“, erwiderte Roland.
„Gut, dann sende ich heute noch einen meiner Sergeanten voraus, damit die Johanniter wissen, dass sich hier jemand ihnen anschließen will“, erwiderte Barthelemy. Er ließ es sich nicht nehmen, den entfernten Vetter und dessen Frau zum Abendessen einzuladen und sie auch zu einem Besuch einzuladen, wenn sie wieder einmal nach Frankreich kämen.
Am folgenden Morgen brachen Barthelemy und seine Männer noch vor Sonnenaufgang auf, um nach Étampes zurückzukehren.
„Ich habe gestern Abend gehört, dass Ihr Teil der Familie du Puiset seid“, sagte der Wirt, als er Roland und Natalie im Gastraum das Frühstück gab.
„Ja, stimmt“, bestätigte Roland.
„Stimmt es auch, dass Eure Familie Händel den de Valpelliers hat?“, fragte der Wirt weiter.
„Hatte“, erwiderte Roland. „Der Vizegraf hatte ihm eine Fehde gegen meinen Onkel ausdrücklich verboten. Er hat sich nicht daran gehalten und ist vom Vizegrafen von Chartres dafür auch bestraft worden.“
„Dann gebt Acht, Mylord. Nur wenige Meilen westlich von hier liegt das Dorf Duragnon, das zu de Valpelliers Lehen gehört. Er lässt seine Leute gerne hier plündern. Bis unser Vizegraf davon etwas bemerkt, sind die Lumpen über alle Berge. Es wäre sicher nicht gut für Euch und Eure Gemahlin, wenn Leute von de Valpellier Euch hier finden würden. Ich rate Euch, abzufahren. Wenn Ihr nach dem Süden wollt, führt der Weg auf jeden Fall über Orléans. Die Johanniter werden gewiss schneller sein als Ihr und Euch auf der Straße dorthin bis heute Mittag eingeholt haben. Ich werde ihnen sagen, wie Ihr fahrt“, warnte der Wirt.
„Danke für den Rat, Monsieur Wirt“, erwiderte Roland dankbar. „Was bin ich Euch schuldig?“
„Fünf Deniers für die Übernachtung, drei für die Unterbringung Eures Pferdes und einen Denier für das Frühstück, Mylord.“
Roland gab ihm einen Sou, der zwölf Deniers wert war.
„Da habt Ihr einen Sou. Behaltet den Rest“, sagte er.
„Ich habe zu danken, Mylord. Gehabt Euch wohl.“
Natalie und Roland packten ihre Sachen und machten sich auf den Weg in Richtung Orléans. Gleich hinter ihnen schlüpfte ein Küchenhelfer des Wirts aus dem Haus und rannte in die andere Richtung. Nicht weit von Toury lebte einer der Sergeanten de Valpelliers auf einem Hof. Dort hatten die Häscher de Valpelliers schon die letzten Tage verbracht, nachdem Armand Raoul mitgeteilt hatte, dass sein Cousin auf dem Weg nach Jerusalem war und den Weg über Orléans nehmen würde. Als der Küchenhelfer dort eintraf, war es bereits heller Vormittag. De Valpellier, der selbst dort war, und seine Leute sattelten eilig ihre Pferde und ritten unter Führung ihres Barons in scharfem Tempo zur Straße nach Orléans. Raoul de Valpellier höchstpersönlich führte die Männer an.
Gegen Mittag sahen sie den Wagen der Eheleute von Ibelin.
„Halt! Stehenbleiben! Ihr seid verhaftet, du Puiset!“, brüllte de Valpellier. Roland stand auf dem Bock auf, sah nach hinten und bemerkte das Banner de Valpelliers über den Reitern, die im gestreckten Galopp näherkamen. Obwohl ihm klar war, dass die Reiter allemal schneller waren als der Wagen, trieb er das Pferd zu schnellerer Gangart an.
Tatsächlich wurde der Wagen kurz darauf umstellt, einer der Männer sprang auf das Zugpferd, zügelte es und stoppte so den Wagen.
„Wer seid Ihr und wer gibt Euch das Recht …?“, setzte Roland zum Protest an, aber eine saftige Maulschelle von de Valpellier unterbrach ihn und ließ Natalie erschrocken aufschreien.
„Maul halten! Sieh an, sieh an, wen haben wir denn da? Du Lump warst doch schon mal Gast in meinem Kerker, oder?“, versetzte de Valpellier, der den jungen Mann nun auch ohne Rüstung wiedererkannte.
„Was wollt Ihr von mir und meiner Frau?“, fragte Roland und hielt sich den schmerzenden Mundwinkel.
„Dich hängen, Bürschchen!“, grunzte Raoul. „Du hast doch dieses Teufelsding von Schleuder gebaut, die meinen Burgturm zerstörte!“, hielt er Roland vor. „Ich habe deinen Herrn aufgefordert, dich auszuliefern, damit ich dir dafür den Hals langziehen kann! Und da fährst du mir so einfach über den Weg! Welch glücklicher Zufall! Ergreift ihn!“
Die kurze Unterhaltung hatte Roland genügt, den ersten Schreck zu überwinden und sein Schwert zu ziehen. Er hieb dem ersten Mann, der ihn angriff, glatt den Kopf ab, einem zweiten den Schwertarm. De Valpellier und seine Leute waren nur mit Gambesons geschützt, hatten mit Gegenwehr nicht gerechnet, schon gar nicht mit bewaffneter Gegenwehr. Raoul zog sich zurück, um nicht selbst in die Reichweite von Rolands Schwert zu geraten. Trotz aller Kampfgewandtheit geriet der junge Mann angesichts des vollen Dutzends von Männern, die de Valpellier gegen ihn aufgeboten hatte, rasch in Bedrängnis, aber er gab nicht auf.
Plötzlich war noch mehr Hufgetrappel zu hören, Kettenhemden klirrten, als die von Barthelemy angekündigten Johanniterritter erschienen.
„Was ist hier los?“, fuhr der führende Johanniter de Valpellier an.
„Das geht Euch nichts an!“, schnauzte dieser.
„Wenn ein Dutzend Männer auf einen einzelnen Mann eindrischt, dann geht es jeden Ritter etwas an!“, versetzte der Johanniter scharf.
„Wir verhaften einen Verbrecher!“, behauptete der Baron.
„Was hat er verbrochen?“
„Meinen Burgturm hat er zerstört! Dafür soll er hängen!“
„Glaubt dem Hund kein Wort!“, schrie Roland. „Er will mich morden, weil ich in einer erlaubten Fehde gegen ihn gekämpft habe!“
„Wer bist du?“
„Balian Roland von Ibelin, Sohn des Barons Balian von Ibelin!“
„Und wer seid Ihr?“, wandte sich der Johanniter an den Baron.
„Raoul de Valpellier, Feind seines Onkels, des Barons Henri du Puiset.“
„Helft Balians Sohn!“, befahl der Johanniteranführer. Die Ritter zogen ihre Schwerter und gingen ohne zu zögern auf de Valpelliers Leute los.
Es war ein heftiger Kampf mit Schwertern, aber auch mit Armbrüsten. Raoul, der bemerkte, dass seine Leute ins Hintertreffen gerieten, nahm Reißaus. Roland bemerkte die Flucht de Valpelliers, sprang auf das nächste ledige Pferd und setzte ihm nach, holte ihn ein und schwang sein Meisterstück.
„Das ist für deine Hinterhältigkeit, du Lump!“, grollte er und schlug zu. Die Klinge traf den Fliehenden von hinten in die Halsbeuge und trennte den Kopf vom Rumpf, der im hohen Bogen in die Büsche flog. Der enthauptete Körper fiel aus dem Sattel, das Pferd jagte reiterlos davon.
Roland wendete und kehrte zum Wagen zurück. Die Johanniter hatten de Valpelliers Männer niedergekämpft, aber sie hatten selbst auch Verluste. Drei der zwanzig Männer waren tot, fünf waren verwundet. Beim Näherkommen bemerkte Roland, dass die Johanniter im Inneren des Wagens hektisch arbeiteten. Er trieb das erbeutete Pferd zur Eile an und sah. Dass die Ordensritter sich über eine im Wagen liegende Gestalt beugten. Er ließ das Schwert fallen, sprang vom Pferd direkt in den Wagen.
„Natalie!“, rief er. Erschrocken wichen zwei der Johanniter zur Seite – und Roland sah seine Frau. Sie war tot. Ein Armbrustbolzen hatte sie in den Hals, ein zweiter ins Herz getroffen.
„Natalie! Nein! Nein! Nein!“, schrie er verzweifelt und warf sich über sie.
„Ihr könnt nichts mehr tun, Mylord“, sagte einer der Johanniter. „Sie ist tot.“
Mitfühlend legte er dem jungen Witwer eine Hand auf die Schulter. Balian Roland brach über seiner toten Frau bewusstlos zusammen.
Kapitel 18
Rückreise
Als Roland wieder zu sich kam, fand er sich in einem ihm unbekannten Schlafraum wieder.
„Wo … wo bin ich?“, fragte er. Am Fenster des Raumes, wo ein großer Ohrensessel stand, der dem Bett den Rücken zukehrte, bewegte sich etwas. Eine Frau stand auf und kam zu ihm.
„Willkommen im Leben, Mylord Balian. Ihr seid in der Burg von Vizegraf Guy III. von Étampes. Der Tod Eurer Gemahlin hat Euch schwer getroffen- Ihr habt mehr als einen Tag geschlafen“, sagte sie. Ihr Äußeres – ein cremefarbener Surcot* über einer blauen Tunika die mit blau-goldener Borte gesäumt war, die Ringe an den Händen und das weiße Gebende*, das den Kopf umgab und mit edelsteinverzierten Gebendenadeln gehalten wurde – verriet, dass sie eine Adlige war.
„Wer seid Ihr?“, fragte Roland.
„Louise, die Gemahlin von Vizegraf Guy III.“, erwiderte sie. „Mein Gemahl würde gern mit Euch sprechen. Fühlt Ihr Euch gut genug?“
Roland nickte schweigend. Die Frau entfernte sich und kehrte mit dem Vizegrafen zurück, der nicht weniger kostbar gekleidet war.
„Willkommen in Étampes, Cousin! Ich bin Guy du Puiset, der dritte Vizegraf von Étampes dieses Namens“, begrüßte er den Gast.
„Danke … Cousin. Ich bin Balian Roland von Ibelin aus dem Hause du Puiset. Ich danke für Eure Hilfe“, erwiderte Roland. „Was … was ist mit meiner Frau?“
Louise setzte sich an das Bett und nahm tröstend seine rechte Hand.
„Sie hat diesen hinterhältigen Überfall nicht überlebt, Cousin“, sagte sie. Roland, der sich halb aufgerichtet hatte, ließ sich wieder in die Kissen fallen.
„Dann war das nicht nur ein böser Traum?“, ächzte er.
„Nein. Bedauerlicherweise nicht“, ergänzte Guy.
„Ist sie schon bestattet?“, fragte Roland.
„Bislang noch nicht. Wir wollten warten, bis Ihr wieder bei Kräften seid.“
„Dann würde ich sie gern in Saint-Martin-au-Bois an der Seite ihrer seligen Mutter bestatten“, sagte Roland. „Ich hoffe, die Johanniter haben ein paar Tage Zeit, denn ich würde gern mit ihnen nach Jerusalem weiterreisen.“
„Sprecht mit Bruder Jean, der Euch mit seinen Rittern zu Hilfe kam und Euch herbrachte“, empfahl Guy.
Wenig später traf Roland Jean de Grandvilliers in der Halle der Vizegrafenburg.
„Ich danke Euch für Eure Hilfe, Bruder Jean. Ohne Euch wäre ich tot“, dankte der junge Mann
„Euch zu helfen war ritterliche Pflicht, Mylord Balian Roland“, erwiderte der Johanniterritter. „Ich bedauere nur, dass wir nicht rechtzeitig kamen, um auch Eure Frau zu retten. Seid meines Beileids gewiss. Ich werde sie in meine Gebete einschließen.“
„Ich danke Euch. Was sind Eure weiteren Pläne?“
„Wir sind auf dem Weg nach Jerusalem“, antwortete Jean. „Wenn Ihr möchtet, kommt mit uns.“
„Das Angebot nehme ich gerne an, doch würde ich gerne noch meine Frau in Saint-Martin-au-Bois bestatten. Lässt Eure Reiseplanung zu, dass Ihr mich begleitet?“
„Reist Ihr weiter mit dem Wagen oder reitet Ihr?“, erkundigte sich Jean.
„Auf dem Wagen ist mein und Natalies Hausstand. Den würde ich ihrem Vater gern zurückgeben, denn ohne Gemahlin brauche ich ihn nicht. Was ich benötige, kann ich auf dem Pferd mitnehmen“, sagte Roland.
„Dann haben wir genügend Zeit, um Euch zu begleiten.“
Zwei Tage darauf kehrte der Wagen mit der toten Natalie begleitet von ihrem Witwer und den Johanniterrittern nach Saint-Martin-au-Bois zurück. Das Entsetzen im Dorf war groß, als die Leute erfuhren, dass Natalie von den Gefolgsleuten de Valpelliers getötet worden war.
„Dieser ruchlose Hund!“, fauchte Henri du Puiset. „Diesmal bringe ich ihn um!“
„Das brauchst du nicht mehr, Onkel Henri. Ich habe ihn im Kampf getötet und Natalie gleich gerächt“, erklärte Roland. „Du solltest dieser Sorge ledig sein.“
Henri sah seinen Neffen ebenso betroffen wie stolz an.
„Du hast diesen Landen einen großen Dienst erwiesen, als du diesen falschen Hundsfott zu seinen Ahnen versammelt hast“, sagte er. „Wie kann ich dir das vergelten?“
„Ich habe nur den Wunsch, dass Natalie an der Seite ihrer Mutter begraben wird und das Grab als Familiengrab auch für ihren Vater da ist, wenn er von Gott heimgerufen wird.“
„Das ist ein bescheidener Wunsch, mein Junge. Brauchst du sonst wirklich nichts?“
„Vielleicht noch ein Pferd. Aber das würde ich Aristide gerne abkaufen, wenn er es denn verkaufen will“, erwiderte Roland.
„Gut, rede mit ihm. Sag mir, was er für Rollo haben will, und ich kaufe ihn und schenke ihn dir“, sagte Henri.
Aristide zögerte nicht lange, als Roland ihn auf den normannischen Hengst ansprach.
„Rollo ist ein großartiges Pferd“, sagte er, „würdig, einen Ritter zu tragen. Ich bin keiner und habe dieses wundervolle Tier immer nur ungern vor meinen Pflug gespannt. Drei Livre und er gehört dir, Roland.“
Wie versprochen, bezahlte Baron Henri die drei Livre und schenkte Roland den Schwarzen Normannen als Reitpferd. Das Pferd, das den Wagen gezogen hatte, nahm Roland als Handpferd für das Gepäck mit.
Am Tag darauf war der Sarg für Natalie fertig, Weihbischof Guillaume bestattete sie gemäß Rolands Wunsch neben ihrer Mutter. Roland stützte seinen trauernden Meister, der nun auch noch seine Tochter verloren hatte und nicht wusste, wohin mit dieser abgrundtiefen Trauer.
Im Morgengrauen des folgenden Tages brachen Roland von Ibelin und die Johanniter auf, um ins Königreich Jerusalem zurückzukehren.
Knapp drei Wochen später rasteten sie bei Markgraf Guglielmo von Montferrat und seiner Gemahlin Judith, die aus dem Hause Babenberg stammte, in Casale Monferrato. Auch in diesem Haus herrschte Trauer. Der älteste Sohn der Familie war im Königreich Jerusalem verstorben.
„Wie habt Ihr davon erfahren, wenn Euer Sohn in Jerusalem starb?“, erkundigte sich Roland. Guglielmo seufzte.
„Mein Sohn war nach Jerusalem gereist, um dort die Schwester des Königs zu heiraten. Sie war hochschwanger von ihm, als er plötzlich an Malaria starb. Er durfte seinen Sohn noch nicht einmal kennen lernen und sein Sohn seinen Vater nicht. Ihr Bruder, König Balduin, hat uns darüber Nachricht gegeben“, erklärte der Markgraf.
„Wel… welche Schwester des Königs meint Ihr?“, fragte Roland mit belegter Stimme.
„Welche? Balduin hat doch nur eine – Sibylla. Sie war die Gemahlin meines Sohnes und ist nun seine Witwe.“
Roland sah ihn verstört an. Wusste der Markgraf wirklich nicht, dass Balduin zwei Schwestern hatte, nämlich Sibylla und Veronika? Doch die Miene des Markgrafen verriet ihm, dass der Mann tatsächlich nichts von einer zweiten Schwester wusste.
„Verzeiht“, sagte er, „ich habe da wohl etwas verwechselt. Es tut mir Leid.“
„Ah, schon gut, junger Freund. Bei den Verhältnissen in Jerusalem kann man schon mal etwas verwechseln. Aber es ist für uns natürlich schrecklich, dass unser Sohn so früh sterben musste.“
„Vergebt meine Neugier: Wie alt war Euer Sohn, als der Herr ihn heimrief?“, fragte Roland.
„Siebenunddreißig Jahre war er. Er wurde viel zu früh zum Herrn berufen“, erwiderte Judith von Montferrat.
„In der Tat, das ist sehr früh – vor allem, wenn er nicht im Kampf gefallen ist, sondern von Krankheit dahingerafft wurde. Seid meines Beileids versichert, meine edlen Gastgeber.“
„Euer Verständnis ist groß. Sagt, junger Freund, wie alt seid Ihr selbst?“
„Achtzehn“, erwiderte Roland. Guglielmo und Judith sahen ihn nun ihrerseits verblüfft an.
„Dann habt Ihr Euer Leben noch vor Euch, Balian Roland. Möge Gott Euch beschützen.“
Roland verbeugte sich vor dem Markgrafenpaar.
„Ich danke Euch für Eure Gastfreundschaft und Eure lieben Wünsche und werde meinen Vater über Eure Güte unterrichten.“
„Wer ist Euer Vater?“
„Balian II. von Ibelin, Mylord.“
„Richtet Eurem Vater bitte unsere Grüße aus. Es wäre uns eine Ehre, ihn kennen zu lernen.“
„Das werde ich“, versprach Roland.
„Ich habe noch einen Gast, der ebenfalls nach Jerusalem strebt – und wenn ich ihn recht verstanden habe, möchte er zu Eurem Vater. Vielleicht könnt Ihr ihn begleiten“, bemerkte Guglielmo.
„Gerne. Wollt Ihr ihn mir vorstellen?“, bat Roland.
Wenig später kam ein junger Ritter in den Saal, dessen Wappenrock von Grün und Rot gespalten war. In beiden Feldern des Wappenrocks war jeweils eine goldene Lilie auf der Brust eingestickt. Er hatte hellbraunes Haar und blaue Augen, trug einen dunkelblonden Vollbart, war etwa ebenso groß wie Roland und offenbar etwa im gleichen Alter wie der junge Mann aus dem Königreich Jerusalem.
„Mylord Roland von Ibelin: Prinz Rudolf von Wengland, Sohn des Königs Maximilian von Wengland und dessen Thronfolger“, stellte der Markgraf Roland den weiteren Gast vor. Roland verbeugte sich vor dem offensichtlich Höhergestellten, der Kronprinz eines eigenen Reiches war.
„Mylord“, sagte er.
„Roland, mein Freund, Rudolf versteht Eure schöne Sprache leider nicht. Aber ich glaube, Bruder Jean beherrscht Eurer beider Sprachen. Vielleicht kann er dolmetschen“, gab Guglielmo einen Hinweis.
Bruder Jean beherrschte tatsächlich sowohl die französische als auch die deutsche Sprache und als Kleriker natürlich Latein. Roland sprach französisch und arabisch, während Rudolf deutsch und etwas Latein sprechen konnte. Jean übernahm deshalb die Rolle des Dolmetschers zwischen dem Überseefranzosen und dem deutschen Prinzen.
„Seid Ihr auf Pilgerreise. Prinz Rudolf?“, fragte Roland.
„Ja, das auch. Doch ich will auch um ein Weib werben. Mein Vater, König Maximilian von Wengland, meint, es sei höchste Zeit, dass ich heirate und dem Reich einen Erben gebe, bevor ich ihn als König beerbe.“
„Und da wollt Ihr unter den Töchtern des Heiligen Landes nach einem passenden Weib suchen?“, wunderte sich Roland. Rudolf lächelte sanft.
„Mein Erzieher, der Kaiser Friedrich, war im Jahr unseres Herrn 1157 im Heiligen Land. Er lernte dort den Baron von Ibelin kennen. Im Jahr darauf brachte die Frau des jüngsten der Söhne dieses Barons ein Mädchen zur Welt. Kaiser Friedrich sagte mir, dass Vater und Mutter des Mädchens ebenso schöne wie freundliche Menschen seien. Sie ist etwa ein Jahr jünger als ich. Ich hoffe, dass sie sich so entwickelt hat, wie ich es mir wünsche. Wenn das so ist, will ich um sie werben. Und wenn sie mich erhört, soll sie meine Gemahlin werden und den mir als Erbe zustehenden Thron mit mir teilen“, erklärte der Wengländer nach Jeans Übersetzung. Jean und Roland sahen sich verblüfft an. Die Welt schien gelegentlich doch ein Dorf zu sein …
„Familie Ibelin? Jüngster der Söhne?“, hakte Roland nach. Rudolf nickte nach der Übersetzung.
„Mein Prinz, jener Balian von Ibelin ist mein Vater, und das Weib, das Ihr zu freien gedenkt, ist meine Schwester!“, entfuhr es dem jungen Mann aus dem Königreich Jerusalem. „Es wäre mir eine Ehre, wenn Ihr Euch uns anschließen würdet und mich zu meinem Vater begleiten wolltet“, lud er den wenglischen Thronfolger ein.
„Oh, welch glücklicher Zufall!“, frohlockte Rudolf. „Sagt, ist sie noch frei?“, erkundigte er sich.
„Als ich vor zwei Jahren nach Europa ging, war sie es noch. Und ich kann Euch bestätigen, dass sie ein hübsches Mädchen ist.“
Der Prinz maß ich nach Jeans Übersetzung genau von oben bis unten, soweit das im Sitzen möglich war.
„Sieht sie Euch ähnlich?“, fragte er. Jean übersetzte.
„Ja.“
Rudolf nickte anerkennend, nachdem er die Übersetzung hatte.
„Wenn sie auch so offen und freundlich ist wie Ihr, dann soll sie meine Königin sein, wenn sie es will“, sagte er.
Jean hob die Hand.
„Wenn Ihr beide demnächst vielleicht verschwägert seid, rege ich an, dass Ihr jeweils die Sprache des anderen erlernt“, schlug er vor. Roland nickte begeistert, Rudolf eher zurückhaltend.
„In Wengland ist es üblich, dass im Königshaus die landeseigene Sprache gesprochen wird“, sagte er. „Mein Vater wird erwarten, dass mein Weib auch meine Sprache spricht.“
„Missversteht mich nicht, Hoheit. Ich will Euch nicht dazu nötigen, künftig nur noch französisch zu sprechen. Mein Vorschlag ist, dass Ihr auch die Sprache Eure künftigen Schwiegerfamilie erlernt. Im Königreich Jerusalem wird es als sehr höflich angesehen, wenn Gäste sich dort in der Landessprache verständigen können. Ihr haltet es gewiss auch so, dass Ihr wünscht, dass Gäste Eure Sprache beherrschen, oder nicht?“, erwiderte Jean.
„Nun gut, das verstehe ich. Ich bin nicht sehr sprachbegabt, doch ich will es versuchen“, erwiderte der Prinz aus Wengland. Jean lächelte verbindlich.
„Das ist nicht selbstverständlich und ehrt Euch, Hoheit“, sagte er.
Einige Tage darauf setzten Roland und, die Johanniter unter Führung von Jean de Grandvilliers die Reise fort. Rudolf schloss sich ihnen mit seinen zehn Begleitern an. Ihr Weg führte über Genua und La Spezia bis nach Lucca fast an der Küste entlang. Dann begann der Aufstieg in die Apenninen, darin über Siena zum Lago di Bolsena, den Bolsena-See nach Civita Castellana, wo sie auf den von Florenz kommenden Pilgerweg trafen, nach Rom. In Civita Castellana strömten die Pilger ins Heilige Land – ob friedlich oder auf dem Kreuzzug – zusammen. Es war eine endlose Karawane, die auf diesem Weg nach Süden zog.
Die Reisenden waren unterschiedlich schnell. Reiter kamen eigentlich etwas schneller voran als Wanderer, doch waren die Pfade im Gebirge teilweise so schmal, dass nicht einmal Fußgänger andere langsame Wanderer überholen konnten. Bis nach Rom dauerte die Reise durch Italien gute zwei Wochen. Das Pfingstfest verbrachten die Pilger in Rom.
Jean de Grandvilliers nutzte die Zeit, um Roland die deutsche und Rudolf die französische Sprache beizubringen. Beide Sprachen waren kompliziert. Während Roland sich als interessierter und gelehriger Schüler erwies, der schnell lernte, zeigte Rudolf zwar Interesse, aber nur geringe Fortschritte, so große Mühe er sich auch gab.
Jenseits von Rom teilte sich der Strom der Pilger wieder. Ein guter Teil blieb länger in Rom, mochte es auch nicht mehr viel mit der einstigen Hauptstadt eines Weltreiches gemein haben. Die antiken Stätten dienten in vielen Fällen als Steinbrüche für die Häuser der jetzigen Bewohner – einschließlich des Papstes.
Ein anderer Teil zog von Rom nach Salerno weiter, um von dort per Schiff nach Messina zu gelangen, was eine Wanderung von weiteren sieben Tagen und eine Überfahrt von einem weiteren Tag bis nach Messina bedeutete.
Wieder andere wanderten nach Brindisi, um von dort ein Schiff nach Akkon oder Jaffa zu nehmen. Beide Häfen, Messina und Brindisi, gehörten zum normannischen Königreich Neapel und Sizilien, das mit dem Handel mit der Levante gutes Geld verdiente, dessen Schiffe aber auch zahlende Pilger ins Königreich Jerusalem brachten.
Um eine doppelte Seereise zu sparen, zogen die Johanniter mit Roland und die Wengländer mit Prinz Rudolf nach Brindisi weiter. Da dieser Weg weniger stark frequentiert war, konnten sie die Geschwindigkeit ihrer Pferde besser nutzen und erreichten die Hafenstadt an der Adria drei Tage nach dem Aufbruch von Rom.
Zwei weitere Tage später waren sie auf dem Seeweg nach Jaffa. Weil das Schiff, das sie mitnahm, noch einige Häfen anlief, um Ware zu handeln, erreichte die Reisegemeinschaft den Haupthafen des Königreichs Jerusalem zu Sommerbeginn am 21. Juni 1178.
Die lange gemeinsame Reise hatte Roland und Rudolf zu guten Bekannten werden lassen, die einander auch sprachlich verstanden, was hauptsächlich an Rolands Sprachtalent lag. Die Johanniter wollten von Jaffa aus nach Jerusalem weiterreisen, Roland aber zunächst nach Ramleh, wo sein Onkel Balduin lebte. Die Wege der Gemeinschaft trennten sich also in Jaffa.
„Bruder Jean, ich danke Euch für alles, was Ihr für mich getan habt. Gott sei mit Euch“, verabschiedete sich Roland von seinem Lehrer.
„Gott schütze Euch, Roland. Auch mit Euch und Euren Gefährten sei Gott, Prinz Rudolf. Mögen sich unsere Weg wieder kreuzen“, erwiderte Jean den Gruß. Die Johanniter ritten auf dem Pilgerweg nach Jerusalem weiter, Roland und seine wenglischen Bekannten nahmen die Abzweigung nach Ramleh, wo Rolands Onkel Balduin lebte.
Kapitel 19
Blitzschlag
Am frühen Abend erreichten sie Ramleh. Balduin empfing sie herzlich.
„Balian Roland! Welche Freude, dass du wieder daheim bist!“, rief er aus, als er die Ankömmlinge von seiner Dachterrasse aus sah. Er lief hinunter in den Hof und umarmte seinen Neffen, der gerade vom Pferd gestiegen war.
„Danke, Onkel Balduin. Ich bin froh, wieder hier zu sein“, erwiderte der junge Mann und präsentierte mir der ganzen rechten Hand zu seinen Begleitern.
„Onkel Balduin, dies ist Prinz Rudolf von Wengland. Er möchte um Marie werben. Er wird begleitet von seinem Freund Graf Theodor von Eichgau und Männern der Königlichen Garde, die Herr Eberhard von Klotzenport anführt“, stellte er sie vor. Balduin verneigte sich vor dem königlichen Prinzen.
„Prinz Rudolf, seid mir mit Euren Begleitern willkommen. Mein Haus ist das Eure!“, begrüßte er die Wengländer.
„Ich danke für den freundlichen Empfang, Herr Balduin“, erwiderte Rudolf mit deutlichem Akzent.
Balduin von Ibelin ließ auffahren, was Küche und Keller hergaben, um die Rückkehr seines Neffen und die Ankunft der Wengländer zu feiern.
„Wenn ich es recht verstehe, mein Prinz, seid Ihr nicht hergekommen, um zu helfen, dass Jerusalem christlich bleibt“, bemerkte der Gastgeber beim Essen.
„Nein, in der Tat nicht. Mein Vater, der König von Wengland, ist schon älter und kränklich. Er erwartet, dass ich heirate und dem Reich einen Erben gebe, bevor er zum Herrn gerufen wird. Ich wollte auch reisen. Mein Erzieher, Kaiser Friedrich, war auf dem Kreuzzug hier und hat mir von der Schönheit Jerusalems erzählt. Das wollte ich gern selbst sehen. Und er sagte mir, hier seien ebenso schöne wie kluge Frauen zu finden. Eine solche soll meine künftige Königin sein“, erklärte Rudolf. „Wärt Ihr so freundlich, mir Eure Tochter vorzustellen?“, bat er.
„Rudolf, mein Freund, Ihr unterliegt einem Missverständnis“, schaltete sich Roland ein. „Meine Schwester lebt bei meinem Vater in Nablus, nördlich von Jerusalem. Ich konnte aber nicht heimkehren, ohne meinen Onkel zu besuchen, der fast auf dem Weg wohnt. Das wäre sehr unhöflich gewesen.“
„Ihr wisst, was sich gehört, Roland“, lobte Rudolf. „Doch erkennt, dass ich bald heimkehren muss, weil ich damit rechnen muss, dass mein Vater nicht mehr lange lebt“, erklärte er. Balduins Miene verfinsterte sich.
„Wir brauchen Kämpfer!“, knurrte er. „Dieses Land ist in großer Gefahr!“
„Was meinst du, Onkel?“, fragte Roland.
„Sultan Saladin gelingt, was seinen Vorgängern nicht gelang: Er eint die Sarazenen unter seiner Herrschaft. Er ist nicht nur Sultan von Ägypten, sondern auch von Syrien und inzwischen sogar von Arabien. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er uns angreift!“, warnte Balduin.
„Herr Balduin, ich erkenne Eure Schwierigkeit. Doch ich habe ganze zehn Männer. Damit kann ich reisen, aber keinen Krieg führen. Doch ich denke, dass ich in Wengland gewiss Kämpfer finden kann, die Euch helfen werden – zumal ich hoffe, mich bald zu Eurer Verwandtschaft zählen zu dürfen“, erklärte Rudolf.
„Das wäre gut, Hoheit“, erwiderte Balduin. „Ich will meinem Bruder nicht vorgreifen, aber ich könnte mir denken, dass er dies zur Bedingung macht, wenn Ihr seine Tochter heiraten wollt. Ihr solltet auch wissen, dass wir Ibelins nichts von Zwangsheiraten halten. Meine Nichte wird sich schon freiwillig für Euch entscheiden müssen, wenn Ihr sie zum Weib begehrt.“
Rudolf lächelte. Seine blauen Augen blitzten, als er sagte:
„Dann sind wir uns in dem Punkt einig, Herr Balduin. Auch wir, die Familie Wengland-Steinburg, halten nichts von arrangierten oder gar Vertragsehen, die ohne Willen der Kinder von den Eltern vereinbart werden. Deshalb habe ich auch keinen Werber geschickte, sondern bin selbst gekommen, um hier um Eure Nicht zu werben.“
Am folgenden Tag, es war der 22. Juni 1178, verließen Roland und die Wengländer Ramleh und ritten nach Jerusalem weiter. Im dortigen Stadthaus der Familie Ibelin rasteten sie. Haushofmeister Yussuf schickte alles, was Beine hatte, auf die Märkte, um für die unerwarteten Gäste einzukaufen, damit er ein dem königlichen Gast angemessenes Mahl herrichten lassen konnte.
„Mylord Balian … dieser … Prinz … Ist er gekommen, um um die Hand der Prinzessin Sibylla anzuhalten?“, fragte er, als er Balian Roland zufällig allein erwischte, weil die Wengländer ob der für sie ungewohnten Hitze Jerusalems noch den Mittagsschlaf verlängerten.
„Nein, er will um meine Schwester Marie werben. Äh, was sagst du? Um Sibylla werben? Ist sie denn noch nicht verheiratet? Ich sollte ja weder Veronika noch sie ehelichen dürfen. Da habe ich angenommen, sie wäre auch schon längst unter der Haube“, bemerkte Roland.
„Ach, Sidi, hier ist es drunter und rüber gegangen, seid Ihr fortmusstet“, seufzte Yussuf. „Kurz nach Eurem Aufbruch erschien hier ein Etienne de Sancerre und warb um Veronika. Nicht nur, dass sie sich beharrlich weigerte, nein, er bemerkte auch was für ein Sheitan* die Mutter dazu ist. Er reiste schneller ab, als er gekommen war. Veronika erklärte, dass sie lieber Euren Gott heiraten würde als einen Menschen, wenn sie nicht mit Euch vermählt würde. Ihre Mutter hat sie in ein Haus gebracht, dass Eure Glaubensbrüder wohl Kloster nennen. Angeblich soll sie kurz danach gestorben sein. Dem nächsten Bewerber, einem Wilhelm von Montferrat, wurde dann Sibylla als Braut vorgestellt. Er hat sie geheiratet, aber sie waren nur ein knappes Jahr vermählt, dann starb er an Malaria. Doch die Gerüchte wollen nicht verstummen, dass er vergiftet wurde. Die Prinzessin war mit ihrem Sohn schwanger, als ihr Gemahl starb. Jetzt ist der kleine Prinz knapp ein Jahr alt“, erklärte er.
Roland überlegte eine Weile. Veronika und Sibylla waren Zwillinge. Er hatte sich mit beiden mehr als nur gut verstanden. Wenn Veronika nicht mehr war, benötigte Sibylla aber immer noch einen Ehemann – zumal, wenn sie einen Sohn hatte … Er wollte die Chance nutzen, die sich ihm da gerade bot.
„Dann werde ich schnell wieder herkommen, wenn ich meinen Vater besucht habe und Rudolf um meine Schwester geworben hat“, sagte er schließlich.
„Junger Sidi: Ihr seid kein Prinz. Die Königinmutter hat Euch schon mal abgelehnt“, erinnerte der Haushofmeister. „Und wenn jetzt ein königlicher Prinz dieses Königreich beehrt …“
„Rudolf wird nicht hierbleiben, Yussuf“, unterbrach Roland den Diener. „Er wird seinen Vater in Europa beerben und sein eigenes Königreich regieren. Wenn Sibyllas Sohn den Thron Jerusalems erben soll, muss sie hierbleiben und ihren Sohn zum Thronfolger erziehen.“
„Dennoch, Sidi: Ihr dürft es diesem hohen Gast nicht verschweigen“, mahnte Yussuf.
„Ich weiß, was du meinst, Yussuf. Danke.“
Am Nachmittag, als die Wengländer den Mittagsschlaf beendet hatten und im einigermaßen kühlen Schatten des Stadthaushofes saßen, wandte sich Roland an Rudolf:
„Mein Feund, versteht bitte nicht falsch, was ich Euch jetzt sage: Ich habe erfahren, dass unsere Prinzessin Sibylla noch vor der Geburt unseres künftigen Königs verwitwet ist. Ihr seid ein königlicher Prinz. Wäre sie nicht eine bessere Gemahlin für Euch als meine Schwester, die die Tochter eines Barons ist?“
Rudolf sah ihn verwirrt an.
„Wollt Ihr nicht, dass ich Eure Schwester eheliche?“, fragte er betroffen.
„Wie gesagt: Versteht es nicht falsch. Es wäre mir eine Ehre, einen künftigen König meinen Schwager nennen zu dürfen. Und wenn es nicht unter Eurer Würde als Thronfolger Eures Landes ist, eine Frau aus dem geringen Adel zu Eurer Prinzessin und Königin zu machen, wäre es mir eine Freude. Doch ich darf Euch nicht verschweigen, dass es eine Euch Ebenbürtige gibt, die ohne Gemahl ist“, erwiderte Roland. Rudolf grinste.
„Die Prinzessin – ist sie die Erbin des Jerusalemer Throns? Ich hörte, es gibt hier einen König“, sagte er.
„Es gibt einen König, ja. Doch er wird keine eigenen Kinder haben. Unser junger König Balduin IV. leidet an Lepra. Deshalb wurde beschlossen, dass eine seiner Schwestern die Mutter es künftigen Königs werden soll. Ich habe um sie geworben, doch wurde ich als zu gering erachtet, um der Vater des neuen Königs zu werden. Man wollte mich sogar aus Jerusalem verbannen, damit ich dem noch zu suchenden Gemahl der Schwestern nicht in die Quere komme. Ich bin dann selbst nach Frankreich gegangen, um einer möglichen Verfolgung zu entgehen. Einen Bewerber traf ich noch in Akkon. Der hat sie aber nicht geheiratet, sondern der Sohn unserer Gastgeber in Casale Monferrato. Er ist der Vater ihres Sohnes, der unseren König beerben wird. Der Gemahl der Prinzessin starb kurz nach der Hochzeit – an Malaria, wie es heißt. Nun ist sie Witwe“, erklärte Roland. Rudolfs Grinsen verbreiterte sich noch.
„Wenn Ihr um sie geworben habt, abgelehnt wurdet und sogar mit Verbannung bedroht wurdet: Liebt Ihr die Prinzessin und erwiderte sie Eure Liebe?“, hakte er nach.
„Balduin hat Zwillingsschwestern, mein Prinz. Ich liebte Veronika, die eigentlich als Mutter es Königs bestimmt war. Sie weigerte sich und soll im Kloster gestorben sein. Ich habe sie geliebt und sie hat mich geliebt. Doch mit ihrer Schwester könnte ich auch glücklich werden, denn ich mag auch sie sehr und sie mich“, erwiderte Roland.
„Dann gibt es mehrere Gründe, weshalb ich davon absehe, um die Prinzessin zu werben: Erstens würden Kinder, die ich mit der Prinzessin noch zeugen könnte, kein Anrecht auf den Thron haben, solange ihr Erstgeborener nicht vorzeitig zu Gott berufen wird. Zweitens: Ich müsste wohl hierbleiben, wenn ich die Mutter des künftigen Königs heirate. Ich habe aber selbst einen Thron zu erben. Drittens: Die Souveränität meines Reiches hängt an meiner Familie. Mein Vater hat aber nur einen Sohn, mich. Bleibe ich hier, ist kein Mann aus meinem Haus mehr der Herrscher Wenglands. Damit könnte der Kaiser mein Land in sein Reich zwingen. Viertens: Sie ist einem anderen zugetan, nämlich Euch und Ihr liebt sie, wenn ich Euch recht verstanden habe. Da werde ich mich nicht einmischen – auch nicht, um Jerusalems König zu werden. Für mich steht die Liebe darüber. Ich werde Euch die Frau, die Ihr liebt und die Euch liebt, nicht streitig machen“, entgegnete Rudolf. Roland nickte.
„Dann ist Wengland ein Reich der Ritterlichkeit, wenn selbst der Thronfolger so denkt. Ihr wärt ein König, dem ich treu sein könnte“, sagte er.
„Nun, wenn Ihr erneut um sie werbt und es Euch gelingt, ihr Gemahl zu werden, wäre die Krone in Euren Händen. Wäre sie nicht Euer Ziel?“
Roland lächelte sanft.
„Nein. Das war sie auch nie. Wenn ich Sibylla heirate, wären meine Kinder mit ihr ebenso wenig erbberechtigt wie Eure. Das würde mich veranlassen, auf den Thron zu verzichten.“
Rudolf sah ihn eine Weile forschend an.
„Welcher Mann würde freiwillig auf eine Krone verzichten?“, fragte er. „Das ist ein Schatz, der einem nicht alle Tage geboten wird.“
„Das ist wahr“, räumte Roland ein. „Doch ich weiß, welche Schlangengrube der Jerusalemer Hof ist.“
„Und doch wollt Ihr sie heiraten“, bemerkte Rudolf. „Wenn Ihr es gleichwohl ablehnt, Jerusalems König zu werden, seid Ihr bescheidener als jeder Bettelmönch.“
Als Roland am Abend im Bett lag, gingen ihm die königlichen Schwestern nicht mehr aus dem Kopf. Würde er wirklich auf die Krone verzichten, sollte Sibylla sie ihm antragen?
‚Nimm, was man dir freiwillig gibt, aber fordere nicht‘, hallte Bruder Jeans Mahnung in ihm nach. Nein, fordern würde er die Krone nicht, aber musste sich eingestehen, dass er sie auch nicht ablehnen würde, böte man sie ihm an.
Nach dem Frühstück am folgenden Tag zogen Roland, Rudolf und die wenglischen Ritter weiter. In einem mittleren Tempo erreichten sie Nablus am späten Nachmittag. Weil Balduin einen Boten nach Nablus vorausgesandt hatte, waren Balian und Maria von Ibelin schon auf die Rückkehr des Sohnes und den hohen Besuch vorbereitet. Der Hausherr und seine geliebte Frau erwarteten die Ankömmlinge im Hof.
Roland trabte voraus, sprang vom Pferd und eilte seinem Vater entgegen, der ihn mitten im Hof umarmte und herzte.
„Willkommen zu Hause, mein Sohn! Lass dich ansehen! Du bist gewachsen, seit du fortgingst!“, bemerkte Balian.
„Vater! Ich bin so froh, wieder hier zu sein!“, presste Roland heraus. Er hatte Tränen des Glücks in den Augen. Als er seine geliebte Stiefmutter umarmte, wandte Balian sich an die Gefährten seines Sohnes:
„Willkommen auch Euch, Prinz Rudolf. Mein Bruder sandte mir die Nachricht, dass Ihr meinen Sohn begleitet. Ich hörte, Ihr seid auf Brautschau.“
„Ich danke für das herzliche Willkommen, Herr Balian“, erwiderte der Prinz und stieg vom Pferd. Balian verneigte sich.
„Hoheit“
„Nein, verrenkt Euch nicht“, wehrte Rudolf ab. „Meine Männer und ich haben schon die Gastfreundschaft Eures Bruders und die in Eurem Stadtanwesen in Jerusalem genossen.“
„So genießt auch die meine“, lächelte Balian und präsentierte zu seiner Rechten. „Dies ist meine liebe Gemahlin Maria“, stellte er vor. Rudolf verbeugte sich vor der schönen Frau und deutete einen Handkuss an.
„Es ist mir eine Ehre“, sagte er. „Herr Balian, Ihr habt einen schönen Sohn. Ich hörte, Ihr habt auch eine Tochter im heiratsfähigen Alter …“
„… die Euch interessiert; ich weiß“, grinste Balian. Er drehte sich um.
„Hassan! Moses! Philipp! Nehmt den Rittern die Pferde ab und ersorgt sie! Evelin! Stefanie! Martha! Das Gepäck auf die Zimmer! Unsere Gäste wollen sich frisch machen!“, befahl er den Bediensteten. „Eure Pferde und Euer Gepäck werden versorgt. Ruht Euch aus. Ich lasse das Abendessen richten. Dan werdet Ihr auch meine Tochter kennen lernen“, wandte er sich wieder an Rudolf, der sich schweigend verneigte.
Eine gute Stunde später saßen die wenglischen Ritter und ihr Prinz an einer langen Tafel in der Halle der Familie Ibelin. Alle waren frisch gebadet und sauber gekleidet.
Rudolf trug ein weißes Leinenhemd, darüber eine dunkelgrüne Tunika. Halsausschnitt und Ärmelkanten waren mit goldener Borte verziert, in die dunkelgrüne Rauten eingewebt waren. Ein Lederband mit einem geteilten goldenen Anhänger aus einer Krone und einem Medaillon mit einer Wappenlilie schaute aus dem am Hals offenen Hemd und hing bis knapp unter dem Halsausschnitt der Tunika herunter. Ein kräftiger, brauner Ledergürtel hielt die Tunika zusammen und trug eine braune Ledertasche mit einer goldenen Lilie als Zier.
Roland hatte seinen von rot und sandgelb gespaltenen Gambeson mit einem ebenfalls weißen Leinenhemd und einer dunkelblauen Tunika vertauscht. Während Rudolfs Tunika bis zu den Knien reichte, war Rolands Tunika gut wadenlang. In den Stoff waren goldene Efeublätter eingewebt. Halsausschnitt und Ärmelkanten waren mit goldener Borte besetzt. Ein Gürtel aus dem gleichen Stoff mit goldener Borte ergänzte das edle Kleidungsstück.
Balian trug über einem weißen Leinenhemd eine ebenfalls dunkelblaue Tunika, die aber ebenso lange wie weite Ärmel hatte. Die Ärmelkanten waren mit schmaler, goldener Borte besetzt, am Halsausschnitt fehlte eine Borte, doch waren die oberen Ecken des Ausschnitts mit silberner Arabeskenstickerei versehen, die die Kostbarkeit der Tunika unterstrich.
Maria von Ibelin war mit einem mehrlagigen Kaftan aus Seide angetan, der die Farben des Hauses Ibelin – rot und gelb – wie ein Stück vom Regenbogen in Stufen präsentierte. Mit ihr kam ihre Tochter aus erster Ehe, Isabella, die jetzt acht Jahre alt war und eine kleinere Version des mütterlichen Kaftans trug.
Balian klatschte in die Hände und Martha, eine der Dienerinnen erschien mit Marie, Balians Tochter aus erster Ehe. Rudolf stockte der Atem, als er sie sah: Wie ihr Bruder hatte sie fast schwarzes Haar und dunkelbraune Augen. Ein zarter, hellrosa Schleier, den ein mit winzigen Perlen besticktes Stirnband hielt, umrahmt ein fein gezeichnetes Gesicht. Es war unverkennbar, dass sie und Roland Geschwister waren. Ihr Kleid war ein himmelblauer Seidenkaftan, der aus sieben oder acht hauchzarten Seidenlagen in unterschiedlich abgestuften Farbschattierungen bestand. Ein dunkelblauer Seidengürtel mit silberner Schnalle und weiße Seidenschuhe mit Perlenstickerei ergänzten ihre Ausstattung.
Der Prinz erhob sich und verneigte sich, ohne es eigentlich zu wollen.
„Marie, dies ist Prinz Rudolf von Wengland“, stellte Balian den hohen Gast vor. Das junge Mädchen lächelte scheu. Niedliche Grübchen in den Wangen verzauberte den wenglischen Thronfolger noch mehr.
„Willkommen im Hause meines Vaters, königliche Hoheit“, begrüßte sie ihn mit glockenheller Stimme. Rudolf räusperte sich mehrfach, aber der Frosch im Hals ließ nicht los, und seine Zunge versagte ihm schlicht den Dienst. Ein anderer junger Mann von den wenglischen Rittern erhob sich. Er war ebenfalls dunkelblau gekleidet, an den Kanten des Ausschnitts waren kleine goldene Eichenblätter eingestickt.
„Verzeiht, schöne Jungfer, aber meinem künftigen König verschlägt Eure zauberhafte Erscheinung einfach die Worte. Wäre ich, Theodor von Eichgau, nicht schon glücklich verheiratet, würde ich meinem Prinzen jetzt mit einer Werbung zuvorkommen. Erlaubt mir, im Namen meines Thronfolgers um Euch als unsere Prinzessin und künftige Königin zu werben“, sagte er, kam vom Tisch zu ihr und ging in die ritterliche Kniebeuge. „Wenn Ihr es wünscht, so will ich Euch schon jetzt die Treue schwören und Euch mit meinem Leben verteidigen“, setzte er hinzu.
„Erhebt Euch, Herr Theodor. Ihr seid überaus galant“, sagte Marie mit sanftem Lächeln, das dem ihres Bruders so ähnelte.
Erst jetzt fand Rudolf die passenden Vokabeln, um Maire in ihrer eigenen Sprache anzureden:
„Holde Marie von Ibelin, Eure Schönheit raubt mir Atem, Sprache und Verstand“, brachte er heraus. Er trat zu ihr, schob Theodor sanft beiseite und kniete vor ihr nieder.
„Bitte, holde Marie, erhört mein Flehen. Folgt mir nach Wengland und werdet meine Königin, wenn die Zeit gekommen ist und mein Vater auf den Pfad zum Himmel geht.“
Maries Lächeln wurde breiter.
„Erhebt Euch, Hoheit. Ich bitte Euch, mich erst wirklich kennen zu lernen, bevor Ihr mir ein solches Angebot macht. Ihr wollt Euch doch keinen Drachen fangen!“, neckte sie Er sah hoch, erhob sich dann, behielt ihre Hände in den seinen.
„Drachen habe ich meinem Nachbarreich. Nein, schöne Marie, niemals könntet Ihr so giftig sein wie wilzarische Drachen!“ wehrte er ab. Sie beließ ihre Hände bei ihm und sah zu ihm hoch, da er einen halben Kopf größer war als sie.
„Dennoch: Lernt mich erst kennen. Äußerlichkeiten sind nicht alles. Nehmt Euch etwas Zeit und gebt auch mir die Gelegenheit, festzustellen, was sich hinter Eurer zweifellos schönen Fassade verbirgt“, sagte sie. Er nickte nur stumm.
Fortsetzung folgt
Glossar
Bailli: In Frankreich bzw. im christlichen Königreich Jerusalem Regent, der den Fürsten eines Lehens oder auch den König selbst vertritt.
Besant: Goldmünze, die im 12. Jh. im Mittelmeerraum allgemein gebräuchlich war. Die Bezeichnung Besant beruht auf der Herkunft der Münzen aus Byzanz. Der Besant ist identisch mit dem römischen Aureus Solidus und hatte ein Gewicht von 4,55 Gramm. Ursprünglich bestand der Aureus Solidus aus reinem Gold. Unter den Komnenen in Byzanz erfuhr der Besant aber eine Verschlechterung des Goldgehaltes, so dass über den genauen Wert nichts gesagt werden kann. Aber selbst, wenn nur noch 1 g Gold je Münze verblieben sein sollte, wäre 1 Besant immer noch mindestens 20 € wert…
Denier: Teilstück der französischen Währung Livre↑ und deren kleinste Stückelung. 240 Deniers ergeben 1 Livre.
Donjon: Befestigter Wohnturm innerhalb einer Burg. Im Gegensatz zum Bergfried, der eigentlich eine reine Verteidigungsanlage ist und nur in Notfällen als Wohnturm benutzt wurde, ist der Donjon ähnlich dem Palas ein reines Wohngebäude.
Elle: altes Längenmaß, ca. 50 cm
Flugseite: Der Teil der Flagge oder Fahne, die frei im Wind weht. Gegenteil von Stockseite↑.
Gambeson: Wattiertes Wams, ab dem 10. Jh. zunächst als eigenständige textile Rüstung entwickelt, die in England im 12. Jh. sogar den freien Bürgern neben Spieß und eisernem Helm als Grundausrüstung vorgeschrieben war. Später wurde der Gambeson auch als Schutzbekleidung gegen Quetschungen und Druckstellen unter der Rüstung getragen.
Klafter: Altes Längenmaß, ca. 180 cm.
Konstabler: Nicht zu verwechseln mit dem untersten Polizeidienstgrad in Großbritannien! Im Königreich Jerusalem war das Amt des Konstablers vergleichbar mit dem eines Verteidigungsministers.
Livre: Frz. Währungseinheit vom 9 bis zum 18. Jh., aber keine Münze, sondern eine Verrechnungseinheit. 1 Livre = 20 Sous = 240 Deniers. Der Name leitet sich von libra (lat.: Waage) ab und wurde bereits unter Karl dem Großen noch unter den alten lateinischen Bezeichnungen libra (= Waage, als Synonym für die Gewichtseinheit Pfund), – solidus (frz. Sou, dt./engl. S(c)hilling – denar (frz. denier) in den fränkischen Gebieten eingeführt. Die französische Livre entsprach grundsätzlich einer Masse von rd. 400 g Silber.
Über die Kaufkraft lässt sich nur bedingt etwas sagen, da in der Folgezeit die Sou- und Denier-Münzen nicht immer mit dem Nenngehalt an rd. 20 g bzw. 2 g Feinsilber übereinstimmten. Ende des 18. Jh., unmittelbar vor der Revolution, sollen die Münzen, aus denen sich die Livre zusammensetzte, nur noch ca. 1/18 des Silbergehaltes von 1266 gehabt haben und 1 Livre vermutlich noch einen Gegenwert von ca. 15 € gehabt haben. Demnach wäre 1 Livre im 13. Jh. in € umgerechnet ca. 270 € wert gewesen. Dieser Wert dürfte auch auf die frühere Zeit des 3. Kreuzzuges anwendbar sein.
Oberecke: Das (heraldisch) rechte obere Viertel eines Wappenschildes, bzw. das obere Viertel einer Flagge an der Stockseite↑.
Outremer: französische Bezeichnung für das Heilige Land. Wörtlich übersetzt bedeutet es Übersee.
Patene: auch Hostienschale genannt. Liturgisches Gefäß in Form einer flachen Schale, das in der römisch-katholischen Kirche bei der Kommunion verwendet wird. Auf der Patene wird die Hostie nach der Wandlung abgelegt. Sie besteht in der Regel aus Gold. Wird weniger edles Metall verwendet, wird die Ablagefläche vergoldet.
Rohan: Nein, Rohan ist keine Erfindung von J. R. R. Tolkien, die Vizegrafschaft in der Bretagne gab es wirklich. Als Gemeinde gibt es Rohan bis heute.
Schwarzer Normanne: Nein, gar nicht erst in der Liste der Pferdrassen nachsehen. Meine Erfindung.
Schwertfeger: Handwerker, der die rohe Schwertklinge durch Polieren, Schliff, ggf. Ätzung und Verzierung vervollkommnete und veredelte. Klingenschmiede übernahmen eigentlich nur die Herstellung der reinen Klinge samt Angel ohne den Griff (Heft).
Schweißen: Unter Schmieden versteht man darunter das Zusammenfügen von Metallen, die erhitzt (erwärmt in der Fachsprache) und mit dem Schmiedehammer geschlagen werden. Die moderne weitere Variante, Metalle durch einen Schweißstrahl (elektrisch oder mit Gas) und Schweißdraht zu verbinden, entstand erst im 20. Jahrhundert.
Sergeant: Nichtadliger, berittener Kriegsknecht im anglo- und frankophonen Sprachgebiet. Nicht zu verwechseln mit dem englischen oder französischen Unteroffiziersdienstgrad.
Sou: Teilstück der französischen Währung Livre↑ und größte Münze, die geprägt wurde. 20 Sou ergeben 1 Livre.
Spanne: Altes Längenmaß, etwa 15 cm.
Stockseite: Die Seite einer Flagge oder Fahne, die am Mast bzw. dem Flaggstock befestigt ist. Gegenteil von Flugseite↑.
Trébuchet: Auch Blide genannt. Dreibeiniges Belagerungsgerät, das am eigentlichen Wurfarm zusätzlich eine sehr lange Schleudervorrichtung aus Seilen und einer Art Sack hat, mit der das Geschoss (meist aus Stein) über größere Entfernungen geschleudert werden kann.
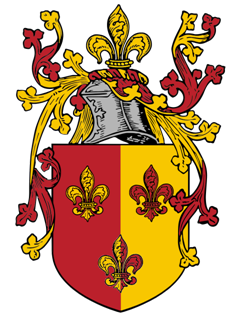

Schreibe einen Kommentar