\
Kapitel 1
Ein Amerikaner in Hamburg
Steve Donovan war Captain des US Army Air Corps, Jagdflieger aus Leidenschaft, arbeitete seit März 1939 im Auftrag des Kriegsministeriums als Militärattaché am amerikanischen Konsulat in Hamburg. Er war jetzt siebenundzwanzig Jahre alt, für einen Diplomaten viel zu jung. Aber Donovan sprach fließend Deutsch, hatte schon als Junge in Berlin gelebt, als sein Vater den gleichen Job, den jetzt der Sohn hatte, an der amerikanischen Botschaft in Berlin getan hatte.
Sein Vater allerdings war Brigadier-General und über vierzig Jahre alt gewesen, als man ihn nach Deutschland geschickt hatte. Brigadier Daniel Boone Donovan hatte unter seinen Vorfahren Deutsche entdeckt und sich daraufhin um den Posten in Berlin beworben. Steve war als vierzehnjähriger Junge nach Deutschland gekommen, weil er seinen Vater unbedingt begleiten wollte – im Gegensatz zur Mutter und seinen drei Brüdern, die dem engen Europa nichts abgewinnen konnten.
Steve hatte die Unruhe in Deutschland nach dem Weltkrieg erlebt, und er verstand die Deutschen besser, als jeder andere Amerikaner, dafür hatte er lange genug unter ihnen gelebt. Sein Deutsch hatte Berliner Färbung, in die sich jetzt, nach einem halben Jahr Aufenthalt in Hamburg, auch hanseatische Elemente mischten. Trotz allen Lebens in Deutschland war Donovan Amerikaner mit Überzeugung geblieben. Seinen Auslandsaufenthalt sah er als kleine Hilfe an, um beim Army Air Corps aufzusteigen – vorausgesetzt, dieser Aufstieg hinderte ihn nicht am Fliegen. Jetzt, im Spätsommer 1939, klebte er allerdings am Boden, weil die zuständige Behörde in Hamburg sich sehr zierte, ihm eine Fluglizenz zu erteilen …
„Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurück geschossen!“, krächzte die Stimme von Adolf Hitler aus dem Goebbelsharfe oder Volksempfänger genannten Radio. Rau war diese Stimme, wiewohl Hitler immer ganz leise zu sprechen begann, um sich dann zu einem fast bellenden Stakkato von Versprechungen, Behauptungen, Drohungen, Beschimpfungen zu steigern. Steve Donovan kannte diese Stimme gut. Er hatte Hitler mehr als nur einmal reden hören. Um dessen Buch Mein Kampf hatte Donovan allerdings einen genauso großen Bogen gemacht wie die meisten Deutschen. Ein Fehler, denn er hätte das, was Hitler in seiner jetzigen Rede sagte, dort als Planung nachlesen können. So aber ließ er vor Schreck seine Morgenzeitung, die New York Times fallen, glaubte, nicht recht gehört zu haben. Verstört drehte er das Radio lauter. Durch die atmosphärischen Störungen und die mangelnde Trennschärfe des Volksempfängers krächzte der „Führer“ über das Recht Deutschlands, die Polen auf der Westerplatte bei Danzig zu beschießen, nachdem reguläre polnische Truppen angeblich einen deutschen Radiosender in Gleiwitz an der deutsch-polnischen Grenze überfallen hatten. Es war eine hundertprozentige Lüge, die Hitler ungeniert verbreitete und die dazu dienen sollte, das deutsche Volk für die Notwendigkeit eines Krieges zu gewinnen – doch zu diesem Zeitpunkt war die Tatsache, dass deutsche SS-Leute in polnischen Uniformen den Überfall ausgeführt hatten, nur denen bekannt, die es den Männern befohlen hatten, also der Spitze der Reichsführung.
„Großer Gott! Das gibt eine Katastrophe!“, entfuhr es Donovan. Er warf einen Blick auf die zu Boden gegangene amerikanische Zeitung. Sie war vom 31. August 1939, also vom Vortag. Steve hatte die Zeitung abonniert, um wenigstens auf diese Weise mit zu Hause in Verbindung zu bleiben, aber die Verbindung war nicht ganz aktuell, weil er sie mit mindestens einem Tag Verspätung erhielt. Und danach hatten jedenfalls seine Landsleute nicht den geringsten Schimmer von einem bevorstehenden Krieg. Steve strich sich über den Kopf, als wolle er seine militärisch kurz geschnittenen Haare wieder glätten, nachdem Hitlers Rede sie ihm zu Berge hatte stehen lassen. Dann sah er auf die Uhr. Es war jetzt viertel nach acht. Für halb neun hatte er sich mit Siegfried Heinsohn, einem deutschen Luft Hansa*-Piloten, zum Tennisspiel am Rothenbaum verabredet. Siegfried Heinsohn war Mitglied in dem renommierten Club an der Alster und hatte für Donovans Gastmitgliedschaft gebürgt. Heinsohn und Donovan kannten sich schon länger. Sie waren sich vor drei Jahren in Danzig, einer unter Völkerbundsverwaltung stehenden Stadt in Westpreußen, begegnet. Als Donovan dann nach Hamburg gekommen war, hatte er sich mit Heinsohn in Verbindung gesetzt und bald hatte sich eine dauerhafte Freundschaft entwickelt.
‚Hoffentlich ist Siggi überhaupt da. Hatte er nicht irgendwas von Übung erzählt?’, dachte Donovan. Ein Blick in seinen Terminkalender bestätigte allerdings die Verabredung. So nahm er seine Tennistasche und verließ das Haus. Von seiner Wohnung am Harvestehuder Weg war es nur ein Fußweg von kaum fünf Minuten bis zum Tennisplatz an der Hansastraße. Normalerweise trafen sich die Freunde eine halbe Stunde, bevor ihr Platz frei wurde.
Wider Steves Erwartung saß Siegfried an der Bar im Clubhaus – allerdings nicht im weißen Tennisanzug, sondern in der blaugrauen Uniform der deutschen Luftwaffe.
„Guten Morgen, Steve“, grüßte Siegfried.
„Danke, ein guter Morgen ist es nicht, nach dem, was ich eben im Radio gehört habe, Siggi. Ich hab’ schon befürchtet, dich hier gar nicht zu finden. Und da du hier in Uniform sitzt, nehme ich an, dass ich keine Albträume hatte, sondern die Wahrheit gehört habe“, gab Steve zurück und setzte sich zu Heinsohn an die Bar.
„Was darf ich Ihnen bringen, Herr Donovan?“, fragte der Kellner.
„Kaffee, bitte“, bestellte Steve. Siegfried nickte bedrückt.
„Aus unserem Spiel heute wird leider nichts – und in der nächsten Zeit mit Sicherheit auch nicht. Ich habe meine Einberufung bekommen“, seufzte Heinsohn. „Ich bin auch nur deshalb noch hier, weil mir noch eine fliegerärztliche Untersuchung fehlt, die ich wegen eines Fernfluges nach Rio nicht machen lassen konnte. Ich bin für heute Morgen zum Standortarzt bestellt und werde dann wohl gleich nach Stolp zu meiner Einheit fliegen. Ich wollte mich eigentlich verabschieden. Und dir würde ich raten, dich bald in die Staaten zu verdrücken“, sagte er.
„Hat Adolf uns auch den Krieg erklärt? Vorhin im Radio war nur von Polen die Rede“, gab Donovan zu bedenken. Heinsohn seufzte erneut.
„Steve, ich komme viel in der Welt herum und höre manches, was nicht unbedingt in der Zeitung steht. England und Frankreich haben Polen Sicherheitsgarantien gegeben. Es wird größeren Streit geben, als nur mit Polen“, warnte er.
„Nach meinen Informationen sind die USA neutral – wenn ihr nicht wieder Schiffe versenken Marke Lusitania spielt“, erwiderte Donovan. Er sah seinen Freund an, der nicht recht glücklich aussah.
„Hör mal, du siehst nicht so aus, als ob du viel Spaß an der Geschichte hättest und dir die Uniform schmeckt. Soll ich dir die Einreisepapiere besorgen?“, bot Steve an.
„Pscht, verdammt!“, wehrte Heinsohn harsch ab. „In Deutschland haben die Wände Ohren!“, warnte er. „Ich brauche aber eine Visaverlängerung für die Staaten. Wenn sie mich heute noch mal gehen lassen, komme ich nachher von der Sophienterrasse ins Konsulat.“
„Na gut. Ich warte in der Visaabteilung. Falls du nicht kommst: Mach’s gut und bleib sauber“, verabschiedete sich Donovan, schüttelte Heinsohn die Hand, trank seinen Kaffee aus, bezahlte, nahm seine Tasche und wollte gehen.
Im gleichen Moment öffnete sich die Tür des Vereinslokals und zwei Männer in Ledermänteln traten ein.
„Geheime Staatspolizei! Niemand verlässt den Raum!“, befahl der vordere Eintretende. Steve sah sich um. Siegfried und der Kellner waren sichtlich bleich geworden. Er ließ die Tasche fallen und lehnte sich nach hinten gegen die Bar. Der Gestapo-Beamte kam direkt auf ihn zu.
„Herr Steve Donovan?“
Es war mehr eine Feststellung als eine Frage.
„Das ist mein Name“, erwiderte der Amerikaner.
„Begleiten Sie uns, bitte“, forderte der Gestapo-Mann Steve auf.
„Darf ich fragen, weshalb?“, erkundigte sich Steve.
„Weil ich das sage, Herr Donovan“, versetzte der Gestapo-Beamte herablassend. „Der Geheimen Staatspolizei stellt man keine Fragen.“
„Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich als Mitarbeiter des amerikanischen Generalkonsulats diplomatische Immunität genieße“, entgegnete Donovan und griff in die Hosentasche, um seinen Konsulatsausweis vorzuzeigen.
„Danke, das ist unnötig, Herr Donovan. Wir wissen um Ihren diplomatischen Status“, wehrte der Beamte den Versuch ab.
„Was hat das dann zu bedeuten?“
„Sie werden es rechtzeitig erfahren. Folgen Sie uns, bitte.“
Donovan war unbewaffnet und wollte keinen diplomatischen Zwischenfall provozieren, den die deutsche Propaganda vielleicht als Aufhänger nutzen konnte, um Amerika den Krieg zu erklären. Schulterzuckend nahm er seine Tasche und folgte den Gestapo-Leuten. Sie brachten ihn zu einem schwarzen Horchcabrio mit geschlossenem Verdeck, das in der Hansastraße geparkt war. Auf ein Klopfen an die Trennscheibe fuhr der Fahrer in Richtung Rothenbaumchaussee an und steuerte das Fahrzeug in Richtung Innenstadt, fuhr zur Innenbehörde am Johanniswall. Auf einem der langen Flure musste der Amerikaner fast eine volle Stunde in Bewachung der beiden Gestapo-Männer warten, bis er aufgerufen und in eines der typischen Amtszimmer geführt wurde. Der Geruch von Aktenstaub, Linoleum und Bohnerwachs war allgegenwärtig.
„Nehmen Sie Platz, Herr Donovan. Kaffee?“, bot der Beamte hinter dem Schreibtisch betont höflich an.
„Danke, nein. Ich wüsste gern, was ich hier soll“, versetzte Steve.
„Sie sind Steven Christopher Donovan, geboren am 13. Januar 1912 in Phoenix, Arizona-Territorium*, USA?“, fragte der Beamte, ohne auf Steves Frage einzugehen.
„Korrekt.“
„Sie sind derzeit Hauptmann bei der Armeeluftwaffe der Vereinigten Staaten, abkommandiert zum diplomatischen Dienst?“, fragte der Beamte weiter.
„Richtig. Ergibt sich aber alles aus meinem Beglaubigungsschreiben, das ich im März dem Ersten Bürgermeister, Herrn Krogmann, überreicht habe“, gab Donovan zurück.
„Daraus zitiere ich auch, Herr Donovan“, entgegnete der Beamte mit kühlem Lächeln.
„Was, zum Teufel, wollen Sie eigentlich von mir?“, erkundigte Steve sich mit gewisser Reizung in der Stimme.
„Das kann ich Ihnen sagen, wenn ich zweifelsfrei festgestellt habe, dass Sie die betreffende Person sind“, erklärte der Beamte. Steve zog seinen Konsulatsausweis und warf ihn auf den Tisch.
„Bitte, mein Ausweis mit Lichtbild, Dienstgrad, Geburtsdatum, Aufgabenbereich und Dienstsiegel des Konsulats“, knurrte er. Der Beamte nahm ihn, prüfte ihn akribisch und reichte ihn dann zurück.
„Danke, Herr Donovan. Sie haben einen Antrag auf Erteilung einer Privatpilotenlizenz im Großdeutschen Reich nachgesucht.“
„Stimmt, das war vor einem halben Jahr, als ich nach Hamburg versetzt wurde“, bestätigte Steve. „Für gewöhnlich reicht mein Dienstausweis des Army Air Corps, um eine solche Lizenz innerhalb weniger Tage zu erhalten“, setzte er dann sarkastisch hinzu.
„Herr Donovan, Sie sind hier in Deutschland – nicht in irgendeinem unterentwickelten Kaffernstaat. Hier herrschen Ordnung und Disziplin. Das gilt auch für ausländisches Botschaftspersonal!“, wies der Beamte ihn zurecht.
„Dann darf ich Herrn Mussolini bestellen, dass Sie das faschistische Italien als unterentwickelten Kaffernstaat bezeichnen?“, konterte Steve, als er den ersten Zorn niedergerungen hatte. „In Rom habe ich meinen Dienstausweis vorgelegt und hatte innerhalb von zehn Minuten meine italienische PPL*!“
Der Beamte lächelte nachsichtig.
„In mancher Hinsicht sind die italienischen Volksgenossen nicht ganz auf der Linie unseres Führers, Herr Donovan“, erwiderte er beinahe liebenswürdig. Donovan knurrte unwillig.
„Na gut. Da Sie nun festgestellt haben, wer ich bin, wüsste ich doch gern, was denn mit meiner PPL ist.“
„Haben Sie vor, innerhalb der nächsten sechs Monate in die USA zurückzukehren?“, fragte der Beamte, ohne auf die Frage einzugehen.
„Ich habe derzeit keine Information, dass ich vor Ende der laufenden Wahlperiode nach Washington zurückberufen werde. Die Wahlperiode endet am 6. November 1940, spätestens mit Amtsantritt des eventuell neuen Präsidenten am 20. Januar 1941“, gab Steve Auskunft.
„Herr Donovan, es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass sich das Deutsche Reich seit heute im Kriegszustand mit Polen befindet“, bemerkte der Beamte.
„Nein, das ist mir nicht entgangen. Ebenso wenig wie die Ultimaten, die Ihrer Regierung von Seiten Frankreichs und Englands gestellt wurden“, versetzte Steve bissig.
„Glauben Sie wirklich, dass das Deutsche Reich sich in seinen souveränen Entscheidungen vom Ausland unter Druck setzen lässt, Herr Donovan?“
„Ob ich das glaube oder nicht, ist von untergeordneter Bedeutung“, gab Donovan zurück. „Meine Regierung verhält sich – soweit ich unterrichtet bin – neutral. Aber wenn Sie meine Privatmeinung wissen wollen: Es wäre gesünder, dem Druck des Auslands nachzugeben. Aber wie gesagt: Meine Privatmeinung.“
„Sie halten einen Krieg gegen Polen also für ungerecht?“
„Bislang kenne ich nur die Darstellung Ihrer Presse. Bislang hatte ich keine Gelegenheit, neutrale Berichte über den Kriegsbeginn von heute Morgen zu lesen oder zu hören oder mir eventuell selbst ein Bild zu machen“, erwiderte Steve zurückhaltend.
„Sie sind also der Meinung, das Deutsche Reich führe einen ungerechten Krieg?“, fragte der Beamte nochmals nach, seine Stimme war eine Spur schriller.
„Das haben Sie gesagt. Ich habe lediglich zum Ausdruck gebracht, dass ich das zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beurteilen kann“, antwortete Steve diplomatisch.
„Als Luftwaffensoldat sind Sie doch sicher mit der Theorie von Douhet* hinsichtlich der Wirksamkeit von Flächenbombardements konfrontiert worden. Was halten Sie davon?“
„Über strategische Überlegungen meiner Regierung kann ich keine Auskunft geben. Auch nicht darüber, ob mir eine solche Theorie bekannt ist. Aber vielleicht fragen Sie Ihre Luftwaffenexperten der Legion Condor. Die haben das doch an Guernica ausprobiert“, gab der Amerikaner zurück.
„Wir wissen, dass Sie eine gewisse Anzahl von Flugstunden nachweisen müssen, um Ihre Flugtauglichkeit zu erhalten. Ohne Lizenz dürfen Sie hier nicht fliegen. Können Sie es sich leisten, Ihre Flugtauglichkeit einzubüßen?“, fragte der Beamte maliziös.
„Ich weiß nicht, ob es sich das Deutsche Reich leisten kann, einen ausländischen Offizier im diplomatischen Dienst zu erpressen“, giftete Donovan. „Wenn Sie mir die Lizenz verweigern, weil ich nicht bereit bin, Ihnen die Luftstrategie der Vereinigten Staaten offen zu legen, werde ich das dem Secretary of State in Washington mitteilen müssen.“
„Aber nein, Herr Donovan. Nur – Deutschland befindet sich seit heute im Krieg. Wir müssen kriegswichtige Güter natürlich bewirtschaften – insbesondere Treibstoff, wie zum Beispiel Flugbenzin, das an der Front in Polen sicher dringender gebraucht wird, als zum privaten Verbrauch in der Heimat“, grinste der Beamte.
„Danke, ich habe verstanden! Ich ziehe meinen Antrag auf Erteilung der PPL hiermit zurück“, schnaufte Steve.
„Wir können das sicher regeln, wenn Sie uns ein wenig unterstützen“, lockte der Beamte.
„Es scheint, als verstünden Sie Ihre eigene Sprache nicht. Ich bin nicht bereit, Ihnen militärische Auskünfte irgendwelcher Art zu geben. Zwecks Verhinderung weiteren Druckes ziehe ich meinen Antrag auf die deutsche Fluglizenz zurück und riskiere lieber, ein paar Flugstunden nehmen zu müssen, bevor man mir zu Hause erlaubt, wieder zu fliegen“, verdeutlichte Donovan.
„Schade, wir hatten gehofft. Sie wären vernünftiger“, erwiderte der Beamte seufzend. „Sie stehen vorläufig unter Hausarrest.“
„Aha – und weshalb?“, knurrte Steve.
„Sie werden als feindlicher Ausländer interniert“, präzisierte der Beamte.
„Moment! Erstens bin ich mit diplomatischer Immunität gesegnet und zweitens bin ich amerikanischer Staatsbürger. Die USA haben mit Deutschland weiterhin diplomatische Beziehungen, der Krieg ist nicht erklärt. Die USA sind im gegenwärtigen Konflikt neutral!“, protestierte Steve.
„Das hindert Ihre Regierung nicht, deutsche Staatsbürger zu internieren“, versetzte der Deutsche. Steve sah auf seine Armbanduhr. Es war fünf Minuten vor neun.
„Mit Verlaub: Das glaube ich nicht!“
„Sie bezichtigen mich also der Lüge!“, stellte der Beamte scharf fest.
„Sie stellen eine Behauptung über meine Regierung auf, die ich zunächst nicht überprüfen kann. Davon aber abgesehen, habe ich meine Zweifel, dass meine Regierung vom Ausbruch der Feindseligkeiten Ihrerseits mit Polen überhaupt schon Kenntnis hat und es fertig gebracht haben sollte, innerhalb von fünf Stunden die in den USA lebenden deutschen Staatsangehörigen bereits zu internieren. Ferner sollten Sie nicht übersehen, dass man in Washington noch in den Morgen träumt. Dort ist es noch nicht mal drei Uhr morgens, weil die Uhren dort nun mal gegenüber der mitteleuropäischen Zeit sechs Stunden hinterherlaufen“, erklärte Donovan bissig. „Und noch was: Sie lassen mich besser nicht heimlich verschwinden. Mein Dienstherr erwartet mich eigentlich in zehn Minuten zum Dienst. Sie dürften beim Konsulat wenig Erfolg haben, mitzuteilen, ich sei unter Hausarrest gestellt worden.“
Der Beamte lächelte verbindlich, aber ohne Freundlichkeit.
„Aber nein, Herr Donovan. Wir bringen Sie natürlich ins Konsulat.“
„Na prima! Am besten sofort!“
Donovan ging mit den beiden Beamten, die ihn im Tennisclub abgeholt hatten, zum Wagen hinunter. Er traute den Burschen nicht über den Weg. Mit der Gestapo legte man sich besser nicht an. Als er das Horchcabrio bestieg, überlegte er fieberhaft, wie er aus dem Auto entwischen konnte.
„Herr Donovan“, sagte der Mann, er neben ihm saß, „Sie sollten sich wirklich überlegen, ob Sie nicht doch die erbetenen Auskünfte geben wollen“, riet er.
„Womit wollen Sie mir drohen? Damit, dass Sie mich umlegen oder durch die Mangel drehen? Dass Sie sich an meine Familie halten, wenn ich nicht auspacke? Zu Möglichkeit eins und zwei: Ich würde Ihnen dringend davon abraten, da das Konsulat informiert ist, wo ich bin, und zu Möglichkeit drei: Fällt aus wegen ist nicht, da ich hier keine Familie habe“, erwiderte Steve. Der Gestapo-Beamte grinste.
„Herr Donovan, Sie sollten uns nicht für dümmer halten, als wir sind. Natürlich ist uns bekannt, dass Sie keine Familie in Deutschland haben. Aber Sie haben hier Freunde. Und was Ihren Aufenthaltsort anbelangt: Ihr Arbeitgeber hat nicht den geringsten Schimmer, wo Sie stecken. Der Herr Konsul wählt sich die Finger rund, wie wir wissen“, versetzte er. Steve wurde mulmig.
„Interessant. Sie würden also einen Ihrer eigenen Volksgenossen unter Druck setzen, um von mir Informationen zu bekommen? Merken Sie eigentlich nicht, wie schizophren Sie denken?“, bemerkte Donovan. Er bereute die Bemerkung, als der Beamte gelassen in seine Manteltasche griff, eine Walther-Pistole herauszog, entsicherte und mit fast sanftmütigem Lächeln betrachtete. Allein seine dunkler gewordenen Augen verrieten seine Wut.
„Herr Donovan“, seufzte der Beamte, als rede er mit einem begriffsstutzigen Kind. „Schizophrenie ist eine Geisteskrankheit, die zur Einweisung in eine geschlossene Anstalt führt. Sie werden doch nicht etwa einen Polizeibeamten des Großdeutschen Reiches geisteskrank nennen? Was Beamtenbeleidigung bedeutet, muss ich Ihnen doch wohl hoffentlich nicht erklären. Aber es erleichtert die Angelegenheit ungeheuer. Was Ihre Freunde anbelangt: Kontakte mit ausländischem Botschaftspersonal sind nur erwünscht, wenn sie dem deutschen Volk von Nutzen sind. Und ich wüsste nicht, worin der Vorteil für das Volk liegen sollte, wenn Sie mit deutschen Volksgenossen gelegentlich Tennis spielen. Tennis ist eher ein Sport der Müßiggänger – und derlei Elemente dulden wir hier nicht. Der Deutsche ist fleißig und stellt seine Arbeitskraft in den Dienst des Volkes, treibt Sport zur Ertüchtigung des Leibes und zur Erlangung der Wehrhaftigkeit. Dafür ist Tennis denkbar ungeeignet. Es ist einfach ein dekadenter Sport. Wir werden uns mit Ihren deutschen Freunden schon befassen. Unabhängig von dem, was mit Ihnen geschieht.“
Damit richtete der Beamte die Waffe auf den Amerikaner, doch im selben Moment machte der Fahrer eine Vollbremsung, auf die der Gestapo-Mann nicht vorbereitet war und die Steve mehr zufällig abfangen konnte, weil er sich schon auf Verteidigung einstellte. Er griff beherzt zu und versuchte, dem Geheimdienstler die Waffe zu entwinden. Ein Schuss löste sich, der aber wirkungslos durch die Heckscheibe ging. Die Tür wurde aufgerissen und ein halbes Dutzend Militärpolizisten und zwei Luftwaffenoffiziere standen um das Gestapo-Fahrzeug. Der Horch und ein LKW mit Luftwaffenkennzeichen standen hintereinander am Hamburger Fischmarkt. Hinter dem Horch stand ein Mercedes PKW, ebenfalls mit Luftwaffenkennzeichen.
„Steigen Sie bitte aus und machen Sie keine Schwierigkeiten!“, befahl der Offizier in Majorsuniform. Steve sah misstrauisch hinaus, entschied sich dann aber, mit erhobenen Händen auszusteigen, als der Major ihm herrisch winkte.
„Das gilt auch für die Herren von der Geheimen Staatspolizei!“, fauchte der Major, als der Beamte im Fond nicht aussteigen wollte. Mürrisch kroch auch der Gestapo-Mann heraus.
„Hauptmann Steven Christopher Donovan?“, fragte der Major, an Steve gewandt.
„Der bin ich“, bestätigte Steve mit trockenem Hals. „Was wollen Sie nun von mir?“, erkundigte er sich dann heiser.
„Sie sind Soldat, also eher ein Fall für die Militärpolizei, nicht für die Geheime Staatspolizei.“
„Sie …! Das wird ein Nachspiel haben!“, knurrte der Beamte.
„Ich bin im Auftrag von Standartenführer Helms hier. Er hat verfügt, dass Hauptmann Donovan nicht von der Gestapo, sondern von der Militärpolizei zu verhören ist“, erwiderte der Major und rückte mit hintergründigem Lächeln den an einer stabilen Kette hängenden sichelförmigen Schildkragen zurecht, der ihn als Militärpolizisten auswies.
„Von welcher Dienststelle sind Sie?“, fauchte der Gestapo-Beamte, wohl wissend, dass gewöhnliche Polizei sich nicht in die Angelegenheiten der Gestapo oder der SS zu mischen hatte. Der Major lächelte freundlich.
„Feldgendarmeriebataillon des Standortkommandos Hamburg, Abteilung Luftwaffe, Sophienterrasse. Mein direkter Vorgesetzter ist übrigens besagter Standartenführer Helms von der SS, der die Einheit neu organisiert.“
Der Gestapo-Beamte schluckte nur hart. Der Hinweis auf die nahezu allmächtige SS, die in der Polizeihierarchie sogar noch vor der Geheimen Staatspolizei kam, genügte. Der Luftwaffenmajor drehte sich auf den Absätzen seiner polierten Reitstiefel um und winkte einen Unteroffizier heran.
„Unteroffizier Martens!“
Martens knallte die Hacken zusammen und nahm Haltung an.
„Zur Stelle, Herr Major!“
„Befördern Sie die Herren von der Geheimen Staatspolizei wieder in ihr Fahrzeug und passen Sie auf, dass sie verschwinden!“, befahl der Major. Die Gestapo-Beamten sprangen eilig in ihren Horch und brausten davon.
Steve sah die Luftwaffensoldaten fragend an, die sich feixend vom davonfahrenden Horch abwandten und sich vor Lachen fast ausschütten wollten.
„Kommen Sie, bevor die merken, dass wir ihnen nur Theater vorgespielt haben“, sagte der Major und nahm Steve am Arm.
„Bitte?“, fragte der verstört nach.
„Oh, Verzeihung, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Schultz, Eduard Schultz, Major der Luftwaffe beim Standortkommando Hamburg, zurzeit im Militärpolizeidienst. Der Herr neben mir ist Leutnant Kracht von der Luftwaffenschule Hamburg“, stellte Schultz vor.
„Und was möchten Sie von mir?“, fragte Steve misstrauisch.
„Sie zum Konsulat bringen. Leutnant Heinsohn erwartet Sie dort.“
Steve Donovan war zu verwirrt, um ein Wort herauszubringen. Er sah nur verblüfft von einem zum anderen.
„Nun kommen Sie schon. Die kommen wieder“, winkte Major Schultz dem Amerikaner. Steve schüttelte sich einmal, wie um ein Trugbild loszuwerden, dann stieg er endlich auf die Ladefläche des Luftwaffen-LKWs. Leutnant Kracht stieg mit den Feldpolizisten ebenfalls hinten ein. Zu Donovans Erleichterung sicherten die Feldjäger ihre Gewehre und legten sie recht demonstrativ unter die Sitzbänke.
„Was läuft hier eigentlich?“, fragte Steve den deutschen Leutnant. Kracht lächelte in einer Weise, die der Amerikaner von einem deutschen Soldaten nicht erwartet hätte. Aber vielleicht war Kracht noch nicht lange genug Soldat, um sich dieses freundliche Lächeln schon abgewöhnt zu haben.
„Ich bin ein Freund von Siegfried Heinsohn. Wir waren Kollegen bei der Luft Hansa, bis ich mich zur Luftwaffe gemeldet habe. Siggi kam heute Morgen direkt aus dem Tennisclub zu mir und sagte mir, die Gestapo hätte Sie abgeholt. Wir hatten die Befürchtungen, die würden Sie unsanft behandeln. Also haben wir Major Schultz um Hilfe gebeten, und der hat die Sache Standartenführer Helms berichtet. Der war der Meinung, dass die Gestapo ihn erstens hätte fragen müssen, wenn sie sich an einem mit diplomatischer Immunität gesegneten ausländischen Soldaten vergreifen wollten, und zweitens, dass ein unnötiger diplomatischer Zwischenfall mit den Vereinigten Staaten zum jetzigen Zeitpunkt nicht wünschenswert ist. Standartenführer Helms hat sogar mit dem Reichsführer SS Himmler persönlich telefoniert, der auch angeordnet hat, Sie sofort auf freien Fuß zu setzen. Major Schultz hätte nur die Weisung des Herrn Reichsführers präsentieren brauchen, um Sie freizubekommen, aber er mag die Kerle von der Gestapo überhaupt nicht und spielt mit ihnen ein wenig Katz und Maus.“
„Woher wussten Sie, dass die mit mir in den Hafen fahren?“
„Ist die beliebteste Ecke in Hamburg, um jemanden unbemerkt um die Ecke zu bringen. Das Rotlichtviertel hier ist natürlicher Anziehungspunkt für nahezu jede Art von Kriminalität, auch wenn sich Polizei, Gestapo, SS und SA nach Kräften bemühen, dem arbeitsscheuen Gesindel hier den Garaus zu machen. Es ist wirklich unglaublich, was für Abschaum sich hier verbergen kann. Wenn es hier Tote gibt, würde niemand die Gestapo dahinter vermuten“, erklärte Kracht. „Und wenn es jemand täte, würde er von seinem Wissen nicht viel haben“, setzte er murmelnd hinzu. „Aber natürlich haben wir hier nicht einfach gewartet. Siggi hat Major Schultz ein Foto von Ihnen gegeben, und wir haben uns mit den Feldjägern auf die Strümpfe gemacht, um Sie gleich von der Innenbehörde abzuholen. Wenn Sie nicht gerade ‘rausgekommen wären und mit der Gestapo ins Auto gestiegen wären, hätten wir Sie aus der Amtsstube geholt. Siggi konnte leider nicht mit. Der Meyer von der Gestapo – der Sie im Tennisclub abgeholt hat und mit Ihnen jetzt im Wagen saß – hätte spätestens morgen den Siggi verhaftet, wenn er ihn gesehen hätte.“
„Zugegeben, mir hat das Herz in der Hose geklopft, als ich Sie und Ihre Feldjäger gesehen habe“, gestand Donovan. „Komisches Gefühl, von den Jungs gerettet zu werden, um die ein normaler Soldat sonst einen großen Bogen schlägt.“
„Kann ich mir denken, Herr Donovan. Was wollte die Gestapo eigentlich von Ihnen?“
Steve fragte sich einen Moment, ob er Kracht trauen konnte. Schließlich trug auch er den Adler mit dem Hakenkreuz auf der Brust und hatte geschworen, Adolf Hitler persönlich zu gehorchen. Andererseits gab es innerhalb der Reichsführung noch unterschiedliche Strömungen, wie mit Ausländern zu verfahren war. Sowohl die Gestapo als auch die SS waren unter Himmlers Kommando, aber es schien, als liefe dort noch nicht alles so, wie der Herr Reichsführer es sich vorstellte. Die Wehrmacht, zu deren Teilstreitkräften auch die Luftwaffe gehörte, unterstand nicht mehr einem Kriegsminister, sondern war direkt Adolf Hitler als dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht unterstellt. Gab es Unstimmigkeiten zwischen Hitler und seinem obersten Polizeichef? Oder gab es einfach nur in der Wehrmacht noch ein paar Leute, denen die Nazis mit ihren Parolen die Gehirne noch nicht vernebelt hatten? Siegfried Heinsohn war ein überzeugter Deutscher, nicht gerade ein Musterdemokrat. Er hing eher an Kaiser und Vaterland, als an der Idee einer Regierung vom Volk für das Volk durch das Volk; aber einer Ein-Parteien-Diktatur wie der der Nationalsozialisten konnte er auch nichts abgewinnen, wie Steve wusste. Siggi würde sich nicht mit Freunden umgeben, die seine politische Meinung nicht teilten. Dafür war in Deutschland die Gefahr zu groß, am nächsten Tag von der Gestapo abgeholt zu werden und mehr oder weniger auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden. Steve entschloss sich, Kracht zu vertrauen.
„Sie wollten von mir wissen, ob ich mit der Douhet-Theorie vertraut bin und ob sich die USA im Kriegsfalle auf diese Theorie einlassen würden. Ich war nicht willens diese Frage zu beantworten. Daraufhin hat man mir die seit einem halben Jahr beantragte Privatpilotenlizenz für das Deutsche Reich verweigert. Um weiterem Druck aus dem Weg zu gehen, habe ich meinen Antrag zurückgezogen – und dann haben sie mir mit Arrest gedroht“, erklärte der Amerikaner. Kracht nickte.
„So was hab’ ich mir gedacht. Es war die beste – nein, die einzige – Möglichkeit, Sie der Gestapo wegzuschnappen. Ich glaube nicht, dass Sie das Ende des Tages erlebt hätten. Wenn Sie einen persönlichen Rat von mir annehmen: Verschwinden Sie aus Deutschland, Herr Donovan. So schnell wie möglich! Wenn die Gestapo Sie erst im Visier hat, wird sie nichts unversucht lassen, Sie wieder in die Finger zu kriegen. Als nächstes könnten die versuchen, Ihnen Spionage anzuhängen“, warnte Kracht.
Wenig später hielt der LKW vor dem amerikanischen Konsulat in der Ferdinandstraße. Major Schultz bat um Erlaubnis, mit Leutnant Kracht zur sicheren Begleitung des Hauptmanns Donovan das exterritoriale Grundstück betreten zu dürfen und erhielt die Genehmigung. Die beiden Luftwaffenoffiziere begleiteten den Amerikaner ins Gebäude. Der Konsul kam ihnen schon im Treppenhaus entgegen.
„Guter Gott, Steve, wir haben uns große Sorgen gemacht, als Mr. Heinsohn zu mir kam und mir sagte, die Gestapo hätte Sie abgeholt. Was war denn bloß los?“, begrüßte der Konsul Donovan auf Englisch.
„Die Gestapo wollte von mir mehr wissen, als ich selber weiß. Zum Glück haben mir unsere Freunde von der deutschen Luftwaffe geholfen, Sir“, antwortete Donovan, ebenfalls Englisch.
„Hören Sie, Herr Konsul“, sprach Major Schultz den Konsul auf Deutsch an. „Herr Donovan ist in großer Gefahr und kann meines Erachtens nicht in Deutschland bleiben. Die Gestapo wird nicht locker lassen, bis sie ihn hat. Diesmal ist es mir noch gelungen, den Standartenführer Helms zu überzeugen, dass es politisch nicht sehr klug ist, sich an einem ausländischen Offizier im diplomatischen Dienst zu vergreifen. Bei nächster Gelegenheit könnte Herr Meyer von der Gestapo mehr Erfolg haben. Wenn er sich seine Aktion von Helms absegnen lässt, könnte niemand auf dieser Welt mehr etwas für Herrn Donovan tun.“
„Herr Major, Hauptmann Donovan steht unter diplomatischer Immunität!“, empörte sich der Konsul.
„Gewiss haben Sie Recht, Herr Konsul. Nur interessiert das die Gestapo nicht. Es wäre nicht unbedingt von Vorteil für Herrn Donovan, wenn auf seinem Grabstein stünde: Er stand unter diplomatischer Immunität, weil er dann leider ziemlich tot ist“, grinste der Major.
„Herr Konsul, Major Schultz hat Recht. Wer weiß, ob Standartenführer Helms sich nochmals die Gelegenheit entgehen lässt, für seine Regierung strategische Informationen zu sammeln“, fügte Siegfried Heinsohn hinzu.
Der Konsul überlegte noch, als das Telefon klingelte. Der Konsul nahm den Hörer ab.
„Hallo? Ja, am Apparat“, meldete er sich. „Einen Moment, ich gebe Ihnen den Major“, sagte er dann. „Für Sie, Major Schultz“, reichte er den Hörer weiter.
„Schultz!“, meldete sich der Luftwaffenoffizier. „Nein, Martens, geht nicht. Nein, rufen Sie das SS-Hauptquartier an und teilen Sie mit, wir hätten Hauptmann Donovan befehlsgemäß auf freien Fuß gesetzt und dass er sich bereits wieder im amerikanischen Generalkonsulat befindet und damit außerhalb unseres Zugriffs ist. Ja, sagen Sie das dem Bürochef von Standartenführer Helms. Ja, Ende.“
Schultz legte auf und sah die Amerikaner mit einem unglücklichen Blick an.
„Mensch, haben Sie Schwein, dass Sie schon hier sind, Donovan!“, entfuhr es dem Deutschen. „Eben bekommt mein Unteroffizier einen Anruf vom SS-Hauptquartier, dass Sie nicht freizulassen, sondern umgehend vorzuführen sind – unter Anklage der Spionage!“
Donovan und der Konsul schluckten hart.
„Dann hat Ihr Freund Meyer also Standartenführer Helms die Ohren vollgeheult, was man alles aus mir ‘raus pressen könnte, ja?“
„Ja, so könnte man es nennen. Machen Sie bloß, dass Sie wegkommen, Herr Donovan. Und noch was, Herr Donovan: So lange Sie noch in Deutschland sind, sollten Sie das Konsulat nicht mehr verlassen. Sofern Sie die Nase ‘raus stecken, hängt Ihnen sofort die Gestapo dran.“
„Danke für den Rat, Major Schultz. Ich rühre mich hier nicht mehr vom Fleck.“
„Dann empfehle ich mich. Heil Hitler!“, sagte Schultz und hob den rechten Arm zum deutschen Gruß.
„Auf Wiedersehen, Herr Major“, entließ ihn der Konsul mit leicht indigniertem Ton.
Die Luftwaffenoffiziere verließen das Haus und fuhren davon. Allein Siegfried Heinsohn war noch im Konsulat.
„Ja, dann werde ich mich jetzt besser verabschieden, bevor die Gestapo auch noch auf mich aufmerksam wird.“
„Das ist sie schon, wie mir Freund Meyer sagte. Mensch, Siggi – komm mit in die Staaten!“, bat Steve. Aber Heinsohn schüttelte den Kopf.
„Nein, ich bleibe hier. Deutschland ist mein Vaterland. Außerdem wäre es jetzt, nachdem ich eingezogen wurde, Fahnenflucht. Was darauf steht, muss ich dir als Berufssoldaten nicht erzählen, glaube ich. Mach’s gut, Steve“, sagte er und hielt Donovan die Hand hin.
„Nein, so gehen wir nicht auseinander, Siggi. Wir werden uns wieder sehen, wenn der Krieg, den euer Adolf gerade angezettelt hat, zu Ende ist.“
„Natürlich“, murmelte Heinsohn, aber es klang nicht überzeugt. Steve grinste und griff in seine Hosentasche, wo er sein Portemonnaie zu Tage förderte und eine Reichsbanknote im Wert von zehn Reichsmark herausnahm.
„Wir werden uns wieder sehen!“, sagte er, wedelte mit dem Schein und riss ihn in der Mitte durch. Die eine Hälfte gab er Siegfried.
„Wir werden uns wieder sehen und diesen Schein wieder flicken. Und dann wird kein Krieg sein und Adolf wird dieses Land nicht mehr regieren.“
Zögernd steckte Siegfried den halben Geldschein ein.
„Warum machst du das?“, fragte er. Steve grinste noch breiter.
„Mein Urgroßvater hat das auch schon mal gemacht. Er hatte einen guten Freund, den er auf West Point, unserer Militärakademie, kennen gelernt hatte. Sie waren kaum mit der Schule fertig, als der Bürgerkrieg ausbrach. Das Problem war nur, dass mein Urahn ein waschechter Yankee war und sein Kumpan hundertprozentiger Georgianer, also Südstaatler, war. Das änderte zwar an ihrer Freundschaft nichts, aber ihnen war klar, dass sie die Keilerei auf verschiedenen Seiten verbringen würden. Um deutlich zu machen, dass der Krieg an ihrer Freundschaft nichts änderte, zerriss mein Urahn eine Fünf-Dollar-Note, steckte sich die eine Hälfte in die Börse und gab die andere Hälfte seinem Freund. Und als der Krieg vier Jahre später zu Ende war, kam mein Urgroßvater als Besatzungssoldat nach Georgia und traf seinen Freund wieder. Sie haben die Banknote geflickt und mein Altvorderer hat seinem Kumpel über die Notzeiten der Rekonstruktionszeit geholfen. Klar?“
„Aber wir haben mit euch doch keinen Krieg“, wunderte sich Siegfried. Steve sah ihn mitleidig an.
„Ihr habt bis jetzt auch noch keinen Krieg mit England und Frankreich. Aber wenn Adolf nicht zurückrudert, habt ihr in drei Tagen mit denen Krieg. Im Weltkrieg waren wir auch drei Jahre lang neutral. Ich wage keine Prognosen, was diesmal geschieht. Nur so viel: Es gibt in den Staaten sehr viele Juden. Und die haben im Gegensatz zu deutschen Landen die vollen Bürgerrechte, sind teilweise verdammt vermögend und haben ‘ne Menge Einfluss in der Politik. Wenn Adolf euren jüdischen Mitbürgern noch schlimmer auf die Pelle rückt, könnte es sein, dass gewisse Lobbyisten entsprechenden Druck auf unseren Präsidenten ausüben, um ihren Glaubensgenossen hier in Europa zu helfen. Die nationalsozialistische Ideologie hat in der Welt nicht sehr viele Freunde“, warnte Steve.
„Du meinst die Sache mit den Rassegesetzen? Oh, Steve, auch in Deutschland wird nicht alles so heiß gegessen, wie’s gekocht wird. Wenn es wirklich ernst wird, werden auch die Parteibonzen zur Besinnung kommen und mit dem Blödsinn aufhören. Sie werden schnell merken, dass sie die Juden brauchen.“
„Ich beglückwünsche dich zu deinem Optimismus. Teilen tue ich ihn nicht. Ich hab’ mir die Reden von euren Regierungsmitgliedern angehört und habe mich hier umgesehen. Die Nazis haben die Juden als Sündenböcke ausgemacht. Ich für meinen Teil befürchte, sie werden es noch schlimmer treiben. Aber, was immer auch passiert, du hast den halben Schein. Kann sein, dass wir in einem halben Jahr schon wieder über den Krieg lachen, kann sein, dass es anders sein wird. Auch, wenn Deutschland und die USA sich irgendwann nur noch mit Waffengewalt unterhalten, sollte das unserer Freundschaft keinen Abbruch tun.“
Die Freunde umarmten sich.
„Mach’s gut. Wir … wir sehen uns dann“, sagte Siegfried mit belegter Stimme.
„Halt’ die Ohren steif und lass dich nicht vom Himmel pflücken“, erwiderte Donovan und klopfte Heinsohn aufmunternd auf den Rücken. Als er dem deutschen Piloten nachsah, als der vor dem Haus in ein Taxi stieg und wegfuhr, erwischte Steve sich dabei, dass er sich verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel wischte. Er hatte das ungute Gefühl, seinen deutschen Freund längere Zeit nicht zu sehen. Wie lange er ihn nicht sehen würde, ahnte er nicht im Geringsten.
Der Konsul, der die Freunde in dem Büro alleingelassen hatte, kam herein.
„Ich habe eben mit dem Außenministerium telefoniert. Sie bleiben erst mal hier im Konsulat. Wir warten zunächst ab, was die Ultimaten von England und Frankreich bewirken“, sagte er. „Der Minister hat mir erklärt, dass wir, falls es tatsächlich zu einer Kriegserklärung dieser beiden Staaten an das Deutsche Reich kommt, einen Teil unseres Konsularpersonals abziehen. Dann reisen Sie auf jeden Fall mit dem ersten Schub ab, Captain Donovan.“
Steve sah den Konsul an und nickte nur.
Die Ultimaten liefen am 3. September 1939 ab. Da sich der Großdeutsche Rundfunk hinsichtlich der Kriegserklärung Frankreichs und Englands bedeckt hielt und nur Meldungen vom schnellen Vormarsch der Wehrmacht in Polen verbreitete, wollte Donovan in den diplomatischen Vertretungen des Vereinigten Königreichs und der Republik Frankreich anrufen, die nicht weit entfernt an der Außenalster lagen. Doch statt der gewohnten Stimme der Telefonistin des französischen Konsulats meldete sich die deutsche Telefonauskunft.
„Telefonauskunft, Platz fünfundzwanzig. Welche Nummer haben Sie gewählt?“, fragte das Fräulein vom Amt. Steve nannte die Nummer.
„Das ist das französische Konsulat“, setzte er hinzu.
„Das Konsulat hat seine Tätigkeit eingestellt, nachdem die diplomatischen Beziehungen abgebrochen wurden. Für die Dauer des Kriegszustandes zwischen dem Deutschen Reich und der Republik Frankreich ist die Nummer nicht zu erreichen.“
„Danke. Auf Wiederhören.“
Steve legte auf und war im nächsten Moment zur Tür hinaus, um den Konsul zu informieren.
„Ich weiß“, sagte der Konsul. „Ich habe vor einer halben Stunde einen Anruf vom schweizerischen Konsul bekommen. Er hat die Tommys und die Franzosen gestern Abend zum Flughafen gebracht, nachdem die Anweisung bekommen haben, hier alles stehen und liegen zu lassen und hier zu verschwinden. Die diplomatischen Beziehungen wurden abgebrochen und die Konsulate in Hamburg geschlossen. Steve: Sie packen sofort Ihre Sachen. Sie fliegen nach Lissabon und fahren nach Hause!“
\
Kapitel 2
Flugstunden
Steve Donovan kam mit heiler Haut aus Deutschland heraus, als am 5. September das Personal des Konsulats deutlich reduziert wurde und insbesondere militärisches Personal abgezogen wurde. Die Gestapo hatte – obwohl sonst nicht schüchtern beim Festnehmen von tatsächlichen oder angeblichen Staatsfeinden – nicht gewagt, Steve zu verhaften. Die Gefangennahme eines Diplomaten, der ohnehin im Begriff war, das Land zu verlassen, hätte einen diplomatischen Skandal ausgelöst, an dem weder dem Minister für Propaganda, Dr. Goebbels, noch dem Außenminister, von Ribbentrop, etwas gelegen war. Schließlich war die Höchststrafe für einen der Spionage beschuldigten Diplomaten die Ausweisung.
Von Lissabon fuhr ein Passagierschiff nach New York, das der Dampfer sechs Tage später, also am 11. September 1939, erreichte. Gleich hinter der Zollabfertigung wartete ein Offizier der US Army mit einem Stabsabzeichen an der rechten Brusttasche der Uniform auf Captain Steve Donovan. Als Steve die Sperre hinter sich hatte, trat der Lieutenant auf ihn zu und salutierte.
„Captain Steve Donovan?“
„Der bin ich“, gab Steve zurück und erwiderte den Gruß des Lieutenants.
„Lieutenant Sam Masterson, US Army Air Corps, für sechs Monate zum Stab des Kriegsministers abkommandiert. Ich habe den Auftrag, Sie zum Minister zu begleiten, Sir. Darf ich Ihren Koffer nehmen, Sir?“
„Unnötig, Lieutenant. Ich habe nur dieses Reisetäschchen bei mir. Mit dem Rest meines Diplomatengepäcks, das ich nach Deutschland mal mitgenommen habe, wird sich vermutlich die Gestapo amüsieren“, erwiderte Steve mit leisem Seufzen.
„Besteht die Gefahr, dass die Krauts was entdecken?“, erkundigte sich der Lieutenant besorgt. Steve sah ihn schmunzelnd an.
„Ich bin sicher kein Geheimdienstprofi, Lieutenant Masterson, aber so blöd bin ich auch nicht, dass ich Unterlagen über meine Arbeit zu Hause lagere!“, versetzte er.
„Das, Sir, war die größte Sorge des Ministers.“
„Gut zu wissen, dass er mir so blind vertraut.“
Steves beißende Ironie verwirrte Masterson.
„Äh, darf ich bitten, Sir? Der Wagen wartet“, stotterte der junge Lieutenant. Sie verließen die Schiffsabfertigung und stiegen in einen vor dem Hauptportal wartenden Buick mit einem in Ausgehuniform steckenden Private als Fahrer. Der Wagen brachte Masterson und Donovan zum Bahnhof, wo sie in den Zug nach Washington stiegen.
Nach einer Nacht in einem Washingtoner Hotel in der Nähe des Kriegsministeriums mit einem für Steve inzwischen höchst ungewohnten Frühstück mit Pancakes, Bacon, kanadischem Ahornsirup, Muffins und Donuts holte Lieutenant Masterson Donovan ab und brachte ihn zum Ministerium.
„Sie brauchen nicht lange zu warten. Der Minister erwartet Sie bereits, Sir“, sagte Masterson und öffnete die Tür zum Büro des Ministers.
„Guten Morgen, Captain Donovan“, begrüßte ihn Minister Woodring. Steve salutierte.
„Guten Morgen, Mr. Secretary.“
„Schön, dass Sie wieder in den Staaten sind, Captain. Hatten Sie eine gute Reise?“
„Sieht man davon ab, dass der Aufbruch etwas hoppla hopp ging und ich außer dem, was ich an Notklamotten im Konsulat hatte, nichts mitnehmen konnte, und dass die Zollabfertigung in Hamburg vor dem Abflug nach Lissabon allein für meine Person geschlagene sechs Stunden gedauert hat, war es eine nette Reise. Danke der Nachfrage, Sir.“
„Nehmen Sie Platz, Captain. Ich habe Ihren Bericht, den Masterson mir gestern Abend noch gebracht hat, mit einigem Interesse gelesen. Sind die Nazis tatsächlich schon so dreist, diplomatisches Personal zu attackieren?“, fragte der Minister. Steve setzte sich und legte die Schirmmütze auf den kleinen Teetisch neben sich.
„Sollte das aus meinem Bericht so herauszulesen sein, muss ich das relativieren, Sir. Ich bin noch nicht gänzlich im diplomatischen Sprachgebrauch geübt, muss ich gestehen. Man hat mich nicht auf offener Straße angegriffen, falls Sie das so verstanden haben sollten, Sir.“
Der Minister schob die Brille auf die Nasenspitze herunter und sah in Steves Bericht.
„Ich lese aus Ihrem Bericht, dass man Sie in einem halböffentlichen Lokal von der Gestapo hat abholen lassen, dass man Sie im Gebäude der Innenbehörde einem Verhör unterzogen hat und von Ihnen wissen wollte, ob die Vereinigten Staaten Befürworter der Douhet-Theorie sind. Ich lese ferner heraus, dass Sie mithilfe der deutschen Luftwaffe aus dem Hut der Gestapo gezaubert worden sind und dass man Sie mit einer Schusswaffe der Marke Walther bedroht hat, Sie wegen Ihrer Weigerung, Auskunft zu geben, mit Arrest bedroht hat und Ihnen die Erteilung einer Privatpilotenlizenz verweigert hat, letzteres unter dem offiziellen Deckmantel der angeblichen Bewirtschaftung von Flugbenzin. Habe ich das so korrekt verstanden, Captain?“, zitierte der Minister.
„Vollkommen korrekt, Sir“, bestätigte Donovan.
„Und Sie meinen, das sei keine Attacke auf Ihren diplomatischen Status, Captain Donovan?“, fragte der Minister verwundert. Steve sah ihn offen an.
„Mr. Secretary, ich bin nicht zum Händeschütteln nach Deutschland geschickt worden, sondern, um unter dem Deckmantel der Diplomatie zu spionieren. Ich habe das so gut getan und getarnt, wie ich konnte, aber ich bin kein Geheimdienstspezialist. Es grenzt ohnehin an ein Wunder, dass mich die Gestapo nicht schon im April abgegriffen hat, als ich meine ersten Berichte abgeschickt habe.“
Der Minister sah Donovan über den Rand seiner Lesebrille an und spielte mit einem Bleistift.
„Das Verhör lief aber nicht in diese Richtung, oder?“
„Nein, aber die Gestapo braucht nicht unbedingt einen genannten Grund, um einen unliebsamen Zeitgenossen aus dem Weg zu räumen. Ich glaube, wir auch nicht, oder?“, grinste Steve.
„Captain!“, empörte sich der Minister.
„Sir, die Geheimdienste der verschiedenen US-Streitkräfte sind nicht zimperlich, wenn es darum geht, Spione zu liquidieren“, versetzte Donovan. „Ich hoffe, dass mein Fall nicht zu einem unnötigen diplomatischen Zwischenfall wird“, setzte er hinzu. Der Minister schüttelte den Kopf.
„Nein. Das ist nicht nötig, da man Sie nicht ausgewiesen oder körperlich geschädigt hat. Insofern können wir darüber hinweggehen. Wichtig ist für mich nur: Besteht die Gefahr, dass die Deutschen was spitzgekriegt haben?“
„Von meiner Spionagetätigkeit? In meiner Wohnung am Harvestehuder Weg habe ich keinerlei Material gehabt, weder Fotos noch schriftliche Unterlagen. Meine Berichte habe ich im Konsulatsbüro verfasst und keine Notizen in meiner Privatwohnung gehabt.“
„Umso besser. Trotzdem werde ich Sie nicht mehr nach Deutschland schicken – jedenfalls nicht als militärischen Botschafts- oder Konsulatsangehörigen. Wir werden die weitere Entwicklung abwarten. Es könnte sein, dass Sie in diplomatischem Auftrag nach London oder Paris geschickt werden. Einstweilen bleiben Sie im Lande. Zuletzt waren Sie Ausbilder in Groom Lake Air Base, Arizona, oder?“
Steve lächelte.
„Stimmt schon, Sir, aber nach den Vorschriften des Army Air Corps muss ich erst selbst wieder in die Ausbildung, weil ich keine Flugstunden nachweisen kann – bedingt dadurch, dass ich in Deutschland keine PPL bekommen habe.“
„Na schön. Nehmen Sie Ihre Pflichtstunden, Donovan. Soweit ich unterrichtet bin, sind Sie ein guter Pilot und werden bald wieder selber ausbilden. Wärmen Sie sich erst mal wieder auf. Ich werde das Konsulat anweisen, dass Sie Ihre Wohnungseinrichtung umgehend nachgeliefert bekommen.“
Wenige Tage später hatte Donovan ein Haus auf dem Gelände der Groom Lake Air Base in Arizona bezogen, hatte wieder ein Fahrzeug mit amerikanischem Kennzeichen – und nahm Flugstunden. Lieutenant Angelo D’Amato, ein ehemaliger Flugschüler von Donovan, genoss seine jetzt bevorzugte Stellung und ließ keine Gelegenheit aus, seinem früheren Lehrer das Leben schwer zu machen.
„D’Amato, ich habe schon Loopings geflogen, da haben Sie noch nicht mal gewusst, wie man das schreibt!“, schnaubte Steve, als der Lieutenant einen von Donovan geflogenen Looping kritisierte.
„Das mag sein, Captain. Aber jetzt bin ich der Fluglehrer – und ich bin mit Ihnen nicht zufrieden. Captain: Sie fliegen den Looping noch einmal! Und notfalls solange, bis er mir gefällt!“, versetzte D’Amato bissig. Donovan blieb nichts anderes übrig, als die Figur gehorsam nochmals zu fliegen. Als Flugschüler zählte sein höherer Dienstgrad nicht. Er hatte dem Fluglehrer zu gehorchen, mochte der auch ein rangniederer Offizier sein. Donovan flog den Looping abermals, wiederum war D’Amato unzufrieden. Steve hatte genug. Er flog nochmals hoch und hielt die Maschine im Kopfüberflug.
„Sie sollen einen Looping fliegen, Donovan!“, fauchte es von hinten durch den Flugwind. Steve drehte sich halb um. Lieutenant D’Amato hing in den Sicherheitsgurten und sah nicht glücklich aus.
„D’Amato, ich will Ihnen mal was sagen: Ich fliege seit sechs Jahren. Ich habe es nicht mehr nötig, mir von aerodynamischen Blindgängern wie Ihnen sagen zu lassen, wie man einen Looping fliegt. Wenn ich die Figur so fliegen würde, wie Sie es von mir verlangen, wären wir schon längst unten, aber etwas unplanmäßig! Ich habe es Ihnen schon gesagt, als ich Ihnen Flugunterricht gegeben habe, dass man den Looping nicht so fliegen kann, wie Sie meinen. Das führt unweigerlich zum Absturz! Ich beende diese Farce jetzt und lande“, fuhr Donovan ihn an.
„Dann will ich Ihnen mal zeigen, wie so was funktioniert! Ich übernehme!“, rief D’Amato und schaltete die vordere Steuerung aus, drehte die Maschine um, nahm Geschwindigkeit auf und steuerte in einen Looping hinein – allerdings mit dem Erfolg, dass die Maschine den Überschlag nicht schaffte und stattdessen in ein völlig unkontrolliertes Trudeln geriet. D’Amato versuchte, die Maschine abzufangen, aber es wollte ihm nicht gelingen.
„Verdammt! Ich kann sie nicht halten!“, schrie er.
„Als ob Sie schon mal ‘ne trudelnde Maschine abfangen konnten! Schalten Sie die vordere Steuerung wieder ein!“, befahl Steve. Mit einiger Mühe gelang es D’Amato, die Steuerung wieder umzuschalten. Steve spürte Widerstand in seinem Steuerknüppel und zog die Maschine in dem Moment wieder hoch, als er blauen Himmel über sich bemerkte. Die kleine Trainermaschine bockte wie ein Wildpferd, die stoffbespannten Doppelflügel ächzten, aber das Flugzeug kam wieder hoch. Der Andruck war so stark, dass beide Piloten kurzfristig das Bewusstsein verloren. Zu beider Glück hatte Donovan die Maschine soweit stabilisiert, dass sie auch ohne weitere Steuerungseinwirkung flog. An sich war die Trainermaschine ein gutmütiges Gerät, das viele Fehler verzieh und nur äußerst schwer aus der Ruhe zu bringen war, aber Lieutenant Angelo D’Amato vollbrachte das Kunststück immer wieder.
„Wo haben Sie eigentlich Ihren Fluglehrerschein geschossen, D’Amato?“, erkundigte sich Steve, als er nach einigen Sekunden wieder zu sich kam. D’Amato antwortete nicht. Donovan drehte sich um. Der Lieutenant hing reglos im Sitz. Steve drehte bei und steuerte die Landebahn des kleinen Flugplatzes an.
„Trainer 03 an Tower Groom Lake: Erbitte Landeerlaubnis“, funkte Donovan an den Tower.
„Tower an Trainer 03. Landebahn 2 ist frei. Landeerlaubnis erteilt“, kam die offizielle Genehmigung. „He, Angelo, was war’n das für ‘n abgewürgter Looping?“, fragte der Fluglotse dann weniger formell.
„Lieutenant D’Amato hat es einstweilen die Sprache verschlagen, Tower. Holt schon mal vorsorglich ‘nen Arzt. D’Amato ist zusammengeklappt. Trainer 03 Ende“, erwiderte Donovan.
Während die Trainermaschine noch im Landeanflug war, brauste ein Sanitätsfahrzeug zum Rollfeld. Donovan setzte auf und folgte dem gelb-schwarz karierten Einweiserfahrzeug zum Abstellplatz. Kaum stand der Propeller still, als schon vier oder fünf Männer des Bodenpersonals hinzu stürzten und den immer noch bewusstlosen D’Amato aus dem Cockpit hievten. Der inzwischen eingetroffene Arzt untersuchte den jungen Lieutenant sofort und ließ ihn mit Blaulicht ins Lazarett abtransportieren.
Ein Sergeant der Militärpolizei salutierte vor Donovan.
„Folgen Sie mir bitte sofort zur Unfallaufnahme, Captain!“
Das war keine höfliche Anfrage, das war ein unmissverständlicher Befehl, gegeben von jemandem, der es sichtlich genoss, auch als Unteroffizier gegenüber einem Offizier Vorgesetztenfunktion zu haben, der es nicht nötig hatte, einen Offizier mit Sir anzureden. Seufzend zog der Captain die Handschuhe aus und nahm die Fliegerkappe ab. Militärpolizisten konnte er in ihrer arroganten Art nicht ausstehen.
„Ja, ist gut“, sagte er und folgte dem Sergeant in die Baracke am Tower.
„Ihren Ausweis, Captain!“, forderte der Sergeant. Steve händigte ihm das Dokument aus und der Sergeant schrieb die Daten ab.
„Was ist vorgefallen?“, fragte der Sergeant kühl, nachdem er sich an seinen Schreibtisch gesetzt hatte und das Unfallaufnahmeprotokoll aus der Schublade geholt hatte. Donovan zog sich einen Stuhl heran und setzte sich, ohne auf das Angebot, Platz zu nehmen, zu warten. Der Sergeant hätte es doch nicht gemacht.
„Lieutenant D’Amato war mit meinem Looping nicht zufrieden, wollte ihn mir vormachen, machte eine halbe Schraube draus und verlor die Kontrolle über die Maschine. Ich habe ihn aufgefordert, meine Steuerung wieder einzuschalten, er hat es nach einiger Zeit getan und ich konnte die Maschine abfangen. Dabei hat es uns recht heftig in die Sitze gequetscht. Ich habe selbst kurz das Bewusstsein verloren, kam aber schnell wieder zu mir. Ich habe D’Amato angesprochen, aber er hat nicht reagiert. Daraufhin habe ich um Landeerlaubnis und um einen Arzt gebeten und bin gelandet“, erklärte Donovan.
„Hatte D’Amato schon häufiger solche Aussetzer?“, fragte der Sergeant weiter. Steve zuckte mit den Schultern.
„Mir nicht bekannt. Ich bin erst seit knappen sechs Wochen hier. In den letzten zwanzig Flugstunden, die Lieutenant D’Amato mir erteilt hat, ist so etwas nicht vorgekommen.“
Der Sergeant sah nochmals in die Papiere, die immerhin eine Fluglehrerlizenz beinhalteten, zog verblüfft eine Augenbraue hoch.
„Warum nehmen Sie Flugstunden?“, stellte er verwundert fest. „Sie sind doch Fluglehrer!“
„Das habe ich mich in den letzten Tagen bereits wiederholt gefragt, Sergeant. Aber auch ein Fluglehrer ist nicht immun gegen gewisse Vorschriften. Ich habe in Deutschland zu lange am Boden geklebt. Nun muss ich offiziell Nachhilfeunterricht nehmen.“
Der Militärpolizist nickte und machte seine Eintragungen.
„Danke, das wär’s fürs Erste, Captain. Halten Sie sich aber bitte zur Verfügung, falls noch Nachfragen notwendig sein sollten.“
„Ja, natürlich“, gab Steve zurück und verließ die Polizeibaracke.
Er fuhr sofort ins Lazarett, um sich nach dem Zustand des Lieutenants zu erkundigen.
„Dr. Stone, ich möchte zu Lieutenant D’Amato“, sprach der Captain den diensthabenden Arzt an. Dr. Milton Stone, der Chefarzt, schüttelte den Kopf.
„Sie können nicht zu Lieutenant D’Amato. Er ist noch nicht wieder aufgewacht“, wehrte er ab.
„Doc, was ist mit Lieutenant D’Amato?“, erkundigte sich Donovan.
„Soweit wir das bisher feststellen konnten, hat sich in seinem Gehirn ein Blutgerinnsel gebildet. Wir versuchen herauszufinden, ob wir das medikamentös behandeln können oder ob eine Operation notwendig ist.“
„Wird er wieder?“, hakte Steve nach. Dr. Stone zuckte mit den Schultern.
„Im Moment ist das schwer zu sagen, Captain. Es kann sein, dass ein Teil des Hirns bleibende Schäden behält. Möglicherweise wird er teilweise bewegungsunfähig bleiben, vielleicht auch Störungen im Sprach- oder Denkapparat haben“, erwiderte er. „Wie ist es eigentlich zu dem Unfall gekommen?“, erkundigte sich der Mediziner dann. Steve berichtete kurz. Dr. Stone nickte verstehend.
„Wie hoch würden Sie den Andruck schätzen?“, hakte er nach.
„So fünf, sechs G bestimmt, Doc.“
„Na, das erklärt alles!“, entfuhr es Stone.
„Warum?“
„Nun, Lieutenant D’Amato hat ziemlich hohen Blutdruck, um nicht zu hohen zu sagen. Deshalb hat er ausdrückliches Kunstflugverbot, bis die Medikamente anschlagen, die ich ihm verordnet habe. Sagen Sie: Wie viele Loopings sind Sie geflogen?“
„Ich selber drei und einen ist er geflogen, weil er mir die Figur korrekt vorfliegen wollte. Mit meinen Versuchen war er nicht zufrieden.“
„Holla, seit wann nehmen Sie Unterricht bei D’Amato? Sie bilden doch selbst aus, Captain?“
„Ich habe ausgebildet, Doc. Nach einem halben Jahr Bodenkleben im Großdeutschen Reich hat sich’s leider ausgeflogen“, erwiderte Donovan seufzend.
„D’Amato hatte seine Flugkünste von Ihnen, oder?“
„So ist’s“, bestätigte Steve.
„Er hat mir mal gesagt, er sei ein großer Bewunderer Ihrer Flugkünste und wünsche sich nichts mehr, als so fliegen zu können wie Sie. Und er hat mir gesagt, Sie seien ein Perfektionist, der seine Schüler eine Figur so lange fliegen lässt, bis sie sie entweder gefressen haben oder bis sie gekotzt haben. Trifft das eigentlich zu?“
„So drastisch würde ich es nicht ausdrücken, Doc“, lächelte Steve. „Aber viele dieser Kunstflugfiguren können lebensrettend sein, wenn man als Jagdpilot dem Gegner entwischen will. Deshalb lege ich großen Wert darauf, dass meine Schüler diese Figuren im Schlaf beherrschen. Aber das heißt nicht, dass ich sie bis zum gefressen haben oder gekotzt haben fliegen lasse. Da der Fluglehrer hinten sitzt, ist mir jedenfalls Letzteres zu eklig.“
Der Arzt nickte.
„Hoffen wir das Beste“, sagte er leise.
„Bitte, Doc, benachrichtigen Sie mich, wenn sich bei D’Amato was verändert.“
„Ja, natürlich.“
Mit dem Ausfall D’Amatos erließ der Stützpunktkommandant, Colonel Worsley, Steve die restlichen Flugstunden. Es war ohnehin ersichtlich, dass Donovan von dem Lieutenant nichts lernen konnte – er war einfach der bessere Pilot.
„Sie werden wieder ausbilden, Captain, bis wir Sie nach London schicken“, eröffnete ihm Worsley, als Donovan sich nach einem Anruf seines Chefs bei ihm meldete.
„Sir, wenn ich bemerken dürfte …“
Worsley nickte.
„Sir, zum einen ist Ausbildung ist nur die halbe Miete, wenn ich nicht sicher sein kann, einen Kurs von A bis Z behalten kann. Es hat wenig Wert – besonders für die Kadetten – wenn das Lehrpersonal ständig wechselt. Und zum anderen würde ich gern – wenn es möglich ist – nach Hawaii versetzt werden“, sagte Steve.
Der Colonel überlegte eine Weile.
„Nun, mit Ihrem ersten Einwand könnten Sie Recht haben. Gut ausgebildete Piloten sind sehr wichtig“, sagte er schließlich. „Aber den zweiten Wunsch werde ich Ihnen kaum erfüllen können, wenn Sie nicht zum Seetangschlucker werden wollen. Auf Oahu gibt es zwar außer den Flugplätzen der Navy auch welche des Army Air Corps, aber General Short und Colonel Farthing haben derzeit keine freien Kapazitäten. Nur bei der Navy besteht auf Hawaii derzeit Bedarf. Haben Sie Gründe für einen Wechsel nach Hawaii?“
„Nun, meine drei Brüder sind alle dort stationiert. Sid, der Älteste ist Lieutenant-Commander bei der Navy, die beiden Jüngeren, Mark und Jake, sind bei den Marines. Und außerdem lebt meine Mutter dort.“
„Oh je, Seetangschlucker!“, seufzte Worsley. „Wie halten Sie das bloß aus?“
„Familiär“, grinste Steve. „Für meine Brüder bin ich die elende Landratte mit Flügeln. Aber es ist meine Familie. Und seit mein Vater verstorben ist, hängt meine Mutter um so mehr an ihren Söhnen.“
„Die einzige Chance, als Offizier nach Hawaii zu kommen, wäre ein Wechsel zur Infanterie, zur Navy oder zu den Marines, Captain. Aber ich glaube nicht, dass Ihnen Fußmärsche und schwankende Planken liegen, oder sehe ich das falsch? Bisher war ich der Meinung, Sie hätten so etwas wie eine Mischung aus Flugbenzin und Schmieröl in den Adern.“
„Ist auch so. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als an den Boden genagelt zu sein.“
„Dann, Captain, sollten Sie sich das mit der Versetzung nach Hawaii wirklich überlegen. Die Navy würde Sie erst mal ein paar Monate auf ein Schiff setzen. Und eins kann ich Ihnen sagen: Auf einem Flugzeugträger landen, Donovan, das ist nichts für Landrattenflieger wie uns.“
\
Kapitel 3
Pilotennachwuchs
Steve nahm seine Lehrtätigkeit für das Army Air Corps wieder auf. Am Dienstag, den 31. Oktober 1939, einen Tag nachdem Colonel Worsley ihn von weiteren Flugstunden befreit hatte, betrat Donovan zum ersten Mal den Unterrichtsraum, der nun für mindestens zwei Jahre sein hauptsächlicher Arbeitsplatz sein sollte – abgesehen von den notwendigen Flügen, die er machen musste, um seine Fluglizenz zu erhalten. Kaum hatte er den Fuß in den Raum gesetzt, als eine befehlsgewohnte Stimme bellte:
„Aaachtung! Ein Offizier ist anwesend!“
Die Kadetten sprangen eilig auf und nahmen Haltung an, ebenso wie der Sergeant, der so Achtung gebietend den Befehl gegeben hatte. Steve ging zum Lehrerpult und legte seine Mütze ab.
„Guten Morgen, meine Herren. Nehmen Sie Platz“, grüßte er freundlich. Der Sergeant sah seine Kadetten strafend an.
„Guten Morgen, Sir!“, brüllten dreißig Stimmen wie aus einem Munde.
„Jungs, ich bin nicht taub“, wehrte Donovan ab. „Okay, setzt euch endlich hin.“
Der Sergeant machte eine zackige Kehrtwendung und wollte gerade zum Befehl ansetzen, als Donovan ihn stoppte:
„Sergeant, ich denke, die Herren haben Ohren am Kopf. Die Formalausbildung ist doch abgeschlossen, oder?“
Wieder eine exakte Kehrtwendung.
„Ja, Sir!“, brüllte der Sergeant.
„Sergeant, ich sagte bereits, dass ich gut hören kann. Sie brauchen nicht so zu brüllen. Sind Sie als Schüler oder als Kindermädchen im Kurs?“, entgegnete Donovan mit einem schon nur noch mühsam beherrschten Grinsen.”
„Als Ausbilder, Sir!“
„Oh, dann bin hier wohl falsch? Mir war so, als sollte ich die Herren Kadetten unterrichten.“
„Man hat mich Ihnen als Unterstützung zugeordnet, Sir. Lieutenant Ashford, Ihr Vorgänger in diesem Kurs, Sir, legte auch großen Wert auf meine Anwesenheit.“
„Danke, Sergeant. Wenn ich Ihre Unterstützung benötige, komme ich gern auf Sie zurück. Einstweilen setzen Sie sich bitte hin.“
Mit einer eckigen Bewegung setzte sich der Sergeant auf den Stuhl, der vorn an der Tür stand. Er saß damit seitlich zum Auditorium und zum Lehroffizier. Steve hatte das unbestimmte Gefühl, dass man ihm nicht zutraute, dreißig junge Männer im Zaum zu halten, die sich freiwillig für den Dienst am Vaterland entschieden hatten.
„Gut. Ich bin Captain Steven Donovan, United States Army Air Corps, und ich habe den Auftrag, Ihnen zunächst Militärtheorie beizubringen. Wir werden uns also in der nächsten Zeit mit allen möglichen militärischen Theorien befassen, die zur Kriegführung in der Luft entwickelt worden sind. Außerdem wird ein Teil von Ihnen bei mir Flugunterricht bekommen. Colonel Worsley hat mir mitgeteilt, dass Ihr Kurs sowohl von Lieutenant D’Amato als auch von Captain Malcolm am Flugzeug unterrichtet wurde. Da Lieutenant D’Amato mindestens einige Zeit ausfallen wird, übernehme ich seinen Fluglehrgang bis auf weiteres“, stellte Steve sich vor. „Mir liegt daran, Sie mit Namen zu kennen. Schreiben Sie mir Ihre Namen und Dienstgrade in Ihrer jetzigen Sitzordnung auf das Blatt Papier, das ich Ihnen herum gebe.“
Er gab dem Kadetten vorne links in der Reihe ein Blatt kariertes Papier, der seinen Namen und Dienstgrad notierte und es dem Nachbarn weiterreichte. Wenig später hatte Steve das Blatt zurück. Oben, in der letzten Reihe sah er zwei schelmisch grinsende Gesichter und sah auf das Blatt. Dort, wo die jungen Männer saßen, standen Namen, die offensichtlich nicht die ihren waren. Steve behielt das Blatt in der Hand und ging durch die Reihen der erwartungsvoll blickenden Kadetten nach oben, scheinbar ohne bestimmtes Ziel. In der letzten Reihe blieb er schließlich stehen.
„Was an Halloween so alles möglich ist, ist schon erstaunlich. Da stehen sogar die Toten wieder auf“, sagte Steve in Anspielung auf diesen Tag, den 31. Oktober, an dem in den angelsächsischen Ländern am Vorabend von Allerheiligen rechter Schabernack getrieben wurde und sich die Leute als Geister, Hexen oder gar Teufel verkleideten.
„Meine Herren, wir haben in diesem Saal offenbar zwei medizinische Wunder. Grandios! Erlauben Sie, dass ich Ihnen die Saalmethusalems vorstelle: Hier zu meiner Linken sitzt unser aller, nunmehr hundertjähriger General George Armstrong Custer. Herzlichen Glückwunsch zum hundertsten Geburtstag, Sir. Ich dachte immer, dass bei Skalpierten nichts mehr auf dem Haupte wächst!“, sagte er dann laut und wuschelte dem Kadetten über das kurzgeschorene Haar. Die übrigen Kadetten lachten laut.
„Und zu meiner Rechten – Donnerwetter, auch nicht übel, sogar hundertundacht Jahre – Lieutenant-General Philip Sheridan. Noch ‘ne Menge Fleisch an dem Gerüst, das seit 1888 modert. Wirklich, gut gehalten, Sir.“
Wieder hallte eine Lachsalve durch den Raum. Die beiden Spaßvögel wurde rot, lachten aber tapfer mit.
„Also, dann werden uns ab jetzt die Custermumie und die Sheridanmumie in diesem Kurs begleiten. Haben wir noch ‘nen Admiral Nelson oder einen General Washington dabei? Nein? Schade“, grinste Steve. „Jungs, wie immer euer Name sein mag, ihr seid von jetzt an Custermumie und Sheridanmumie. Und wehe, ihr stellt euch je anders vor.“
Steves Kadetten des Jahrgangs 37/4 waren meist schon privat mit Flugzeugen beschäftigt gewesen, hatten jetzt bereits zwei Jahre Flugunterricht, so dass Donovans Aufgabe im Wesentlichen die Lehre militärischer Eigenheiten war. Die jungen Männer seiner Lehreinheit waren zu seiner Freude an den Lehren interessiert – auch die beiden Spaßvögel Custermumie und Sheridanmumie, die eigentlich Winston Bellamy und Jonathan Coffer hießen.
„Sir, ich habe eine Frage“, meldete sich Kadett Winston Bellamy in einer Theoriestunde zu Wort.
„Fragen Sie, Kadett Bellamy“, forderte Donovan ihn auf. Bellamy wies auf die Karte, an der Donovan mit Nadeln die Positionen französischer und deutscher Flugplätze in Europa markiert hatte.
„Sir, wenn es zutreffend ist, dass nach der Theorie von Douhet ein strategisches Bombardement, bei dem speziell auch zivile Ziele einbezogen werden, kriegsentscheidend sein kann – warum weichen die Krauts dann von dieser Linie ab? Wäre es für sie nicht einfacher, die Franzosen erst in Grund und Boden zu bomben und erst dann ihre Panzer in Marsch zu setzen?“
„Das wäre vermutlich eine Möglichkeit. Es setzt aber voraus, dass die deutsche Führung die Luftwaffe auch strategisch einsetzt. Im Feldzug gegen Polen wurde die Luftwaffe ausschließlich taktisch zur Unterstützung der Bodenstreitkräfte eingesetzt“, antwortete Steve.
„Aber warum setzt man die Luftwaffe nicht auch strategisch ein?“, hakte Bellamy nach. Donovan lächelte.
„Die Frage sollten Sie Mr. Göring stellen, Kadett. Oder Mr. Hitler. Die werden Ihnen das wahrscheinlich beantworten können.“
„Aber wenn das so ein Riesenvorteil darstellt, dann ist es doch dumm von den Krauts, wenn sie den nicht nutzen“, bemerkte Bellamys Nachbar, Kadett Jonathan Coffer.
„Kadett Coffer, es kommt immer darauf an, wie die Grundtendenz der Einsatzplanung einer Luftstreitmacht ist. Die deutsche Luftwaffe ist grundsätzlich taktisch ausgerichtet. Sie sind die zurzeit besten Schlachtflieger, die uns bekannt sind.“
„Aber was war mit Guernica? Das war doch ein strategischer Angriff!“, protestierte Coffer.
Donovan legte das Kreidestück weg und putzte sich die Finger.
„Guernica, Kadett Coffer, Guernica – das war weder taktisch noch strategisch. Guernica war nach meiner Auffassung ein reiner Terrorangriff“, sagte er dann langsam und betont. „Ein Terrorangriff, der ausschließlich dazu dienen sollte, unter den Gegnern der spanischen Nationalisten Angst und Schrecken zu verbreiten.“
„Aber es war ein Flächenbombardement, so wie Douhet es in seiner Theorie vertritt“, beharrte Coffer.
„Unzweifelhaft“, bestätigte Donovan. „Aber hatte es tatsächlich eine strategische Wirkung?“
„Nun, Sir, Francos Truppen haben mithilfe der deutschen Legion Condor die Republikaner wohl geschlagen, oder nicht?“, erwiderte Coffer.
„Erinnern Sie sich, wann der Angriff auf Guernica war?“
„Nach unserem Buch am 26. April 1937, Sir.“
„Haben die republikanischen Truppen unmittelbar danach kapituliert?“
„Nein, erst in diesem Jahr, Sir.“
„Meinen Sie, dass ein strategischer Angriff seine Wirkung erst zwei Jahre nach seiner Durchführung entfalten sollte?“
„Äh, eigentlich nicht, Sir“, räumte Coffer ein.
„Gut. Damit ist also klar, dass ein strategischer Angriff allein kein strategischer Angriff im Sinne der Douhet-Theorie sein kann. Bleibt es also bei einem solchen Angriff, der ausschließlich gegen zivile Ziele gerichtet ist, dann ist es purer Terror, aber keine militärische Strategie“, erklärte Steve. Die jungen Männer sahen sich betroffen an. Einen Moment war es völlig still.
„Würde praktisch gesehen heißen, dass wenn über einen längeren Zeitraum solche Angriffe erfolgen, deren einzelner immer nur ein Terrorangriff wäre, dass es sich dann plötzlich in eine zulässige militärische Strategie verwandelt?“, fragte Bellamy betroffen nach.
„Es gibt Dinge am Soldatendasein, die einen hin und wieder würgen lassen. Dies ist so ein Ding, das nicht nur meinen Magen rebellieren lässt. Es ist allerdings so. Wenn Sie einen Mann über den Haufen schießen, weil er Ihnen ein paar Tage zuvor auf die Füße getreten ist, wird man es vermutlich Mord nennen. Machen Sie das in staatlich führender Funktion mit ein paar hundert oder tausend Männern in verschiedenfarbigen Uniformen und kündigen das auch noch an, wird daraus Krieg – und plötzlich ist der, der den anderen ohne zu fragen umnietet, der große Held. Und ich möchte, dass ihr nie vergesst, dass in den Städten, die man euch zu bombardieren befiehlt, Menschen leben – nicht Nazis, nicht Kommunisten, Japse oder was man sonst noch als verabscheuungswürdig betrachtet – Menschen, Jungs. Ich würde mir allerdings auch wünschen, dass sich denen, die euch diese Befehle irgendwann einmal geben, ebenso der Fleck umdreht wie euch. Als Flieger haben wir nur einen einzigen Vorteil vor dem Infanteristen oder Panzerfahrer: Wir geraten nicht sehr schnell in die Verlegenheit, die direkten Folgen unseres militärischen Tuns mit eigenen Augen zu sehen, die Schreie der Menschen mit eigenen Ohren zu hören. Aus einer Angriffshöhe von mehr als zehntausend Fuß sieht eine bombardierte Stadt wie der Sandkasten im großen Auditorium aus – man nimmt es nicht als real wahr. Und genau deshalb will ich, dass ihr euch jedes Mal klar macht, dass dort unten unter euren Bombern Menschen wie verrückt vor Angst in die Keller rennen. Dass es vermutlich mehr Frauen und Kinder als wehrfähige Männer sind. Das ist kein Spiel, Jungs!“
„Äh, Sir – ist es denn wirklich möglich, sich mit so einer Vorstellung an den Steuerknüppel eines Bombers zu setzen?“
Donovan sah in die Runde der betroffen wirkenden Kadetten.
„Jungs, ich will euch ganz ehrlich was sagen: Ich bin Jagdflieger. Als Jagdflieger ist es mein Job, anderen Jagdfliegern Feuer unter dem Hintern zu machen oder Bomberverbände abzuwehren. Ich habe es dabei mit Leuten zu tun, die sich vermutlich ihrer Haut zu wehren wissen. Das halte ich jedenfalls für eine ehrenhafte Art, zu kämpfen. Einen Bomber würde ich persönlich freiwillig nur dann fliegen, wenn es um die Zerstörung militärisch wichtiger Einrichtungen geht – also militärische Stützpunkte, Luftbasen, Häfen, feindliche Stellungen, auch kriegswichtige Industrien. Krankenhäuser, Schulen und zivile Wohnbezirke gehören für mich nicht dazu. Ich selbst halte es für Feigheit in Dosen, sich an wehrlosen Zivilisten zu vergreifen – gleich, ob es ein Infanterist ist, der schwer bewaffnet in ein Haus eindringt und dort um sich schießt, obwohl erkennbar ist, dass sich nur Frauen und Kinder im Hause aufhalten oder ob es ein Flieger ist, der gezielt und bewusst seine Bomben in ein ausschließlich von Zivilisten bewohntes Gebiet wirft. Gewiss gibt es den Einwand, dass es ganz einfach ist, militärische Ziele in zivilen Bezirken – sagen wir – zu verstecken. Dem stimme ich zu und bin der Ansicht, dass in einem solchen Fall dann nach anderen Lösungen gesucht werden muss, um das fragliche Ziel zu zerstören. Ich gebe zu, dass ich persönlich ein echtes Problem hätte, wenn man mir befehlen würde, mich an den Steuerknüppel eines Bombers zu setzen, dessen Ziel ein ziviler Wohnbezirk irgendwo auf dieser Welt wäre. Das, Jungs, ist meine ganz persönliche Auffassung, nicht die offizielle Lehrmeinung, die ich hier wiederzugeben habe. Offiziell ist es meine Aufgabe, euch zu sagen, dass Befehl Befehl ist, den ein Soldat zu befolgen und nicht zu hinterfragen hat. Es gibt allerdings Situationen, in denen auch ein Soldat einen Befehl verweigern muss: Nämlich dann, wenn das ihm befohlene Tun als Kriegsverbrechen zu betrachten ist“, erklärte Steve.
Kadett Bellamy meldete sich.
„Bellamy?“
„Sir, wann ist das befohlene Tun ein Kriegsverbrechen?“
„An sich war unser heutiges Thema die Douhet-Theorie. Aber da sich daran die Geister scheiden und das Problem dabei aufgetaucht ist, können wir auch einen kleinen Exkurs in Sachen Befehl und Gehorsam machen. Im Prinzip ist alles, was gegen die Haager Landkriegsordnung von 1907 und die Genfer Konvention zum Schutze der Kriegsgefangenen verstößt, ein Kriegsverbrechen“, antwortete der Lehrer.
„Aber nach der Haager Landkriegsordnung dürfen zivile Ziele nicht angegriffen werden, Sir!“, erwiderte Bellamy.
„Sehen Sie, genau darin liegt das Dilemma eines Soldaten. Sie bekommen den Befehl, einen zivilen Wohnbezirk zu bombardieren. Führen Sie den Befehl aus, kann es sein, dass man Sie eines Tages dafür als Kriegsverbrecher anklagt – nämlich dann, wenn die andere Seite den Krieg gewinnt oder Sie in Gefangenschaft der anderen Seite geraten. Auf Kriegsverbrechen steht zurzeit in nahezu allen Staaten dieser Welt die Todesstrafe. Als verurteilter Kriegsverbrecher sind Sie also wahrscheinlich recht schnell ziemlich tot. Tun Sie es nicht, haben Sie ein Kriegsgerichtsverfahren wegen Befehlsverweigerung am Hals, das Sie mit Pauken und Trompeten verlieren; Sie wandern vielleicht ein paar Jahre hinter Gitter oder in die Strafeinheit und werden wahrscheinlich irgendwann unehrenhaft entlassen. Nur mit viel Glück wird man Sie eines Tages vielleicht rehabilitieren. Also: Was Sie auch tun, irgendwer wird es als falsch einstufen und versuchen, Sie dafür zur Verantwortung zu ziehen. Helfen kann Ihnen da nur Ihr eigenes Gewissen.“
„Also handeln nach dem Gewissen, Sir? Aber das heißt doch, den Befehl eben doch zu hinterfragen“, warf Coffer vorlaut in die Runde.
„Sie wissen, dass das, was Sie tun, auf jeden Fall für eine beteiligte Seite falsch ist. Dran sind Sie folglich immer. Wenn man betrachtet, dass die eine Sache – Verurteilung als Kriegsverbrecher – vielleicht und die andere – Verfahren wegen Befehlsverweigerung – ganz bestimmt eintritt, dann wird sich vermutlich der größte Teil von Ihnen für die Befolgung des Befehls entscheiden. Wenn Sie Ärger mit Vorgesetzten vermeiden wollen, werden Sie jeden Befehl ausführen, den man Ihnen gibt. Ist Ihnen Ärger und Kameradenschelte egal, werden Sie mal in sich hineinhorchen. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen.“
„Entschuldigen Sie, Sir, wenn ich noch mal nachfragen muss: Habe ich nun das Recht, einen Befehl zu hinterfragen oder nicht“, hakte Coffer nach.
„Das Recht haben Sie nicht, Kadett“, antwortete Steve. „Ich kann mir denken, dass das für Sie jetzt verwirrend ist, obwohl wir als Soldaten doch gerade die klare Linie haben wollen und sollen. Die klare Linie ist: Sie bekommen einen Befehl und Sie führen ihn aus, ohne Fragen zu stellen. Die nicht ganz klare Linie ist: Was sagt Ihre innere Stimme dazu? Es wird immer Befehle geben, die jeder ohne Widerspruch ausführen würde. Wenn Ihnen der Vorgesetzte befiehlt, sich in ein Flugboot zu setzen, um abgeschossene Kameraden aus dem Meer zu fischen, wird unter Ihnen wohl niemand sein, der sich dagegen sträuben wird. Befiehlt man Ihnen, gefälligst Ihre Stube aufzuräumen oder widrigenfalls drei Tage in den Bau zu gehen, werden Sie auch kaum nach Alternativen suchen wollen. Aber wenn Ihnen jemand den Befehl gibt, einen Kameraden zu verprügeln, werden Sie hoffentlich fragen, warum Sie ihn eigentlich verhauen sollen. Es gibt dann Vorgesetzte, die zur Antwort geben: Weil ich das sage, Kadett! Das ist die eine Variante. Die andere, hoffentlich eher angewandte, wird eine vernünftige Begründung sein, wobei mir momentan keine gescheite Begründung dafür einfällt, einen Kameraden zu vertobaken. Ich garantiere Ihnen, dass Sie bei gewissen Vorgesetzten schon Ärger haben, wenn Sie nach der Begründung eines Befehls fragen. Andere Vorgesetzte werden Ihnen einen Befehl ohne zu murren begründen. Aber das, meine Herren, sind Erfahrungen, die Sie letztlich selbst machen müssen.“
Er machte eine kurze Pause.
„Sie selbst, meine Herren, werden irgendwann selbst Vorgesetzte sein. Sie werden Untergebene haben, denen Sie Befehle erteilen dürfen und müssen. Sie werden sich – wie jeder Offizier oder sonstige Vorgesetzte – darauf verlassen wollen und auch müssen, dass man Ihren Befehlen nachkommt. Ich selber halte viel davon, dass der Vorgesetzte den Befehl, den er seinem Untergebenen gibt, begründen kann – und zwar mit vernünftigen Gründen und nicht nur mit seinem Willen. Gehorsamsproben – etwa jemanden dazu zu zwingen, bei Frost in der Unterhose im Freien zu stehen, nur um zu testen, ob er widerspruchslos gehorcht – halte ich für absolut dummes Zeug. Wenn Sie Ihren Untergebenen Befehle geben, die Sie Ihnen vernünftig begründet auseinandersetzen, werden Sie so einen Blödsinn auch nicht nötig haben.“
Kadett Emerson Murray, ein junger Mann, der eher nachdenklich war und häufig sehr lange brauchte, bis er abgewogen hatte, meldete sich.
„Murray?“, forderte Donovan ihn zum Sprechen auf.
„Sir, es ist sicher richtig, dass ein Vorgesetzter seinen Befehl begründen können muss. Aber … habe ich immer die Zeit, meinem Untergebenen zu erklären, warum er bestimmte Dinge tun soll? Ich meine, es gibt doch Situationen, in denen von einer schnellen Reaktion auf einen Befehl Leben abhängen kann.“
„Ja, natürlich, das haben Sie richtig erkannt, Kadett. Klar können Sie Ihrem Flügelmann im Luftkampf keine langen Erklärungen geben, warum er jetzt bitte nach rechts oder links fliegen soll, um Ihnen einen Angreifer vom Hals zu halten. In einer Kampfsituation ist ein augenblickliches Gehorchen Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Ausgang. Das mag auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen, ist es aber nicht. In der Regel werden Sie Ihre Leute nicht erst dann kennenlernen, wenn Sie auf deren sofortige Reaktion angewiesen sind, sprich also in einer Kampfsituation. Normalerweise werden Sie Ihre Untergebenen bereits aus dem Dienstalltag kennen und mit Ihnen Trainingsflüge veranstalten, in denen Sie genau das üben können. Wenn Sie sich als vorgesetzter Offizier im normalen Dienstalltag und auf den Trainingsflügen vernünftig verhalten und Ihren Leuten von vornherein sagen, warum Sie bestimmte Dinge in bestimmten Situationen tun sollen, werden die das kapieren, und Sie werden im Ernstfall auch keine Probleme mit dem Befolgen Ihrer Befehle haben. Außerdem haben Sie dann noch den Vorteil, dass Sie eventuelle Ausfälle besser auffangen können. Wenn Ihre Männer nämlich mitdenken, sind sie auch fähig, in bestimmten Situationen allein zu entscheiden. Das sollte Sie jetzt als angehende Offiziere nicht erschrecken, meine Herren. Stellen Sie sich die Situation vor, dass Sie Staffelführer sind und leider das Pech haben, selber aus dem Kampf auszuscheiden. Die Sache soll ja aber nicht verloren sein, nur, weil gerade Sie ausfallen. Also muss jemand anders an Ihre Stelle treten – also Ihr Stellvertreter oder ein anderer aus der Staffel. Wenn Sie aber immer nur bestimmte Flugmanöver befohlen haben, ohne dass der betreffende Pilot wusste, weshalb er sich so und nicht anders verhalten soll, dann wird er nicht selbstständig handeln können, was er aber genau in diesem Moment müsste. Und genau deshalb kann ich Sie nur dazu ermutigen, sich mit Ihren Leuten zu befassen, sie gut kennen zu lernen, zu wissen, was Sie von jedem in Ihrem Haufen zu halten haben. Wenn Sie Ihre Männer kennen und Ihre Männer wissen, was sie an Ihnen haben, dann ist Gehorsam wahrscheinlich das Geringste Ihrer Probleme.“
„Sir, könnten wir übrigen fünfzehn, die bei Captain Malcolm Flugunterricht haben, nicht zu Ihnen wechseln?“, fragte Bellamy, der nicht zu Steves Anteil an Flugschülern im Kurs gehörte. „Captain Malcolm befiehlt nämlich immer nur bestimmte Flugfiguren, sagt uns aber nicht, wozu sie gut sein sollen.“
„Kadett, für diese Frage sollten Sie sich zunächst an Captain Malcolm wenden und ihm sagen, dass Sie gerne wüssten, warum Sie bestimmte Flugfiguren benutzen sollen. Wenn er Ihnen die Antwort schuldig bleibt, sollten Sie sich an den Schuldirektor wenden und ihm vortragen, dass Sie zu blindem Gehorsam erzogen werden sollen und nicht zum führungsfähigen Offizier“, empfahl Donovan. Bellamy nickte, seufzte aber leise. Er hatte Befürchtungen, von Malcolm angeschnauzt zu werden.
„Mr. Bellamy, Custermumie, Ihr Seufzen war eben nicht zu überhören. Sicher bedeutet diese Frage an Captain Malcolm einen Konflikt. Zum Soldat sein gehört auch Tapferkeit. Beweisen Sie sich Ihre Tapferkeit selbst, indem Sie einem Konflikt mit einem Vorgesetzten nicht ausweichen. Sie lösen den Konflikt nicht, indem Sie brav schlucken.“
„Danke, Sir, ich werden es mir merken“, erwiderte Bellamy. Steve lächelte.
„Gut, Exkurs beendet, kommen wir wieder zur Douhet-Theorie zurück …“
Donovan hatte den Kurs Militärtheorie Ende Oktober übernommen. Bis Mitte Dezember hatte er die bestehenden Defizite, die Lieutenant Ashford im theoretischen und Lieutenant D’Amato im praktischen Bereich hinterlassen hatten, ausgeglichen. Eine Woche vor Weihnachten endete das Trimester, Kadetten und Lehrpersonal hatten drei Wochen Zeit, sich voneinander zu erholen. Steve wollte die Gelegenheit nutzen, Urlaub zu beantragen und seinen Bruder Sid in Washington zu besuchen, der zurzeit zum Marineministerium abkommandiert war. Gemeinsam wollten die Brüder dann nach Pensacola weiterreisen, dort ihren jüngsten Bruder Jake abholen und nach Oahu fliegen, wo ihre Mutter und Bruder Mark auf sie warteten, um Weihnachten im Familienkreis zu verbringen. Doch es kam anders …
\
Kapitel 4
Ende und Anfang
In Europa hatte im Spätherbst 1939 Ruhe die Front ergriffen. Polen war besiegt, Frankreich und Deutschland lieferten sich nach wie vor eine Art Sitzkrieg am Rhein, der die Franzosen an die Unbezwingbarkeit der Maginot-Linie glauben ließ. Dass die deutsche Armeeführung den Angriff auf Frankreich nur verschoben hatte, konnte die französische Regierung nicht glauben. Großbritannien hatte zwar bereits gut 150.000 Mann Bodentruppen und 10.000 Mann der Royal Air Force nach Frankreich verlegt, doch beschränkte Großbritannien seine Aktivitäten zunächst im Wesentlichen darauf, die deutsche Flotte im Atlantik zu jagen, und hielt sich – wie Frankreich – in der Luft und am Boden aber noch vornehm zurück.
Ein kurzer Hoffnungsschimmer für die Welt zerplatzte am 8. November, als ein Attentat auf Hitler im Münchner Bürgerbräukeller fehlschlug. Zwar versuchte die deutsche Propaganda diese Tat des Deutschen Georg Elser dem britischen Secret Service unterzuschieben, weil Elser als Einzeltäter für Propagandazwecke und die beschworene Vorsehung, die den Führer gerettet hatte, schlicht uninteressant war, doch zu einer Ausweitung der Kampfhandlungen im Westen kam es nicht.
Zudem versuchten sowohl der belgische als auch der rumänische König und die niederländische Königin einen Verständigungsfrieden zwischen Deutschland und den Westalliierten zu vermitteln, doch lehnten beide Seiten ab. Die Briten und die Franzosen, weil Deutschland keine Zugeständnisse hinsichtlich Polens machen wollte; Deutschland, weil Hitler von einem Sieg in einem Westfeldzug überzeugt war. Zwar hatte er gerade zwei Tage zuvor den bereits gegebenen Angriffsbefehl widerrufen, aber nur, weil er den Westfeldzug nur bei gutem Wetter beginnen wollte; nicht etwa, weil er das Vorhaben als solches aufgegeben hatte.
Die Amerikaner interessierte das Kriegsgeschehen in Europa nicht sonderlich. Man war neutral und hatte mit den Problemen der Europäer nichts zu tun. Dann jedoch, Mitte Dezember 1939, kam der Krieg so nahe an den amerikanischen Kontinent heran, dass sich sogar nord- und südamerikanische Zeitungen und Radiosender dafür interessierten.
Am frühen Morgen des 13. Dezember 1939 sichtete der Ausguck des britischen leichten Kreuzers Ajax Rauch am Horizont. Commodore Harwood, Chef eines Verbandes, der aus den leichten Kreuzern Ajax und Achilles und dem schweren Kreuzer Exeter bestand, entsandte die Exeter zu näherer Erkundung. Die Besatzung der Exeter stellte schnell fest, dass es sich um eines der von den Briten pocket-battle-ships genannten neuen deutschen Panzerschiffe handelte, von denen es hieß, sie seien stärker als die Schnelleren und schneller als die Stärkeren.
Nur wenige Minuten später eröffnete die Exeter das Feuer auf das deutsche Panzerschiff. Es war die Admiral Graf Spee, jenes deutsche Schiff, das seit gut zwei Monaten die britische Marine in Atem hielt und einen überaus erfolgreichen Handelskrieg führte.
Knapp eineinhalb Stunden später musste die Exeter schwer beschädigt abdrehen, auch die Achilles wurde beschädigt und konnte wegen einer zerstörten Funkantenne nicht mehr richtig manövrieren. Achilles und Ajax nebelten sich ein und mussten das deutsche Panzerschiff entkommen lassen. Kapitän zur See Langsdorff, Kommandant der Admiral Graf Spee, entschloss sich zur Flucht nach Westen, in der Hoffnung, in den Weiten des Südatlantiks wieder zu verschwinden und sein ebenfalls schlimm beschädigtes Schiff in Montevideo im neutralen Uruguay reparieren zu können.
Achilles und Ajax folgten der Admiral Graf Spee in sicherer Entfernung außerhalb der vernichtenden Artillerie des deutschen Panzerschiffes. Commodore Harwood hatte den Vorteil, dass die Admiral Graf Spee in Richtung Westen fuhr, bei Sonnenuntergang also noch lange gegen den Horizont sichtbar sein würde. Tatsächlich lief das deutsche Schiff den neutralen Hafen an. Die britischen Kreuzer legten sich vor der Mündung des La Plata auf die Lauer und warteten, dass das in der Falle sitzende deutsche Panzerschiff wiederkäme.
Britische und französische Diplomaten setzten die uruguayische Regierung unter Druck, die Kapitän Langsdorff eine Frist von nur 72 Stunden für eine Notreparatur des Schiffes ließ. Beim Überschreiten dieser Frist drohte Schiff und Mannschaft die Internierung bis zum Ende der Feindseligkeiten zwischen Deutschland und Großbritannien. Langsdorff war sich bewusst, dass er sein Schiff in dieser Zeit allenfalls fahrfähig machen konnte, nicht aber kampftüchtig. Innerhalb dieser 72 Stunden liefen in Montevideo mehr Menschen zusammen, als diese Stadt jemals zuvor gesehen hatte. Jeder wollte den unausweichlichen Showdown zwischen der Admiral Graf Spee und den britischen Kreuzern sehen. Dann verbreitete sich auch noch das Gerücht, dass der britische Flugzeugträger Ark Royal und das Schlachtschiff Renown draußen vor der Mündung des La Plata warteten.
Gegen die ebenfalls beschädigten und nicht mehr hundertprozentig einsatzfähigen Kreuzer wäre das besser bewaffnete Panzerschiff nicht chancenlos gewesen – aber an einem Flugzeugträger und einem richtigen Schlachtschiff hätte die Admiral Graf Spee allenfalls unter Wasser vorbeifahren können. Kapitän Langsdorff erhielt die Erlaubnis zur Selbstversenkung, falls ein Durchbruch nicht möglich sein sollte. Langsdorff war klar, dass ein Schusswechsel mit den vermuteten Gegnern einem Selbstmordversuch gleichkam. Er entschloss sich zur zweiten Alternative, ohne die erste auszuprobieren.
So fuhr das deutsche Panzerschiff am 17. Dezember 1939 um 19.52 Uhr noch von vierzig Mann besetzt in die La-Plata-Mündung hinaus. Kapitän und Mannschaft verließen das Schiff in Booten und kehrten nach Montevideo zurück. Eine ungeheure Explosion zerriss den Abendhimmel über Montevideo und Buenos Aires, und die Admiral Graf Spee war nur noch ein brennendes Wrack. Drei Tage darauf erschoss sich Kapitän zur See Hans Langsdorff in seinem Hotelzimmer in Buenos Aires.
Eine Ironie des Schicksals wollte es, dass das Panzerschiff Admiral Graf Spee seinem Namensgeber praktisch gefolgt war. Im Weltkrieg, genauer am 8. Dezember 1914 – fast auf den Tag genau 25 Jahre zuvor, so vermerkten es die Zeitungen –, war Admiral Maximilian Graf von Spee mit seinem Schiff Scharnhorst vor den Falklandinseln im Kampf gegen ein britisches Geschwader untergegangen. So ruhte der Mann, nach dem das Schiff benannt war, am südlichen Ende Argentiniens in seinem nassen Grab, während das Schiff, das seinen Namen trug, am nördlichen Rand des südamerikanischen Staates versank.
Diese Ereignisse waren es sogar US-amerikanischen Zeitungen und Radiosendern wert, darüber zu berichten, obwohl der Krieg sonst sehr weit weg war.
Steve hatte die Berichte in der Zeitung wohl gelesen, sie aber nicht weiter beachtet, weil er keine unmittelbare Notwendigkeit sah, sich mit diesem für ihn an sich unwichtigen Thema zu befassen. Er packte seinen Urlaubskoffer, ließ sich zum Zivilflughafen nach Phoenix bringen und flog nach Washington. Mit der DC 4 der Pan American Airways dauerte der Flug fast quer über den Kontinent noch knapp fünf Stunden.
Als Sid ihn am Flughafen in Washington abholte, war Steve sichtlich verblüfft, dass sein Bruder in Uniform war.
„Hoppla, was ist das?“, fragte er mit Hinweis auf die schwarze Winteruniform. Sid zuckte mit den Schultern.
„Ich habe noch keinen Urlaub bekommen, also darf ich Washington noch im Navy-Päckchen schmücken“, erwiderte er.
„Irgendwas schiefgegangen?“
„Weiß ich noch nicht. Der Navy-Geheimdienst hat Wind davon bekommen, dass die Tommys ein deutsches Panzerschiff im Südatlantik jagen.“
„Die jagen nicht nur eins, die haben eins gestellt, wie ich gelesen habe. Aber was geht uns das an? Wir sind doch neutral?“, erkundigte sich Steve, als sie in Sids Chevrolet den Flughafenbereich verließen und zu dessen Wohnung in Washington-Georgetown fuhren.
„Im Prinzip stimmt das. Aber wir haben uns im Weltkrieg auch nicht ganz heraushalten können. Deshalb passen wir schon auf, was sich da im Atlantik tut. Immerhin ist es fast vor unserer Haustür. Und eine zweite Lusitania brauchen wir nicht“, erklärte Sid.
Bei ihm zu Hause angekommen, hatte Steve seinen Koffer gerade ausgepackt, als das Telefon klingelte.
„Hallo?“, meldete sich Sid.
„Hallo, Lieutenant-Commander. Hier ist Commodore Winter vom Geheimdienst der US Navy. Ich habe einen Sonderauftrag für Sie. Kommen Sie bitte gleich ins Marineministerium“, hörte Sid.
„Darf ich fragen, um was für eine Sonderaufgabe es sich handelt, Sir?“, erkundigte er sich.
„Nein, am Telefon kann Ihnen das nicht sagen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass Sie ziemlich weit fliegen müssen.“
„Frage am, Rande, Sir: haben Sie jemanden, der mich fliegen kann? Ich bin kein Pilot.“
„Nein, im Moment noch nicht“, gab Winter zu.
„Haben Sie was dagegen, wenn ich meinen Bruder mitbringe? Er ist Army-Pilot und eben gerade in Washington angekommen.
„Vertrauenswürdig?“
„Ja.“
„Okay, bringen Sie ihn mit.“
„Danke, Sir, bis gleich“, sagte Sid und legte auf.
„Es könnte sein, dass ich deine brüderlich-dienstliche Hilfe brauche“, wandte er sich dann an Steve.
„Und wozu?“
„Commodore Winter will mich auf eine Sondermission schicken. Bisher weiß ich nur, dass ich weit fliegen muss.“
„Und da brauchst du mich als Taxiflieger? Habt ihr nicht ‘ne eigene Fliegerabteilung?“
„Schon, aber da habe ich keinen Bruder, jedenfalls noch nicht“, grinste Sid. „Komm mit.“
Die Donovans fuhren ins Marineministerium am Potomac. Sid, der hier nun seit einigen Monaten arbeitete, wusste auch, wo er Commodore Winter finden konnte.
„Danke, dass Sie gleich gekommen sind, Gentlemen“, bedankte sich der Commodore, als sich die Brüder vorschriftsmäßig bei ihm meldeten. Steve hatte vorsichtshalber seine Uniform angezogen, da es um einen dienstlichen Termin ging.
„Commander, ich habe eben eine Nachricht bekommen, für deren Recherche Sie in Frage kommen“, setzte Winter an.
„Worum geht es, Sir?“
„Die britische Navy hatte vor drei Tagen ein Gefecht mit dem deutschen Panzerschiff Admiral Graf Spee. Die Graf Spee konnte sich beschädigt nach Montevideo retten, musste den Hafen aber gestern Abend verlassen. Die Krauts haben den Tommys aber eine lange Nase gedreht und – statt sich auf einen Kampf einzulassen, den sie nicht gewinnen konnten –, den Kahn lieber selbst versenkt. Dummerweise ist das Wrack aber nicht gesunken, sondern liegt fast auf ebenem Kiel in der Mündung des La Plata – nun, dumm jedenfalls für die Krauts. Für uns umso besser. Hinzu kommt, dass die Tommys als Kriegsgegner Deutschlands das Wrack nicht offiziell untersuchen dürfen. Der britische Premier hat sich deshalb an Mr. Roosevelt gewandt und uns um Hilfe gebeten. Wir helfen den Tommys – wenngleich ich annehme, dass der MI 6 eigene Leute heimlich auf die Graf Spee ansetzen wird“, erklärte Winter. „Sie, Lieutenant-Commander, wurden mir als Experte für Funkmesstechnik empfohlen. Die Deutschen haben eine ganze Menge interessanter Antennen am Mast. Ich möchte, dass Sie die untersuchen“, erklärte der Commodore. Sid nickte.
„Aye, Sir.“
„Wir möchten nicht, dass die Angelegenheit zu große Kreise zieht. Ihr Auftrag gilt deshalb als geheim“, setzte Winter fort. Er sah Steve an. „Auch für den Fall, dass Sie als Pilot nicht in Frage kämen, sind Sie zu absolutem Stillschweigen verpflichtet, Captain. Haben Sie verstanden?“, wandte Winter sich an Steve.
„Ja, Sir“, bestätigte der.
„Sir, wann soll ich nach Montevideo fliegen?“, fragte Sid.
„Am besten sofort. Wie schnell können Sie starten, Captain Donovan?“
„Sofern mir eine Maschine zur Verfügung gestellt wird, sie betankt und gecheckt ist und ich entsprechend ausgeliehen werde, mein Urlaub also erst einmal unterbrochen wird. Wollen Sie sich mit dem Kriegsminister Woodring in Verbindung setzen oder darf ich mir von meinem Einheitskommandanten die Genehmigung einholen?“
„Das macht meine Dienststelle für Sie. Können Sie ein mehrsitziges Flugzeug fliegen?“
„Ja, Sir, meine Pilotenlizenz umfasst auch mehrmotorige Maschinen.“
„Gut. Sie könnten natürlich auch mit einer ganz normalen Linienmaschine fliegen, aber im Interesse der Geheimhaltung ist es besser, wenn wir ein eigenes Flugzeug einsetzen. Wir können ein Catalina-Flugboot einsetzen.“
„Gut, Sir. Ich mache nur auf folgendes aufmerksam: Die Catalina ist mit einer Höchstgeschwindigkeit von 154 Knoten* relativ langsam und hat eine eher beschränkte Reichweite von knapp 2.700 nautischen Meilen. Wenn ich es überschlägig rechne, müssten wir in Guantánamo und Cuzco oder Belém zwischenlanden – vorausgesetzt, das Flugboot gehört zu den Exemplaren mit Fahrgestell. Ansonsten kommt ohnehin nur Belém in Frage. Dort muss ich im Amazonasdelta ‘runtergehen und kann nur beten, dass ich einen Platz zum Tanken finde. Ferner ist da die reine Entfernung, die, wenn ich mich nicht verkalkuliere, etwa eine Flugzeit von rund 42 Stunden erfordert. Hinzu kommt, dass auch nach den verschärften Dienstvorschriften von Army und Navy ein Pilot diese Zeit nicht am Stück fliegen darf. Wir müssen in Cuzco oder Belém übernachten. Im Gegensatz zu Guantánamo Bay, das eine Navy-Basis ist, sind die anderen Plätze öffentliche Flughäfen, noch dazu in Südamerika, wo einem eher Hühner und Schafe über die Startbahn laufen, als dass man einen Einweiser zu sehen bekommt. Wenn die Sache erstens geheim und zweitens eilig ist, könnten wir zu spät kommen, Sir“, warnte Steve.
„Sie meinen, es wäre unauffälliger, wenn Sie mit einer normalen Linienmaschine fliegen? Im Prinzip gebe ich Ihnen Recht, Captain. Ich hatte aber daran gedacht, dass Sie eventuell etwas ausbauen und bergen könnten. Sie sind dann mit einem Flugboot der Navy besser bedient, weil Sie neben dem Wrack wassern können. Ich fürchte, die Urus lassen uns das Wrack zwar untersuchen, aber ob Sie dann Souvenirs mitnehmen können, wäre mit zivilem Gepäck erstens mindestens fraglich – rein zolltechnisch gesehen – und außerdem verdammt schwer“, gab Commodore Winter zu bedenken.
„Den Gesichtspunkt hatte ich nicht bedacht, Sir“, räumte Steve ein. Winter nickte.
„Insofern schlage ich vor, Sie nehmen das Flugboot.“
„Ein Flugboot hat acht Mann Besatzung, Sir. Was ist mit denen?“
„Wenn mich die Leute von der Navy Air Force nicht angeschwindelt haben, benötigt die Maschine den Piloten, den Navigator, den Funker und den Bordingenieur als unbedingt erforderliche Mannschaft. Lieutenant Chamberlain, ein Offizier meines Stabes, ist Flugingenieur und Petty Officer Jackson ist Funker beim Geheimdienst der Navy. Diese beiden werden Sie begleiten.“
Ein Wagen des Departments of the Navy brachte die Donovans zum Washington Naval Yard. An einer der Piers lag das Catalina Flugboot. Lieutenant Junior Grade Harvey Chamberlain erwartete die Brüder bereits.
„Guten Tag, Sirs. Cathy ist randvoll getankt. Bis Guantánamo schafft sie’s spielend.“
\
Nachwort zum 1. Buch
Diese beiden letzten Kapitel haben bei euch hoffentlich nicht den Eindruck hinterlassen, ich würde Ursache und Wirkung verwechseln und Deutsche nun zu den schuldlosen Opfern erklären. Nein, das ist absolut nicht meine Absicht!
Ich möchte eines ganz deutlich sagen: Es waren Deutsche, die den II. Weltkrieg angezettelt haben; es waren Deutsche, die völlig zu Recht als Kriegsverbrecher bezeichnet, gesucht und verurteilt wurden. Es kann überhaupt keinen Zweifel geben, dass der von Hitler bewusst geplante Vernichtungskrieg ein ungeheures Verbrechen war, das durch nichts zu rechtfertigen war und ist.
Ich denke aber, es kommt immer darauf an, in welcher Eigenschaft eine Person einen Krieg erlebt. Unter diesem Aspekt waren alle Zivilisten in allen Ländern, in denen der Krieg tobte, Opfer, unabhängig von der Frage ihrer Nationalität.
Während ich für dieses Buch recherchiert habe, habe ich sehr viel Sachliteratur zum II. Weltkrieg gelesen, eine Menge TV-Dokumentationen gesehen und persönliche Erzählungen meiner Familie gehört. Für sehr empfehlenswert halte ich die Bücher von Janusz Piekalkiewicz, der sich wirklich darauf beschränkt, Tatsachen darzustellen und Wertungen in jeglicher Form zu vermeiden.
Gerade die Sachbücher von Piekalkiewicz ergeben, dass es auf beiden Seiten Täter und Opfer gegeben hat – und dass insbesondere Frauen und Kinder für das, was über sie hereinbrach absolut gar nichts konnten, egal, ob sie Polen, Russen, Deutsche, Briten, Franzosen oder Angehörige anderer kriegführender Nationen waren.
\
Anhang I
Schriftwechsel
Constantine, Algerien, den 16. Februar 1943
Liebste Harriet,
nun bin ich in Afrika angekommen, aber ich habe – Du magst es glauben oder nicht – Sehnsucht nach England. Nicht nur, weil das Wetter hier ebenso miserabel ist wie in England (das vergeht in den nächsten Tagen, hoffe ich), sondern weil Du dort geblieben bist. Du fehlst mir, und das wird nicht vergehen, denn Du bist nicht hier. Ich kann mich nicht eben in den Zug setzen und nach Saint Eval fahren, um Dich zu besuchen, wenn ich keine Einsätze fliegen muss. Du bist verdammt weit weg!
Es tut mir Leid, dass es zwischen uns ein Missverständnis gegeben hat, und ich möchte es ausräumen.
Harriet, ich bin nicht freiwillig in Afrika. Ich suche weder meine Freiheit, noch Abenteuer – schon gar nicht mit anderen Frauen, falls Du das befürchten solltest. Ich bin durch eine Strafversetzung hierhergekommen, die Group Captain Henderson erzwungen hat. Es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, Dich ausgerechnet jetzt allein zu lassen; in einem Moment, der für Dich gefährlich ist, weil unser Tun Folgen haben kann und wir (noch) nicht verheiratet sind. Deine Angst verstehe ich, sogar Deine Wut kann ich verstehen. Ich kann mir denken, dass Du glaubst, ich würde Dich jetzt einfach sitzenlassen.
Genau das will ich aber nicht. Ich stehe zu dem, was ich gesagt und getan habe. Und ich stehe auch zu den Folgen, die das haben kann. Was immer auch geschieht, Du wirst keinen Nachteil davon haben. Für den Fall, dass mir etwas passieren sollte, habe ich bei Colonel Sam Bennett (Du erreichst ihn über meine alte Einheit in Maidenfield) mein Testament hinterlassen. Du wirst Dich darin als meine Frau wiederfinden. Sollte das, was wir getan haben, Folgen haben, bestätige ich Dir schon jetzt, dass das Kind unseres ist. Ich erkenne es an, mit allen Rechten und Pflichten, und ich nenne es ehelich. Mir ist klar, welches Gerede eine Schwangerschaft ohne einen Ehemann nach sich zieht. Berufe Dich auf Gretna Green, mein Liebling. So habe ich es hinterlassen, falls ich nicht lebend zurückkomme.
Ich liebe Dich, Harriet, und ich wünsche mir, bald wieder bei Dir in England zu sein. Mag das Wetter bei Dir zu Hause sein, wie es will, durch Dich ist selbst der verregnetste Tag voller Sonnenschein.
In Liebe
Steve
***
Constantine, Algerien, 18. März 1943
Liebste Harriet,
leider habe ich von Dir noch nichts gehört. Ich vermute hoffentlich richtig, dass Du entweder nicht dazu gekommen bist, mir zu schreiben oder dass mein erster Brief Dich bisher noch gar nicht erreicht hat. Dass Du mir derart böse bist, dass Du meinen Brief gleich als Anzünder für den Kamin benutzt hast, mag ich nicht annehmen.
Ich liebe Dich. Daran hat sich nichts geändert. Und ich sehne mich nach Dir. Auch daran hat sich nichts geändert.
Afrika ist – wenigstens in diesem Jahr – keineswegs das, was sich ein normaler Amerikaner wie ich unter Afrika vorstellt. Ich habe immer geglaubt, in der Wüste hier wäre es ebenso heiß wie bei mir zu Hause in Arizona. Fehlanzeige. Das englische Mistwetter (entschuldige, aber das normale englische Wetter ist für Nichtbriten wirklich nicht der Kronschatz des Königs!) hat mich wahrhaftig bis hier verfolgt. Ob das eine Strafe Gottes ist? Wenn ja, frage ich mich wofür eigentlich. Wohl kaum dafür, dass ich Dich liebe und keinen größeren Wunsch habe, als Dich wiederzusehen und Dich offiziell mit staatlicher Erlaubnis zu heiraten (Stichwort Gretna Green, mein Schatz!). Bevor ich abgeflogen bin, habe ich Sam gebeten, mir eine offizielle Heiratserlaubnis zu besorgen. Von dem habe ich zwar auch nichts gehört, aber ich denke, dass die Genehmigung inzwischen vorliegen müsste, auch wenn es bei Strafversetzten Schwierigkeiten geben soll.
Auch mein jetziger Vorgesetzter mag kein gutes Haar an mir lassen und meint, ich hätte einen allgemeinen Befehl zur Bekämpfung feindlicher Truppen missachtet – weil ich bei Dunkelheit nicht auf eine unsichtbare Truppe geschossen habe, die vielleicht (sic!) feindlich war! Was der wohl angestellt hätte, hätte ich bei Dunkelheit auf eine amerikanische Panzerkolonne geschossen? Ob er mich wohl hätte hängen lassen?
Eben gerade hatte ich aber Besuch von einem Staatsanwalt (ja, schon wieder!). Der scheint vernünftig zu sein und ich habe das Gefühl, er meint es ehrlich, wenn er sagt, dass er das Verfahren ohne Zicken einstellen lassen will. Er will sogar erreichen, dass meine Strafversetzung und die Degradierung zurückgenommen werden.
Zugegeben: Es klingt noch recht fantastisch, aber ich könnte bald wieder bei Dir sein. Noch will ich nicht in großen Jubel ausbrechen, weil die Enttäuschung umso größer wäre, wenn es doch nicht klappt, wenn er an seinen Vorgesetzten scheitert.
Ich bete, dass er es schafft und dass ich wieder zurück zu Dir kann. Ich liebe Dich.
In Liebe
Steve
***
Constantine, Algerien, 20. März 1943
Liebste Harriet,
die Nachricht, die ich eben bekommen habe, hat mich fast umgehauen! Seit heute bin ich wieder Captain, und für das, was ich hier getan habe, habe ich den Silver Star bekommen! Aber das Schönste ist: Ich darf nach England zurück – bald bin ich wieder bei Dir, mein Liebling. Zwar weiß ich den genauen Zeitpunkt noch nicht, aber lange kann es nicht mehr sein. Es ist nur noch davon abhängig, wann die Blue Eagles so umgestaltet worden sind, dass ein Platz für mich da ist.
Was eine Antwort von Dir betrifft: Ich versuche es weiter und mag nicht glauben, dass Du mich einfach abgeschrieben hast. Ich liebe Dich. Wenn Du noch einen Funken Gefühl für mich hast, gib Dir einen Stoß und antworte mir, bitte.
Willst Du mich heiraten?
Mir genügt ein einfaches Ja oder ein harsches Nein, nur hätte ich für ein Nein gern eine Begründung.
Nichts von dem, was ich zu Dir gesagt habe, nehme ich zurück. Es war nicht gespielt, um Dich zu verführen. Bitte, glaube mir wenigstens das.
Ich vermisse Dich. Bitte, Liebling, reiß’ Dir ein paar Zeilen aus dem Herzen.
In Liebe
Steve
***
Saint Eval, 02. April 1943
Mein Liebling,
bitte vergib mir, dass ich Dir jetzt erst schreibe.
Ich will nichts beschönigen: Deine Briefe habe ich jetzt eben erst gelesen. Ich war so wütend auf Dich, dass Du einfach nach Afrika verschwunden bist und mich hier allein gelassen hast.
Hätte ich Dich nur ausreden lassen! Jetzt bin ich mir sicher, dass Du mir von Deiner Strafversetzung am Telefon erzählen wolltest. Es tut mir so Leid, dass ich Dir einfach das Wort abgeschnitten habe. Es tut mir Leid, dass ich Dir misstraut habe und Dich für einen Windhund gehalten habe.
Du fehlst mir so! Heute war ich bei „unserer“ Höhle in Richtung Trevose Head. Dort habe ich endlich Zeit gefunden, über alles nachzudenken. Hier war es schrecklich hektisch in den letzten Wochen, seit Du nach Constantine geschickt wurdest. Ich habe vor Dir geträumt, Darling, von der wunderschönen Zeit, die wir dort verbracht haben.
Du wolltest eine Antwort haben. Sie lautet
Ja! Schlicht und einfach JA!
Ich will Deine Frau werden – lieber heute als morgen oder übermorgen!
Hoffentlich geht es Dir gut. Sei bitte vorsichtig, Steve. Ich möchte Dich gern bald gesund wiedersehen. Hast Du schon Nachricht, wann Du zurückkommst?
Ich liebe Dich.
Harriet
***
&
12th United States Army Air Force
7th Fighter Group “Desert Eagles” Headquarter
Constantine, Algeria
Miss
Harriet Collins
93 West Park Road
Maidenfield
Kent/England
G r o ß b r i t a n n i e n
Constantine, 07.April 1943
Sehr geehrte Miss Collins,
Ref.: Persönliche Sachen von Captain Steven C. Donovan, 7th Fighter Group “Desert Eagles”
Anbei erhalten Sie die persönlichen Sachen von Captain Steve Donovan.
Captain Donovan wurde heute Nachmittag bei einem Einsatz so schwer verwundet, dass eine Behandlung hier in Constantine oder an einem anderen Ort in Nordafrika unmöglich war. Er wurde heute Nacht nach Großbritannien ausgeflogen. Nach meinen Informationen soll er in Edinburgh behandelt werden. Leider habe ich keine nähere Information, in welches der Edinburgher Lazarette er eingeliefert wird.
Dr. Lafitte, der erstbehandelnde Arzt im Feldlazarett von Tebessa, musste mir mitteilen, dass Captain Donovans Verwundungen akut lebensbedrohend sind. Es stand nicht gut um ihn, als er heute Nacht ausgeflogen wurde.
Ich bete für ihn. Captain Donovan hat die Freie Welt tapfer mit seinem Leben verteidigt.
Ihr ergebener
Roger Hartwig
Lieutenant-Colonel, Kommandeur 7th Fighter Group “Desert Eagles”
***
Anhang II
Glossar
In der vorliegenden Geschichte gibt es vermutlich eine ganze Reihe von Ausdrücken, die nicht jedem geläufig sind. Deshalb biete ich ein Glossar als kleinen Leserservice an. Das Glossar habe ich in einen allgemeinen Teil und einen militärischen Teil getrennt. Der militärische Teil ist noch um eine Sonderliste für militärische Dienstgrade erweitert, weil insbesondere die Dienstgrade der britischen Royal Air Force und der Women’s Auxiliary Air Force sicher nur Wenigen bekannt sind.
* Allgemeiner Teil
- September 1940: Nach dem Krieg als Battle-of-Britain-Tag bezeichnet; stellt die Wende in der Luftschlacht um England dar.
Acre: engl. Flächenmaß, ca. 0,4 ha.
Anschlagen: Seemännische Bezeichnung für angeseilt.
Arizona-Territorium: Der Staat Arizona trat den USA am 14. Februar 1912 bei. Bis zur Aufnahme als Staat wurde die Region als Arizona-Territorium bezeichnet.
AVGAS-Anlage: Betankungsanlage für Flugbenzin
Fahrenheit, Grad: In angloamerikanischen Ländern gebräuchliche Temperaturskala, 1714 von dem Physiker Daniel Gabriel Fahrenheit (* 24.05.1686 in Danzig, † 16.09.1736 in Den Haag) entwickelt. Fixpunkte: Gefrierpunkt des Wassers 32° F, Siedepunkt 212 ° F. Umrechnung °C in °F: Mit 9 multiplizieren, durch 5 dividieren, 32 addieren. Umrechnung ° F in ° C: 32 subtrahieren, mit 5 multiplizieren, durch 9 teilen. 70° F = 21,1° C. 65° F = 18,3° C.
Grad: In der fliegerischen Navigation wird der Kurs nicht wie in der Seefahrt mit Nord, Süd, Ost, West oder Zwischenstufen davon angegeben, sondern in Grad. 0 oder 360 Grad ist Nord, 90 Grad Ost, 180 Grad Süd, 270 Grad West.
Gummiwaaren: Nein, das ist kein Tippfehler, der Laden schreibt sich wirklich so. Ich bin auf dem Schulweg häufig genug dran vorbeigefahren. Die Firma existierte in Hamburg-Barmbek von 1870 bis 2009, als die Produktion nach Lüneburg verlegt wurde. Die Gebäude wurden im Krieg zerstört, die Hallen danach an gleicher Stelle wiederaufgebaut.
John Bull: Amerikanischer Spitzname für Großbritannien, bzw. dessen Regierung.
Knoten: Nautische Geschwindigkeitseinheit, Einheitszeichen kn. 1 Knoten = 1 Seemeile/Stunde. 1 sm = 1.852 m. 154 kn ~ 285 km/h
Kutter: Alle Schiffe der US Coast Guard werden als Kutter bezeichnet, egal, welche Größe sie haben.
lbs: englische Maßeinheit, die sich vom lateinischen libra ableitet und als Abkürzung für englische Pounds steht. 1 lb. = 0,454 kg. 6.000 lbs sind 2,724 Tonnen.
Lenzen: einen Raum leer („lenz“) pumpen.
Luft Hansa: Zwischen der Gründung im Jahr 1926 und dem Ende des 2. Weltkrieges wurde die Firmenbezeichnung Luft Hansa geschrieben. Erst mit der Neugründung 1951 erfolgte auch die Änderung der Schreibweise in die heute bekannte Lufthansa.
PPL: Abkürzung für Privatpilotenlizenz.
Slot: Zeitfenster in der Luftfahrt; die Zeit, in der ein Flugzeug starten bzw. landen kann.
Zahlen: Normalerweise schreibe ich Zahlen als Zahlwörter aus. In dieser Geschichte habe ich ausnahmsweise weitgehend Ziffern verwendet, weil manche Zahlen doch zu unübersichtlich werden würden. Ich bitte hierfür um Nachsicht.
** Militärischer Teil (allgemein)
Allgemeine militärische Begriffe und historische Personen
Douhet: Giulio Douhet, italienischer Luftwaffengeneral. Douhet entwickelte die Theorie, dass strategische Bombenangriffe auf zivile Ziele einen Krieg entscheiden können. Die Theorie war schon zu Zeiten der Entstehung umstritten, da sie der Haager Landkriegsordnung von 1907 widersprach, nach der Zivilisten von Kriegshandlungen zu verschonen sind. Die Alliierten im 2. Weltkrieg haben sich an dieser Theorie orientiert, was zu entsprechend bewussten Angriffen auf zivile Ziele führte.
Elfhundert: Im der militärischen Sprachgebrauch der US-Streitkräfte werden Zeiten im Wortsinne ohne Punkt und Komma angegeben. Es gilt eine vierundzwanzig-Stunden-Einteilung, die in vier Ziffern angegeben wird. Elfhundert bedeutet also elf Uhr morgens, nullneunhundert entsprechend morgens neun Uhr.
GEE-Peilung: Britisches Radarverfahren zur Auffindung des Zieles bei Nacht.
Indianer: deutsche Bezeichnung für feindliche Flieger
Pauke-Pauke: Gilt nach einigen Quellen als deutsches Angriffssignal der Jagdflieger.
Provost Department: Militärjustiz der US Army.
Radada: Fachbegriff in der Fliegerei; Flugzeug fliegt unterhalb des Radarstrahls, um 300 Meter/1000 Fuß Höhe.
Stacking: Flugformation. Die beteiligten Flugzeuge fliegen dabei vertikal leicht (meist eineinhalb Maschinenhöhen [gemessen von der Leitwerkspitze bis zum unteren Ende des Fahrwerks bzw. des Rumpfes, wenn das Fahrwerk eingezogen ist] versetzt.)
Militärische Dienstgrade:
Ich halte es für denkbar, dass auch mit den deutschen Dienstgraden nicht jeder etwas anfangen kann und gebe daher zunächst einen kurzen Überblick über die deutschen Einteilungen während des 2. Weltkrieges. Der niedrigste Dienstgrad wird dabei jeweils zuerst genannt:
Offiziere: Leutnant – Oberleutnant – Hauptmann – Major – Oberstleutnant – Oberst – Generalmajor – Generalleutnant – General (der Infanterie, der Panzertruppen, der Flieger, etc.) – Generaloberst – Generalfeldmarschall
Unteroffiziere: Unteroffizier – Unterfeldwebel – Feldwebel – Oberfeldwebel – Stabsfeldwebel
Mannschaften: Soldat – Oberschütze – Gefreiter – Obergefreiter – Stabsgefreiter
Offiziere: Leutnant zur See – Oberleutnant zur See – Kapitänleutnant – Korvettenkapitän – Fregattenkapitän – Kapitän zur See – Kommodore – Konteradmiral – Vizeadmiral – Admiral – Generaladmiral – Großadmiral
Unteroffiziere: Maat – Obermaat – Bootsmann – Stabsbootsmann – Oberbootsmann – Stabsoberbootsmann – Fähnrich zur See – Oberfähnrich zur See.
Mannschaften: Matrose – Matrosengefreiter – Matrosenobergefreiter – Matrosenhauptgefreiter – Matrosenstabsgefreiter – Matrosenoberstabsgefreiter
Paramilitärische Einheiten (hier SS):
Standartenführer = Oberst
Ausländische Militärdienstgrade
In der Regel sind hier britische oder amerikanische Dienstgrade genannt. Abweichende Bezeichnungen anderer Länder, die im Text vorkommen, sind ausdrücklich genannt.
Air Commodore: Entspricht dem Brigadegeneral bei der Bundeswehr. Nach britischer Auffassung ist der Air Commodore jedoch kein General, sondern ein Sonderrang, der eher einem „Stabsoberst“ entspricht. (Beim italienischen Heer gibt es den Primo Capitano, einen Rang zwischen Hauptmann und Major, der als Dienstgrad einzigartig ist. In „Farewell To Arms“ bezeichnet Ernest Hemingway diesen Rang als First Captain, in deutschsprachigen Büchern wird er mit Stabshauptmann übersetzt. Das ist so ähnlich wie der Air Commodore der RAF, wenn auch im Bereich der Subalternoffiziere …)
Brigadier-General: So genannter 1-Stern(e)-General. Bei der Bundeswehr = Brigadegeneral, bei der Wehrmacht entsprechend dem Generalmajor.
Caporal: frz.: Gefreiter
Captain : Bei der Army = Hauptmann, bei der Navy = Kapitän zur See.
Colonel: Oberst
Commandant: frz. für Major
Commodore: Kommodore
Company Commander: Hauptmann der Women’s Auxiliary Air Force (WAAF)
Deputy Company Commander: Oberleutnant der WAAF
Ensign: Leutnant zur See
First-Lieutenant: Oberleutnant
Flight Lieutenant: Hauptmann der RAF (Royal Air Force)
Flight Officer: Hauptmann WAAF (ab 1942)
Flying Officer: Oberleutnant der RAF
Group Captain: Oberst der RAF
Lieutenant: Bei der Army = Leutnant, bei der Navy = Kapitänleutnant
Lieutenant-Commander: Korvettenkapitän
Lieutenant-General: Generalleutnant
Lieutenant Junior Grade: Oberleutnant zur See
Petty Officer: P.O. 3rd – 1st Class: Untere Unteroffiziersdienstgrade der Navy, entsprechen dem Maat – Obermaat – Bootsmann der deutschen Marine.
Pilot Officer: Leutnant der RAF
Private: einfacher Soldat, unterster Dienstgrad überhaupt
Seaman: Matrose; unterster Dienstgrad bei der US Navy.
Second-Lieutenant: Leutnant
Sergeant: Feldwebel
Soldat Premier Classe: frz.: Gefreiter
Squadron Leader: Major der RAF
Wing Commander: Oberstleutnant der RAF
Anhang III
Hypothetische Besetzungsliste
Ich denke, jeder Schriftsteller hat eine gewisse Vorstellung von seinen wesentlichen Figuren. Mir persönlich geht es so, dass ich mir bestimmte Schauspielerinnen und Schauspieler in den Rollen meiner Figuren vorstelle. Die Vorstellung kann zuweilen wechseln, wie ich zugebe.
Die vorliegende Geschichte Feuerhimmel ist in ihren Ursprüngen über 30 Jahre alt. In jenen Tagen war Harrison Ford eine passable Vorstellung für Steve Donovan, auch wenn er das richtige Alter bereits deutlich überschritten hatte – Steve Donovan ist zu Beginn dieser Geschichte 27 Jahre alt, Harrison Ford war zu dem Zeitpunkt, als ich meine ersten Versuche mit dieser Geschichte machte, 38 Jahre alt. 1998, also vor 15 Jahren, begann ich dann nach längerer Recherche zum 2. Weltkrieg die Fragmente, die zu dieser Geschichte existierten, in eine flüssig lesbare Fassung zu bringen. Man kann sich unschwer ausrechnen, dass Mr. Ford dann 56 Lenze zählte und für die Besetzung eines 27jährigen gewiss nicht mehr in Betracht kam.
Aus heutiger Sicht und mit meinen gegenwärtigen Präferenzen, was Schauspieler betrifft, ergibt sich folgende Besetzungswunschliste, die nie und nimmer von irgendeinem Produzenten auf dieser Welt realisierbar wäre, weil die Leute vermutlich viel zu teuer wären, um sie alle in einem Film unterzubringen. Bei einem wäre es schon deshalb unmöglich, weil er leider nicht mehr unter den Lebenden weilt.
Diese Liste wird – wie das Glossar – kapitelweise aktualisiert. Es gibt sicher noch Figuren, für die ich bislang keine Vorstellung habe. Sollte jemand Ideen haben, bin ich für Anregungen dankbar.
Captain Steve Donovan: Orlando Bloom (ist zwar Brite, ist zwar Brite und zählt inzwischen 39 Lenze, wirkt aber immer noch jung genug, hat schon mehrfach Amerikaner gespielt und lebt in Los Angeles.)
Hauptmann Siegfried Heinsohn: Daniel Brühl
Lieutenant Angelo D’Amato: Giovanni Ribisi
Colonel Charles Worsley: Kevin Costner
Lieutenant-Commander Sidney Donovan: Christian Bale (auch Brite …)
Lieutenant Mark Donovan: Heath Ledger (ich hätte ihn zu gern noch mal mit Orlando in dieser Welt zusammen gesehen … Friede sei seiner Seele)
Stella Donovan: Karen Allen
Dr. Reginald Victor Jones: Jack Davenport
Group Captain Henderson: Brendan Gleeson (bekannt als Menelaos in Troja, Reynald de Châtillon in Königreich der Himmel, Mad Eye Moody in Harry Potter und der Feuerkelch)
Pilot Officer Daniel Collins: Peter Cant (spielte den zum Ritter geschlagenen Bauernjungen in Königreich der Himmel)
Group Captain Sir Francis Collins: Jonathan Pryce
Squadron Leader/Major Vanderbuilt: Brad Pitt
Squadron Leader McMonahan: Daniel Craig
Pilot Officer Jerry Cox: Sean Astin
Harriet Collins: Keira Knightley
Kadett Winston Bellamy: Elijah Wood
Kadett Jonathan Coffer: Zac Efron
General James Doolittle: Alec Baldwin (hat diese Rolle schon gespielt)
Colonel Sam Bennett: Liam Neeson
Major Waldo Hopkins: Marton Csokas
Pilot Officer Ian McFarlane: Ewan McGregor
Dr. Calvin Small: Matthew MacFayden
Company Commander Maggie McFarlane: Kate Winslet
Lieutenant-Colonel Roger Hartwig: David Meunier
Major Sandy Hudson: Edward Norton
Wing Commander Bossom: Geoffrey Rush (okay, Australier, aber immerhin British Empire …)
Captain Lucius Morgan: Hugh Jackman (auch Australier …)
Butler Marcus: Colin Firth
Mildred Collins: Mary Elizabeth Mastrantonio (zwar Amerikanerin, aber wenn Briten Amis spielen können, geht das auch umgekehrt …)
Dr. Harry Nolan: Stellan Skarsgård/Luke Evans
Lieutenant Flint Anderson: Hayden Christensen (Kanadier zwar, aber …)
Ilse Hufnagel, Heinsohns Verlobte: Diane Kruger
* Mit dem Wirksamwerden des Großhamburg-Gesetzes, mit dem die bis dahin preußischen Orte Altona, Harburg und Wandsbek mit ihren Stadtteilen nach Hamburg eingemeindet wurden, wurde auch das protestantische Religionsprivileg der Freien und Hansestadt Hamburg aufgehoben (Quelle: Ingeborg Braisch, Lehrerin für Geschichte, Sophie-Barat-Schule, Hamburg)
Wenn dir diese Leseprobe gefallen hat, findest du das ganze Buch mit 533 Seiten hier:
Taschenbuch 19,00 €
Gebundenes Buch 26,00 €
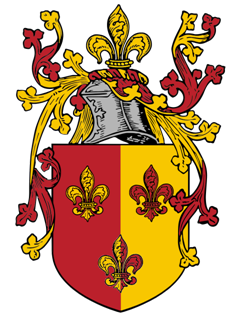

Schreibe einen Kommentar